Aktuelles
DownStrike: IT-Chaos hat Luftverkehr durcheinandergewirbelt – auch heute noch Störungen
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Tausende Flüge fielen aufgrund der Softwarepanne von CrowdStrike aus – von den USA bis Australien. In Deutschland stellte der Hauptstadtflughafen BER den Betrieb weitgehend ein. Der Überblick...
Wehrhafter, resilienter, nachhaltiger: Ein Jahr Nationale Sicherheitsstrategie
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Die Nationale Sicherheitsstrategie ist für uns in Deutschland ein Quantensprung. Sie spiegelt ein neues Verständnis in unserem Land wider, wie wir über Sicherheit denken. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine führt uns drastisch vor Augen, dass unsere Sicherheit verletzlich ist. Wir müssen viel stärker als bisher für sie einstehen. Diese Erkenntnis war für die Arbeit an der Nationalen Sicherheitsstrategie prägend und sie bestimmt unser Verständnis von Sicherheit weiterhin. Die Strategie hat uns nach innen und außen ein Navigationssystem gegeben und uns handlungsfähiger gemacht.
Sicherheitspolitik in der Zeitenwende
Gegenüber unseren Partnern in Europa und in der Welt erklärt die Nationale Sicherheitsstrategie das „Zeitenwende-Deutschland“: Ein Deutschland, das ein Sondervermögen auf den Weg gebracht hat, um die Bundeswehr als starken Bestandteil der NATO zu stärken, damit wir uns gegen Krieg und Gewalt schützen können. Ein Deutschland, das seine Rolle in Zeiten globaler Machtverschiebungen und systemischer Rivalität kennt und starke Antworten auf Bedrohungen für unsere Demokratie und freiheitliche Grundordnung gibt. Ein Deutschland, das auch begriffen hat, dass Sicherheit mehr ist als Militär und Diplomatie.
Die in der Strategie angelegte Politik der Integrierten Sicherheit bedeutet z.B. auch Rohstoffsicherheit, Sicherheit von Lieferketten, Cybersicherheit, Sicherheit vor Desinformation und die Sicherheit von kritischer Infrastruktur. Durch die Anerkennung der Klimakrise als größte Sicherheitsgefahr dieses Jahrhunderts hilft uns die Nationale Sicherheitsstrategie zudem dabei, Prioritäten im Blick zu behalten, die über das tägliche, akute Krisenmanagement hinausgehen. All diese Fragen betreffen unsere Sicherheit – und wir werden sie nur gemeinsam mit unseren Verbündeten beantworten können.
Gesamtgesellschaftlicher Bewusstseinswandel
Der Mehrwert der Nationalen Sicherheitsstrategie nach innen besteht in einer zweifachen Selbstvergewisserung: Erstens, ein gesamtgesellschaftlicher Bewusstseinswandel in Bezug auf unsere Sicherheitslage. Zweitens, das Einverständnis, vor diesem Hintergrund gemeinsam und integriert vorzugehen. Integrierte Sicherheit bedeutet dabei auch, dass jeder zur Verbesserung der Sicherheit unseres Landes beitragen kann. Dank dieses neuen Verständnisses von Sicherheit haben wir im letzten Jahr in alle Dimensionen unserer Sicherheit investiert. In unsere Wehrhaftigkeit, also den Schutz vor Krieg und Gewalt, in unsere Resilienz, also die Widerstandskraft unserer Gesellschaft gegen Angriffe auf unsere Freiheit und unsere Demokratie und in Nachhaltigkeit, in den Schutz unserer Lebensgrundlagen.
Die Nationale Sicherheitsstrategie bringt Schlussfolgerungen, Werte, Ziele und Interessen zu Papier, auf deren Grundlage wir gemeinsam Lösungen finden können.
Humanitäre Katastrophe in Gaza – Deutschland hilft
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Schon seit Wochen passieren zu wenig Hilfsgüter die Grenze nach Gaza, insbesondere im Norden des Küstenstreifens bleibt die humanitäre Lage katastrophal. Nach dem Beschuss des Grenzübergangs Kerem Schalom durch die Hamas und dem Einsatz der israelischen Armee in Rafah hat sich auch die Versorgungslage im Süden verschlechtert.
Nach dem brutalen Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober leidet auch die Zivilbevölkerung in Gaza unter den Folgen des Terrors der Hamas. Die Basisversorgung für die Zivilbevölkerung ist zusammengebrochen und es fehlt dort hunderttausenden Menschen, unter ihnen vielen Kindern, am Allernötigsten, v.a. Lebensmittel, Wasser und medizinischer Versorgung. Deshalb ist es wichtig, dass humanitäre Hilfe schnell und ungehindert an die Zivilbevölkerung in Gaza verteilt werden kann. Auch darum ging es bei den acht Reisen von Außenministerin Baerbock in die Region seit dem 7. Oktober 2023. Deutschland hat seine humanitäre Hilfe für die Menschen in den Palästinensischen Gebieten immer wieder aufgestockt.
So sagte die Außenministerin am 25. Juni in Jerusalem:
Deutschland stockt seine humanitäre Hilfe in Gaza um weitere 19 Millionen Euro auf. Unter Lebensgefahr bringen UNRWA und das Welternährungsprogramm damit Mehl und Reis zu hungernden Familien. Denn für die Kinder in Gaza ist jede noch so kleine Mahlzeit überlebenswichtig. Und jede Kiste medizinisches Material der Weltgesundheitsorganisation wird helfen, in zerstörten Krankenhäusern wie dem Nasser Medical Complex wieder ein Minimum an medizinischer Versorgung zu ermöglichen.
Mit deutscher Unterstützung können die Weltgesundheitsorganisation sowie das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter, Care International und Oxfam die Gesundheitsversorgung in Gaza verbessern – etwa durch mobile Kliniken in Notunterkünften und den Einsatz von Anlagen zur Wasseraufbereitung. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR erhält weitere Mittel, um Verletzte aus Gaza in Ägypten zu versorgen.
Insgesamt steigt die Gesamthilfe für die Palästinensischen Gebiete auf ca. 313 Millionen Euro, davon ca. 240 Millionen Euro neue Mittel seit dem 7. Oktober 2023.
Hilfe auf allen Wegen
Von Mitte März bis Ende Mai beteiligte sich Deutschland auch an Luftabwürfen für die notleidende Bevölkerung in Gaza. Insgesamt wurden über 315 Tonnen Hilfsgüter abgesetzt.
Gleichzeitig arbeiten wir weiter daran, dass auch über den Landweg mehr Hilfe nach Gaza kommt. Für eine ausreichende Versorgung der Menschen in Gaza braucht es dringend die Öffnung weiterer Grenzübergänge durch die israelische Regierung, um mehr Hilfslieferungen mit LKW auf dem Landweg zu ermöglichen.
Lebensmittel, Wasser, Medikamente und Hygieneartikel
Das Auswärtige Amt arbeitet mit den Vereinten Nationen und erfahrenen internationalen Hilfsorganisationen zusammen, um die dringend benötigte Hilfe zu den Menschen in Gaza zu bringen. Unsere Partner vor Ort sind unter anderem das Welternährungsprogramm, das Kinderhilfswerk UNICEF und das Deutsche Rote Kreuz.
Mit der von Deutschland zur Verfügung gestellten humanitären Hilfe können die Organisationen Grundnahrungsmittel, medizinische Versorgung und Hygieneprodukte nach Gaza bringen. Verteilt werden zum Beispiel Hirse, Reis, Kichererbsen und Öl, aber auch medizinische Produkte wie Verbandsmaterial und Spritzen.
Deutschland kooperiert eng mit Partnern in der Region: Wir liefern Hilfsgüter nach Ägypten und Jordanien, damit diese von dort weiter nach Gaza transportiert werden können. So wurden zum Beispiel im Februar lebenswichtige Medikamente nach Jordanien geliefert, die dann in Jordanischen Feldlazaretten in Gaza zum Einsatz kommen.
Sondergesandte für humanitäre Hilfe im Nahen und Mittleren Osten koordiniert den deutschen Beitrag
Zur Koordinierung des deutschen Beitrags hat Außenministerin Baerbock hat die erfahrene Karrierediplomatin Deike Potzel als Sondergesandte für humanitäre Hilfe im Nahen und Mittleren Osten ernannt. Damit fungiert sie u.a. als Counterpart der US-Sondergesandten Lise Grande und ist zentrale deutsche Ansprechpartnerin für die Akteure in der Region. Das Engagement der Sondergesandten bettet sich ein in die internationalen Bemühungen, die humanitäre Notlage abzumildern, unter der die Zivilbevölkerung Gazas in Folge der Terrorangriffe der Hamas leidet.
Die Sondergesandte ist im Rahmen von humanitärer Pendeldiplomatie in der Region Ansprechpartnerin für UN-Organisationen (OCHA, UNRWA, WFP, UNICEF), das IKRK sowie internationale und regionale Partner. Zudem hält sie engen Kontakt zu den Verantwortlichen für humanitäre Hilfe in der Region sowie den Hauptstädten unserer Partner. Ihre Arbeit baut auf dem langjährigen deutschen humanitären Engagement und Bemühungen für Frieden und Stabilität in der Region auf.
Das UN-Hilfswerk UNRWA
Die Arbeit des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge UNRWA ist für die Grundversorgung der palästinensischen Bevölkerung lebenswichtig. Ende Januar 2024 sind schwere Vorwürfe gegen Mitarbeiter der Organisation erhoben worden. Eine von der UN eingesetzte Kommission um die ehemalige französische Außenministerin Catherine Colonna hat im April 2024 einen Untersuchungsbericht vorgestellt. Der Bericht hält fest: UNRWA leistet wichtige Arbeit in Gaza, es besteht allerdings Verbesserungsbedarf bei seinen Strukturen. Dafür werden 50 konkrete Empfehlungen ausgesprochen. UNRWA hat sich verpflichtet, diese Empfehlungen umzusetzen. Daraufhin hat die Bundesregierung entschieden, die Zusammenarbeit mit der Organisation in Gaza wieder aufzunehmen.
Speech of Foreign Minister Baerbock at the Herzliya-Conference 2024
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt
Speech of Foreign Minister Baerbock at the Herzliya-Conference 2024 „On the Path of Strategic Surprises” on 24. June 2024
Excellencies,
ladies and gentlemen,
Some images, some words don’t leave you.
And maybe they never will.
Like the words I heard from Yoni, whose wife Doron and two daughters Raz and Aviv were cruelly taken by Hamas on 7 October.
For endless days and nights, Yoni feared for their lives. When the three were released on 25 November, it was a moment of immense joy – in a time of enduring pain. One hundred and twenty hostages are still being held in Gaza.
“I am just glad that my wife’s grandmother did not live to see this.”
That’s what Yoni said, referring to Safta Tirtza, who was born in Munich and who survived the Shoah.
Yoni’s words have stayed with me since.
The images of 7 October have stayed with me since. As a human, a parent.
But also as the Foreign Minister of a country that was responsible for the worst crime in history: the Shoah, the state-planned murder of six million Jews – with the aim of extinguishing Judaism in Europe.
The Nazis hunted down Jews, dragged them out of their homes and murdered them systematically and in cold blood.
The hope of Israel’s founders was that Israel would be the place where Jews would never have to experience this again, where they would be safe.
On 7 October, this assurance was shaken to its core, not only for Jews in Israel, but for people of the Jewish faith worldwide.
It was important to me to come to Israel directly after 7 October – in order to understand this trauma. To meet with relatives of the hostages, like Yoni. To sit in the situation room in Netivot, forcing myself to watch the horrific video of the 7 October atrocities. To see, to understand.
And to make sure that in everything we do, we help to prevent Hamas’ cynical terrorist playbook from succeeding.
I’ve been to this region ten times in nine months, and with every visit, my concerns have been growing that we are slip-sliding towards a dead end… all together. This is why I am thankful for your invitation to this conference. Because I believe we can only prevent this all together.
The security of the State of Israel is paramount for my country. It is part of our raison d’état, as Chancellor Angela Merkel put it when she addressed the Knesset in 2008. You have heard that many times from German politicians.
But what does this mean – today, in this time of anguish? It means standing up for Israel’s security when it is under attack. A 7 October must never happen again.
It means saying very clearly that Israel has the right to defend itself, like any other country in the world. Hamas wanted to destroy Israel’s security, but also Israel’s legitimacy.
Hamas started this war. And it must end this horror. Hamas must release all of the hostages – some of whom are German citizens. Hamas must cease its attacks on Israel. It’s Hamas who has sought to spark a regional escalation with the help of its international backers.
Standing up for Israel’s security means reiterating this message again and again, particularly when talking to those who are cynically seeking to move the focus away from the atrocities of 7 October.
This also means that Israel has the right to defend itself against Hizbollah’s relentless attacks in the north. It’s Hizbollah who started this violence on 8 October, forcing tens of thousands of Israelis from their homes.
No country in the world should have to accept that. All Israeli citizens – from Rosh Hanikra to Metula – have a right to feel safe in their homes.
UN Security Council Resolution 1701 must be implemented, full stop. This requires Hizbollah to completely and verifiably withdraw from the Blue Line.
We are extremely concerned about the increase in violence at the northern border. I will pay a visit to Beirut tomorrow for this reason – where many also do not want another war.
Together with our partners, we are working hard on finding solutions that can prevent more suffering. The risk of an unintended escalation and of all-out war is growing by the day.
The utmost prudence is therefore required.
But, ladies and gentlemen, standing up for Israel’s security – today – means more than standing up for its immediate security, its right to self-defence.
It means making sure that Hamas’ strategy, its playbook, does not succeed. It means helping build a future in which Israelis know that their security is not something temporary and fragile, but that this security is lasting. That they can rely on it.
When I say that the security of the State of Israel is paramount for my country, it is this lasting security for all Israelis that we strive for, that guides our thinking and informs our actions.
A future in which children from Sderot and Kiryat Shmona can return to their homes, their schools.
A future in which Israelis won’t have to fear rocket attacks from Gaza – again and again.
A future in which Israel can prosper because it is at peace with its regional neighbours.
A future in which the ruthless threat that Iran poses to Israel’s legitimacy is deterred, with the help of Israel’s international partners.
No one believes that this can happen overnight or will be easy to accomplish. Lasting security might sound like a faraway vision today. But that should not deter us. If we were to throw up our hands in resignation – that would mean hell.
What I want to do here today, after all of the talks I’ve held in the past weeks and months, is to share my thoughts on what elements I believe are crucial to pave a way forward – for Israel’s regional, its political security – and how we can counter the efforts to delegitimise it.
In my view, four elements are crucial.
The first and most important one, from which all others derive, is that lasting security for all Israelis will only be possible if there is lasting security for Palestinians.
And, at the same time, lasting security for Palestinians will only be possible if there is lasting security for Israelis. One is not possible without the other.
Pursuing the vision of two states, living side by side, in peace and prosperity, remains the best path towards this lasting security.
That is not a popular opinion with everyone here in Israel, maybe even less so today than before 7 October, I am aware of that.
And who am I to tell you what’s best?
But as a firm friend of Israel, how could I not share my concerns and ask: What is the alternative to a future in which all people in this region can live without the fear of constantly recurring violence? To a vision that can ensure Israel’s future as a Jewish and democratic state?
What’s crucial now, to build lasting security, is to find ways to stop the violence in Gaza, to end the fighting permanently.
This has been the focus of all of my talks here in Israel, as well as with our US, European and Arab partners.
Hamas has been cynically using civilians as human shields. Yet we equally know that, also when it comes to self-defence, the restrictions imposed by international humanitarian law such as distinction, precaution and proportionality must be respected.
That’s why we must address the catastrophic humanitarian situation in Gaza. According to UNICEF, at least 17,000 children are now orphaned or separated from their parents.
And as much as it was crucial for me to watch the video of the atrocities of 7 October, it was and is crucial to me to see the pain behind these images from Gaza.
How often, after my conversations with Yoni, did I ask myself: What would I do if 7 October happened to my daughters?
And how often, in the last few months, did I ask myself: What would I do if my children were without me and my husband in Gaza today?
These images from Gaza are travelling the globe, sparking strong emotions – in the Arab world, but also in the US, in Europe, in my country, everywhere. Disbelief. Sadness. But also anger.
And as a friend of Israel, I want to be frank. This anger is not helping Israel to meet its security needs – to the contrary. It only serves Hamas’ cynical drive to provoke further escalation.
That’s why we have emphasised from the outset that Israel must exercise its right to self-defence within the framework of international humanitarian law.
This is what distinguishes democracies from terrorists – that Israel’s military operation targets Hamas and not the civilian population.
We have also pushed hard for humanitarian assistance to reach the people in Gaza.
Because we don’t want Hamas’ strategy to succeed. And we don’t want Israel to lose itself in this war. What it is and what it stands for.
Or, as the mother of one of the Israeli hostages said to me: “It does not bring my child back if a Palestinian mother loses her child in Gaza.”
Humanity is indivisible.
That’s why, in all international forums, I have refused to only speak about the suffering of the people on one side. I strongly believe that it makes us all safer if we see the suffering of the other. If we take the needs of the other into account.
It is this humanity that makes democracies stronger and safer.
And that is my second point. Israel’s greatest strength and its best protection is its humanity, its commitment to democratic values, to international law and human rights.
Looking back at the past nine months, what has struck me is the incredible resilience and humanity of the people of Israel.
After 7 October, people from all backgrounds – Jewish, Muslim, Christian, others – rushed in to help, opening their homes, providing support. It shows how incredibly strong the Israeli nation is when it stands together.
Israel’s democracy is diverse and vibrant. Israel’s strong democratic values form the backbone of this nation.
I have to admit – it is particularly in this knowledge of Israel’s democratic strength that I find certain reports so disturbing. The allegations of mistreatment of detainees from Gaza, not only at the Sde Teiman site. Reports of how extremist settlers in the West Bank are brutally driving Palestinians from their homes, far too often without being duly prosecuted. And, very recently, reports of how certain members of the Israeli cabinet are pushing for the financial destruction of the Palestinian Authority and measures which further entrench the occupation of the West Bank.
These reports are so disturbing because they do not reflect what I believe unites us, as strong democracies.
The knowledge that we are strongest when we uphold human rights, international law, when we rally around these values, united, at the heart of the international community.
That, I believe, is key, and it brings me to my third point: lasting security will only be possible together with partners.
Because isolation is the enemy of security.
I see and I share the frustration at the fact that many in the world refuse to condemn Hamas for its atrocities. We have spoken out on this, relentlessly, particularly at the United Nations.
But we have also seen in the past weeks that partnership is and remains indispensable.
We saw how Israel’s regional neighbours helped to avert Iran’s aggressive drone and missile attack on 13 April. This was a glimpse at what might be possible in the region in security cooperation one day.
We see how international partners, through the UN mission UNIFIL and other instruments, are seeking to prevent further escalation at the border with Lebanon.
We also see how the international community, and Israel’s Arab partners in particular, have rallied around the desire to help end the war in Gaza, by putting proposals on the table.
The plan that President Biden presented, based on Israeli proposals, and that was endorsed by the UN Security Council – by partners from the Arab world, from Europe, the Americas, Asia and Africa – is a clear path towards that goal.
Towards a ceasefire, the release of the hostages. Towards lasting security for both Israelis and Palestinians. And like many other participants who have spoken at this conference today, we urge Hamas to accept this plan. And we count on Israel to stand by its commitments.
I am aware that not everyone in Israel approves of President Biden’s outline. Some call for continuing Israeli control of Gaza, for a war that goes on indefinitely.
I want to ask in all sincerity:
How would an endless war help the security of the families who want to return to their homes in Sderot, in Kiryat Shmona?
How would it end the suffering of the relatives of the hostages?
And how would more suffering in Gaza bring more security to Israel?
Israel has achieved real success in its effort to destroy Hamas’ military capabilities.
And, crucially, Hamas is now facing a situation that it always wanted to prevent: Israel’s Arab neighbours have come together to contemplate a better future for the region, ways to create security for Israel and Palestinians. This is what we should build on.
And that means, and this is my fourth point, that we need to take a realistic look at the shape of a future Gaza.
A Gaza where Palestinian women, men and children can live in dignity, without fear – and, crucially, a Gaza from which Hamas no longer poses a threat to the existence of the State of Israel.
We have spent the last weeks engaging with our international partners on how to move towards that future.
Most urgently:
How do we end Sinwar’s and Deif’s reign of terror in Gaza?
What kind of governance would come after that?
How do we finance economic reconstruction? How do we ensure these efforts are not exploited to build new terrorist structures?
Eventually, it’s clear that Palestinians must assume security responsibility for all of Gaza. But until that is the case, Israel needs to be certain that its security needs are being met.
With our Arab, US and European partners, we have been considering this issue, asking how an international presence could project security in the interim.
What does Israel need, and what do the Palestinians need? And – as international partners – what should our respective responsibilities be? What would each of us be willing to contribute?
As a country that was able to grow its democracy after World War Two through the help of its partners, we know how important a broad and long-lasting international commitment, especially a security commitment, is in such efforts. Just as our partners were there for us then, we want to be there for them today.
We are grateful that our Arab partners are driving this conversation.
They have been explicit: without a roadmap towards a Palestinian state and without assurances that this will be the last war in Gaza, they will not start investing in Gaza’s reconstruction.
This important message deserves to be heard, including in Israel. We have to consider their vision together with what we Europeans, Americans and others are willing to offer.
And it’s clear, I tell all sides, that women need a place at the table in any peace negotiations. We see it around the world: peace treaties don’t last if women – half of any society – are not included.
If we want the PA to eventually assume a role as the legitimate governing authority in Gaza, it has to actually be in a position to do so.
With civil servants who are capable of providing public services, with a private sector that can help to meet the enormous humanitarian needs and, crucially, with police and security forces that are properly trained to ensure safety and public order.
For that to happen, the PA needs to reform. But the PA also needs adequate resources to take on this enormous task. It’s therefore counterproductive to withhold the funds the PA is entitled to.
When the salaries of teachers and doctors are no longer fully paid, this has dire consequences.
In the current situation, it’s dangerous and self-defeating to destroy and destabilise established PA structures.
I say this with a particular view to the West Bank, where the illegal expansion of settlement projects is doing exactly that.
To build lasting security and stability, Israel needs capable partners it can rely on.
A reformed PA should be such a partner.
Israel’s regional neighbours should be such a partner.
We are such a partner.
A partner who also knows that the path towards lasting security will be very difficult.
But – coming back to the beginning of my speech – throwing up our hands in resignation is not an option, because that won’t end the pain of the hostages’ families, and it won’t end the suffering of the innocent children in Gaza.
Hamas’ cynical strategy must not succeed.
So that together, we can work towards a better future.
A future in which security is not fragile, but lasting – because it is built on the solid foundations of humanity, international partnership and the premise that no one is safe unless their neighbours are safe.
Because your lasting security is paramount for us.
Diplomatischer Dauereinsatz: Außenministerin Baerbock reist erneut nach Israel, in die Palästinensischen Gebiete und nach Libanon
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Nach ihrer Ankunft am Montagabend wird die Außenministerin auf Einladung der Organisatoren der Herzliya-Sicherheitskonferenz in Tel Aviv eine Rede halten. Im Zentrum ihrer Rede wird die Frage stehen, was es konkret bedeutet, für die unmittelbare aber auch langfristige Sicherheit Israels einzutreten, und Gedanken zu den Elementen darlegen, die entscheidend sind, um einen Weg aus dem Konflikt und nach vorn zu ebnen.
Die Herzliya-Konferenz ist eine hochrangige Veranstaltung mit Teilnehmenden aus Politik und Wissenschaft und existiert seit über 20 Jahren. Sie ist ein wichtiges Dialogforum, um mit der ganzen Bandbreite der israelischen Gesellschaft in Austausch zu kommen.
Pendeldiplomatie: Gespräche in Ramallah und Jerusalem
 Am Dienstag sind zunächst Gespräche in Ramallah mit dem neuen Ministerpräsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Mohammed Mustafa, geplant. Vor ihm liegt keine einfache Aufgabe – denn die PA braucht dringend Reformen. Und zugleich ist die wirtschaftliche Lage desolat. Auch hat die Gewalt israelischer Siedler zugenommen, und die israelische Regierung hält seit Mai der PA zustehende Steuer- und Zolleinkünfte komplett zurück. Dabei erbringt die PA im Westjordanland unverzichtbare öffentliche Dienstleistungen, also Schulbildung, Krankenhäuser, Infrastruktur und in Teilen auch Sicherheit. Ein drohender finanzieller Kollaps der PA würde die schon jetzt zerbrechliche Sicherheitslage im Westjordanland weiter in Gefahr bringen.
Am Dienstag sind zunächst Gespräche in Ramallah mit dem neuen Ministerpräsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Mohammed Mustafa, geplant. Vor ihm liegt keine einfache Aufgabe – denn die PA braucht dringend Reformen. Und zugleich ist die wirtschaftliche Lage desolat. Auch hat die Gewalt israelischer Siedler zugenommen, und die israelische Regierung hält seit Mai der PA zustehende Steuer- und Zolleinkünfte komplett zurück. Dabei erbringt die PA im Westjordanland unverzichtbare öffentliche Dienstleistungen, also Schulbildung, Krankenhäuser, Infrastruktur und in Teilen auch Sicherheit. Ein drohender finanzieller Kollaps der PA würde die schon jetzt zerbrechliche Sicherheitslage im Westjordanland weiter in Gefahr bringen.
 In Jerusalem ist ein Treffen mit dem israelischen Außenminister Israel Katz vorgesehen, bei dem es vor allem um die katastrophale humanitäre Lage in Gaza sowie die Bemühungen um die Freilassung der verbliebenen Geiseln gehen wird. Der Plan, den Präsident Biden auf der Grundlage israelischer Vorschläge vorstellte und der vom UN-Sicherheitsrat gebilligt wurde – und der von Partnern aus der arabischen Welt, aus Europa, Amerika, Asien und Afrika unterstützt wird – ist ein Weg hin zu einem dauerhaften Waffenstillstand. Deutschland fordert die Hamas dringend auf, diesen Plan zu akzeptieren.
In Jerusalem ist ein Treffen mit dem israelischen Außenminister Israel Katz vorgesehen, bei dem es vor allem um die katastrophale humanitäre Lage in Gaza sowie die Bemühungen um die Freilassung der verbliebenen Geiseln gehen wird. Der Plan, den Präsident Biden auf der Grundlage israelischer Vorschläge vorstellte und der vom UN-Sicherheitsrat gebilligt wurde – und der von Partnern aus der arabischen Welt, aus Europa, Amerika, Asien und Afrika unterstützt wird – ist ein Weg hin zu einem dauerhaften Waffenstillstand. Deutschland fordert die Hamas dringend auf, diesen Plan zu akzeptieren.
Noch immer hält die Hamas über 100 israelische Frauen, Männer und Kinder in ihren Tunneln in Geiselhaft – seit mehr als acht Monaten. Sie müssen endlich freikommen. Außenministerin Baerbock wird auf dieser Reise erneut mit Angehörigen der Entführten zusammentreffen.
Gefährliche Lage an der Grenze: Gespräche in Libanon
Am Dienstagnachmittag wird die Außenministerin in der libanesischen Hauptstadt Beirut unter anderem mit Ministerpräsident Nadschib Mikati sprechen. Es wird um die angespannte und gefährliche Lage an der Grenze zwischen Israel und Libanon gehen. Mit ihren Drohnen und Raketen destabilisiert die Hisbollah eine ganze Region. Zahlreiche Gebiete im Süden des Libanon, auch Landwirtschaftsflächen, sind verwüstet. Zehntausende Menschen wurden durch die Kampfhandlungen vertrieben. Sie können auf beiden Seiten der Grenze seit Oktober nicht in ihre Häuser zurück. Libanon befindet sich angesichts einer desaströsen wirtschaftlichen Lage und der anhaltenden politischen Blockade in einer tiefen Krise. Eine militärische Eskalation hätte katastrophale Folgen für das Land und die Region.
Um aus diesen Schwelbränden keinen Flächenbrand werden zu lassen, ist es unerlässlich, Gesprächskanäle offen zu halten und den Dialog zu suchen. Die UN-Resolution 1701 zeigt den Weg zu einer Lösung auf. Sie muss durch alle Seiten umgesetzt werden. Dazu gehört der Rückzug der Hisbollah aus dem Grenzgebiet, die Demarkierung der Grenze und eine umfassende Friedenslösung. Die Bundesregierung setzt sich vor allem auch durch unsere Beteiligung an der UN-Mission UNIFIL ein.
»Mein Schiff 7" in Kiel getauft: Pack das Methanol in den Tank – irgendwann
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Im Kieler Hafen feiert TUI Cruises die Taufe seines jüngsten Flottenzugangs. Die Reederei will die »Mein Schiff 7« klimaneutral mit Methanol betreiben – doch noch mangelt es an Treibstoff und Maschinenteilen...
Taufe der »Mein Schiff 7" in Kiel: Pack das Methanol in den Tank – irgendwann
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Im Kieler Hafen feiert TUI Cruises die Taufe seines jüngsten Flottenzugangs. Die Reederei will die »Mein Schiff 7« klimaneutral mit Methanol betreiben – doch noch mangelt es an Treibstoff und Maschinenteilen...
Griechenland: Touristen sterben bei Wanderausflügen in extremer Hitze
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
So heiß war es im Juni noch nie. Doch die Hitzewelle hält Touristen nicht davon ab, schlecht ausgerüstet wandern oder spazieren zu gehen. Diese Unvorsichtigkeit hat einige das Leben gekostet...
Demokratie macht stark – Außenpolitische Diskussionsreihe in Deutschland
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

 Weltweit stehen 63 Demokratien heute einer Mehrheit von 74 Autokratien gegenüber. So wenig Demokratie gab es seit 20 Jahren nicht mehr, das hat der Transformationsindex der Bertelsmann-Stiftung kürzlich herausgefunden. Auch in so machen europäischen Mitgliedsland sind Freiheiten teils unter Druck. Und auch unsere Gesellschaften sind durch Desinformation herausgefordert: Polarisierung und Spaltung nehmen zu.
Weltweit stehen 63 Demokratien heute einer Mehrheit von 74 Autokratien gegenüber. So wenig Demokratie gab es seit 20 Jahren nicht mehr, das hat der Transformationsindex der Bertelsmann-Stiftung kürzlich herausgefunden. Auch in so machen europäischen Mitgliedsland sind Freiheiten teils unter Druck. Und auch unsere Gesellschaften sind durch Desinformation herausgefordert: Polarisierung und Spaltung nehmen zu.
In Deutschland schwindet vor diesem Hintergrund bei manchen das Vertrauen in die Regierung und den Staat oder sogar in die Demokratie. Teile der Gesellschaft fühlen sich abgehängt, das belegen unter anderem Studien der Körber-Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung und der internationalen Initiative More in Common. Die Bundesregierung hat sich daher klar das Ziel gesetzt: Staat und Behörden müssen transparenter handeln, ihre Ziele verständlich erläutern, den Austausch suchen und sich der Diskussion stellen. Denn starke Demokratien leben von aktiven und informierten Bürgerinnen und Bürgern und einer Zivilgesellschaft, die sich einbringt. Dabei spielen außenpolitische Debatte eine wichtige Rolle.
Außenpolitische Diskussionsreihe in Deutschland
Wir wollen daher in den kommenden Monaten zu unterschiedlichen Themen in verschiedenen Städten Deutschlands mit den Menschen darüber sprechen, was sie mit Blick auf Außenpolitik und die Lage in der Welt umtreibt, welche Handlungsmöglichkeiten Deutschland in der Welt hat, wer daran mitwirkt und wie wir es umsetzen. Wir wollen Fragen diskutieren, wie: Was hat es mit Sicherheit, Wohlstand und Freiheit zu tun, wenn eine Außenministerin nach Fidschi reist oder warum engagiert sich Deutschland in der NATO? Wofür brauchen wir ein wachsendes Regelwerk an internationalen Verträgen? Engt uns das ein oder eröffnet es im Gegenteil Spielräume?
Dabei wollen wir uns vier Aspekte der Außenpolitik genauer ansehen, die dazu beitragen, unsere Demokratie stärker zu machen.
- Zivilgesellschaftlicher Dialog: Zivilgesellschaft und Medien haben großen Anteil, daran, dass Demokratien gut funktionieren, gerade weil es ihre Aufgabe ist, Politik und Staat auf die Finger zu schauen. Unsere Zivilgesellschaft, aber auch unsere Medien, werden dadurch stärker und besser, dass sie sich weltweit mit anderen vernetzen. Gleichzeitig haben wir großes Interesse daran, andere Demokratien zu stärken und uns nicht nur mit anderen Regierungen, sondern auch gezielt mit anderen Gesellschaften auszutauschen.
- Internationale Beziehungen und regelbasierte Ordnung: Dabei wollen wir genauer darauf eingehen, wie wir – gemeinsam mit unseren Partnern weltweit – Allianzen bilden, um dem Wirken autokratischer Regime entgegenzutreten. Und wie wir zusammen mit anderen weiter an einer internationalen Ordnung arbeiten, deren Regeln für alle gelten.
- Unsere Klimaaußenpolitik, konkret: unser Einsatz gegen die Folgen der Klimakrise und für erneuerbare Energien. Dabei geht es zum einen um die Sicherung unserer Lebensgrundlagen, aber auch darum, wie wir bei der Versorgung von Energie und Rohstoffen Abhängigkeiten vermeiden. Und warum Klimapolitik etwas mit verlässlichen Bündnissen in der Welt und Vertrauen in die Stimme Deutschlands zu tun hat.
- Unser Kampf gegen Desinformation, der durch neue Technologien wie KI nicht einfacher geworden ist. Dabei wollen wir auch diskutieren, wie wir unsere Informationsnetze am besten schützen und gezielte Falschinformationen bekämpfen können. Dafür braucht es Außenpolitik, denn gerade Technologien wie KI machen nicht vor nationalen Grenzen Halt.
Geplante Veranstaltungen
1. Zivilgesellschaftlicher Dialog
- Bonn, 17. Juni 2024 – Außenministerin Annalena Baerbock beim Global Media Forum der Deutschen Welle mit Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa und ugandischen Journalistin Culton Scovia über Pressefreiheit, soziale Medien und wie wir uns besser gegen gezielte Angriffe und Hass im Netz schützen.
- Hannover, 17. Juni 2024 – Katja Keul, Staatsministerin im Auswärtigen Amt: Nur wer seine Vergangenheit kennt, kann Lehren für die Gegenwart und die Zukunft ziehen: „Das leere Grab“ - Filmvorführung und Gespräch über die Aufarbeitung deutscher Kolonialverbrechen
- Hadamar, 9. Juli 2024 – Anna Lührmann, Staatsministerin im Auswärtigen Amt: Theateraufführung des Vereins „Weilburg erinnert e.V.“ in der Gedenkstätte Hadamar. Der internationale Ort des Gedenkens und der politischen Bildung erinnert an die Verfolgten der nationalsozialistischen „Euthanasie“.
- Nienburg, August 2024 – Katja Keul, Staatsministerin im Auswärtigen Amt: Bürgerdialog: Fragen und Antworten an Staatsministerin Keul zu aktuellen außenpolitischen Themen
- Nürnberg, 20. Oktober 2024 – Anna Lührmann, Staatsministerin im Auswärtigen Amt: Öffentliche Veranstaltung zu 70 Jahre Städtepartnerschaft Nürnberg und Nizza, Gespräche mit Jugendlichen, Bürgerinnen und Vertreterinnen und Vertretern von zivilgesellschaftlichen Organisationen zu Europa und Demokratie
- Heilbronn, Oktober 2024 – Michael Link, Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit: Gemeinsam stark: Zusammenarbeit in Wissenschaft und Bildung für starke Demokratien und starke Märkte – Welche transatlantischen Angebote brauchen wir?
- Stuttgart, Oktober 2024 – Michael Link, Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit: Polarisierung überwinden und gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt stärken – welche transatlantischen Lehren ziehen wir für Medien, Kunst und Kultur?
- Liberec, 22./23. November 2024 – Anna Lührmann, Staatsministerin im Auswärtigen Amt: Deutsch-Tschechisches Regionalforum zur gemeinsamen Lösungsfindung für Probleme im deutsch-tschechischen Grenzraum
- Kiel, November 2024 – Luise Amtsberg, Beauftrage der Bundesregierung für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe im Gespräch mit den Partnerstädten von Kiel: Welchen Stellenwert haben die universellen Menschenrechte in unseren Gesellschaften noch?
2. Veranstaltungen zu internationalen Beziehungen und regelbasierter Ordnung
- Juli 2024 – Tobias Lindner, Staatsminister im Auswärtigen Amt: Deutschland braucht Fachkräfte – wie kommen wir voran?
- September 2024 – Tobias Lindner, Staatsminister im Auswärtigen Amt: Ukraine – was leistet Deutschland und wie geht es den Ukrainerinnen und Ukrainern heute in Deutschland?
- Saarland, 21. Oktober 2024 – Anna Lührmann, Staatsministerin im Auswärtigen Amt: Öffentliche Veranstaltung zum Thema Demokratie anlässlich des Deutsch-Französischen Ausschusses für Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
- Hamburg, November 2024 – Manuel Sarrazin, Sondergesandter für die Länder des westlichen Balkans: Deutsche und europäische Geschichtspolitik mit Bezug zum westlichen Balkan
3. Veranstaltungen zu Klimaaußenpolitik
- Mehr Informationen zu Veranstaltungen werden in Kürze veröffentlicht.
4. Veranstaltungen zum Kampf gegen Desinformation
- Herbst 2024 – Robin Wagener, Koordinator der Bundesregierung für die zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit mit dem Südkaukasus, der Republik Moldau und Zentralasien: Diskussion zu russischer Einflussnahme und Desinformation
Wie kann ich teilnehmen?
Die Teilnahme wird in Absprache mit lokalen Partnern organisiert. Weitere Informationen ergänzen wir hier in Kürze.
Wer sind die Referentinnen und Referenten?
Zu den Referentinnen und Referenten zählen neben Außenministerin Baerbock die Staatsministerinnen Katja Keul und Anna Lührmann, Staatsminister Tobias Lindner, die Staatssekretärin Jennifer Morgan. Außerdem die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe Luise Amtsberg, der Sondergesandte der Bundesregierung für die Länder des westlichen Balkans Manuel Sarrazin, der Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit Michael Link, der Koordinator für die deutsch-polnische Zusammenarbeit Dietmar Nietan und der Koordinator für die zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit mit dem südlichen Kaukasus, der Republik Moldau sowie Zentralasien Robin Wagener.
Feuerwurm-Gefahr in Italien: So gefährlich ist das kleine Meerestier
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Sollten Sie im Sommer nach Italien reisen, könnten Sie Feuerwürmern begegnen. Ein Kontakt kann schmerzhaft sein. Aber auch gesundheitsgefährdend? Die wichtigsten Fragen und Antworten...
Solange wie nötig: Deutschlands Unterstützung für die Ukraine
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat unfassbares Leid über Millionen Menschen gebracht. Unmittelbar betroffen sind nicht nur die ukrainischen Soldaten und Soldatinnen, die an der Front ihr Heimatland verteidigen, sondern auch die Zivilbevölkerung, darunter ältere Menschen, Frauen und Kinder. Besonders zu schaffen machen die gezielten Angriffe der russischen Streitkräfte auf zivile Infrastruktur wie Kraftwerke zur Erzeugung von Wärme und Strom. Russland versucht den Menschen in der Ukraine damit die Grundlage zum Überleben zu rauben. Für die Bundesregierung hat konkrete Hilfe für die Versorgung der Ukrainerinnen und Ukrainer daher höchste Priorität.
Seit Kriegsbeginn hat die Bundesregierung mehr als 33,9 Mrd. Euro für bilaterale Unterstützungsleistungen für die Ukraine zur Verfügung gestellt, z.B. für ein umfangreiches Winterhilfsprogramm, Unterstützung für Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, zur Aufarbeitung von Kriegsverbrechen, für humanitäre Hilfe und Minenräumen.
Eine regelmäßig aktualisierte Übersicht der bilateralen Unterstützungsleistungen finden Sie hier.
Militärische Unterstützungsleistungen für die Ukraine
Die Ukraine muss sich gegen den russischen Angriffskrieg verteidigen können. Deutschland unterstützt die Ukraine daher mit Ausrüstungs- und Waffenlieferungen, aus Beständen der Bundeswehr und durch Lieferungen der Industrie, die aus deutschen Haushaltsmitteln finanziert werden. Dabei orientiert sich die Bundesregierung an dem Bedarf der Ukraine und prüft ständig, in welchen Bereichen, beispielsweise in der Flugabwehr, weitere Unterstützungsleistungen möglich sind.
Deutschland ist zudem größter Einzahler in den Refinanzierungsfonds der Europäischen Friedensfazilität (EPF), der mit bislang europaweit 7,1 Mrd. Euro Unterstützungsmaßnahmen von 2022 bis 2026 zur Lieferung militärischer Ausrüstungsgegenstände durch EU-Mitgliedstaaten an die ukrainischen Streitkräfte ermöglicht.
Die aktuelle Übersicht der militärischen Unterstützungsleistungen finden Sie hier.
Präzedenzlose Sanktionen
Solange Russland die Ukraine brutal angreift, muss dies Konsequenzen haben. Deutschland und seine europäischen Partner haben mit massiven und präzedenzlosen Sanktionen reagiert: Abschneiden Russlands von Kapitalmärkten, umfassende Ausfuhrverbote, insbesondere in den Bereichen Hochtechnologie, Industrie und Energie, eine Ölpreisobergrenze für Lieferungen in Drittstaaten, weitreichende Importverbote, u.a. für Kohle, Erdöl, Eisen- und Stahlprodukte sowie Gold und Diamanten aus Russland, harte Maßnahmen gegen den russischen Luftfahrtsektor sowie gezielte Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Putin, Außenminister Lawrow, weitere politische und militärische Entscheidungsträger, Kriegsverbrecher, Propagandisten und das Oligarchen-System, das sie stützt.
Mehr über die bestehenden Sanktionen erfahren Sie hier.
Dokumentation von Kriegsverbrechen
Mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine begeht Russland in der Ukraine auch schwere Verletzungen des humanitären Völkerrechts und massive Menschenrechtsverletzungen, wie Tötung und Folter von Zivilistinnen und Zivilisten. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) hat umgehend Ermittlungen aufgenommen. Deutschland unterstützt diese Ermittlungen finanziell sowie durch Entsendung von Expertinnen und Experten. Mit ukrainischen Stellen arbeitet die Bundesregierung zudem beispielsweise bei Lieferung von Forensik-Ausrüstung zusammen.
Wiederaufbau
Angesichts der Milliardenschäden, die durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine entstanden sind, ist es wichtig, frühzeitig für die Zukunft vorzusorgen. Deswegen plant die Bundesregierung gemeinsam mit der Ukraine sowie unseren Partnern in EU und G7 schon jetzt den Wiederaufbau der Ukraine. Im Dezember 2022 einigten sich die G7-Staaten gemeinsam mit der Ukraine auf die Einrichtung einer internationalen Plattform für die Geberkoordinierung des Wiederaufbaus. Der Wiederaufbau wird eine besondere internationale Kraftanstrengung erfordern, bildet aber gleichzeitig auch eine große Chance, Investitionen in die Zukunft der Ukraine mit der Modernisierung von Staat und Wirtschaft, einer ökologischen Transformation, und nicht zuletzt innerstaatlichen Reformen und dem EU-Beitrittsprozess zu verknüpfen. Auch richtete Deutschland gemeinsam mit der Ukraine die internationale Wiederaufbau-Konferenz „URC24“ am 11.-12.06.2024 in Berlin aus.
Das Auswärtige Amt unterstützt als zweitgrößter Geber humanitäre Partnerorganisationen in der Ukraine und Nachbarländern zur Minderung der hohen humanitären Bedarfe.
Mehr über den Wiederaufbau erfahren Sie hier.
Große Hilfsbereitschaft
Viele Menschen in Deutschland nehmen Anteil an der Situation der Menschen in der Ukraine - auch in der Zivilgesellschaft ist die Hilfsbereitschaft enorm. Das große Spendenaufkommen führt zu einem großen Koordinierungsbedarf für die Hilfsorganisationen. Die Bundesregierung unterstützt deshalb den Appell, statt Sachspenden, wenn immer möglich Geld an etablierte Hilfsorganisationen zu spenden. Spenden sind über die Aktion Deutschland Hilft oder das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe möglich. Mit dem Betreff „Nothilfe Ukraine“ kommen die Gelder den Menschen in der Ukraine zugute.
Informationen über den Bedarf von Geflüchteten vor Ort und zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen in Deutschland finden Sie hier: hier.
Sturmerprobte Partner im Norden und Osten: Außenministerin Baerbock reist zum Ostseerat bei Helsinki
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Die Ostsee ist seit jeher als Lebensader ihrer Anrainer von großer strategischer Bedeutung – zum Austausch, für den Fischfang, aber auch als Zugang zum Atlantik und damit den Handelswegen und Warenströmen der Welt. Zugleich spiegeln sich in ihren blauen Wassern auch immer die Konflikte ihrer Zeit. Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich die Sicherheitslage im Ostseeraum in den vergangenen Jahren fundamental verändert. Aus den ehemals bündnisfreien Staaten Finnland und Schweden sind NATO-Mitglieder geworden. Und mit der Luftraumüberwachung (dem sogenannten Air-Policing) im Baltikum und der Stationierung einer Brigade der Bundeswehr in Litauen übernimmt Deutschland ganz konkrete Verantwortung für die Sicherheit im Ostseeraum.
Umfassende Sicherheit im Ostseeraum
Dieser Wandel spiegelt sich auch im Ostseerat wieder – 1992 auf deutsch-dänische Initiative zur Überwindung der politischen Spaltung in der Region gegründet, wurde er während der deutschen Ostseeratspräsidentschaft 2022/23 neu ausgerichtet: als enger Verbund von Wertepartnern, bei dem umfassende Sicherheit im Ostseeraum im Zentrum steht.
Daran schließt die aktuelle finnische Präsidentschaft an: In Porvoo (ca. 50 km von Helsinki entfernt) geht es zum einen um die gemeinsame Unterstützung der Ukraine. Die Außenministerinnen und Außenminister werden in ihren Beratungen an die gestern und vorgestern in Berlin stattgefundene Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine anknüpfen und noch einmal deutlich machen: Die Ostseeanrainer stehen an der Seite der Ukraine und werden sie weiter mit aller Kraft unterstützen.
Darüber hinaus werden die hybriden Bedrohungen Russlands im Ostseeraum im Zentrum der Beratungen stehen. Russland versucht, die Gesellschaften in der Region durch Einsatz verschiedenster hybrider Mittel wie Desinformation, aber zum Beispiel auch gezielte Instrumentalisierung des Leids von Migrantinnen und Migranten an der Grenze zu Belarus oder Störung des Luftverkehrs durch Blockieren von GPS-Signalen zu destabilisieren. Dem stellen sich die Staaten des Ostseerats entschlossen entgegen. Dabei spielt auch die Frage, wie Krisenvorsorge und Krisenreaktionsfähigkeiten gestärkt und kritische Infrastruktur geschützt werden können, eine zentrale Rolle.
Mit dem Treffen in Porvoo endet die finnische Ostseeratspräsidentschaft – ab 1.7. übernimmt Estland den Staffelstab.
Deutschland und Irland wollen Zusammenarbeit zu erneuerbaren Energien und Klimadiplomatie stärken
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Irland und Deutschland sind enge Partner in Europa und der Welt. Unsere freundschaftlichen bilateralen Beziehungen spiegeln sich nicht nur im vielfältigen Kulturaustausch, unseren gemeinsamen Werten, sondern auch in erheblichen wirtschaftlichen Kooperationen wider. Deutschland ist der drittgrößte Handelspartner für Irland (der größte innerhalb der EU) und Irland wiederum wichtiger Standort für über 300 dort ansässige deutsche Unternehmen.
Um unsere gute Zusammenarbeit weiterzuentwickeln, reist Staatssekretär Bagger am 13.06. nach Dublin. Gemeinsam mit seinem irischen Amtskollegen Joe Hackett wird er die dritte Auflage des deutsch-irischen Aktionsplans beschließen. Seit der Annahme des gemeinsamen Aktionsplans 2018 und einer ersten Aktualisierung 2021 hat sich die bilaterale Kooperation zwischen Irland und Deutschland erheblich weiterentwickelt und intensiviert, viele Projekte wurden erfolgreich abgeschlossen.
Der Aktionsplan zur Stärkung der deutsch-irischen Beziehungen wurde im April 2018 durch den damaligen deutschen Außenminister Heiko Maas und den damaligen irischen Außenminister Simon Coveney vereinbart und am 15.11.2018 in Berlin verabschiedet. Das Ziel des gemeinsamen Aktionsplans ist die Intensivierung der bilateralen Beziehung sowie die Zusammenarbeit beider Länder innerhalb der EU sowie in der Außenpolitik.
Das ganze Spektrum der deutsch-irischen Beziehungen
Die Neuauflage des Aktionsplans deckt ein breites Spektrum der bilateralen Zusammenarbeit ab - von Außen- und Sicherheitspolitik, über Finanzen, Wirtschaft, Energie, Landwirtschaft und Forschung bis hin zu zivilgesellschaftlichem Austausch und der Förderung der deutschen Sprache in Irland. Mit sieben beteiligten deutschen Ressorts ist das Interesse an der Zusammenarbeit mit Irland in der Bundesregierung sehr hoch.
Insbesondere beim Thema erneuerbare Energien wollen wir mit Irland in Zukunft verstärkt zusammenarbeiten. So gibt es beim Ausbau von Offshore-Windkraft und der Produktion von Grünem Wasserstoff in Irland enormes Potential. Deshalb bauen wir zum Beispiel die Forschungskooperation zu Grünem Wasserstoff zwischen Deutschland und Irland aus. Und auch in der Klimaaußenpolitik wollen Irland und Deutschland in Zukunft noch enger zusammenarbeiten, etwa durch den Ausbau der Freundesgruppe für ambitionierte EU-Klimadiplomatie im Bereich der Klimasicherheit.
Die dritte Fassung des Aktionsplans zur Stärkung der deutsch-irischen Beziehungen stellt die Weichen für eine effektive und enge deutsch-irische Kooperation in den kommenden Jahren auf verschiedenen Ebenen.
Fußball-EM 2024 in Deutschland: Die besten Public-Viewing-Orte von München bis Berlin
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Ein Sommer des Fußballs! Aber wo sind die besten Orte für Public Viewing? Wohin pilgern Fußballfans? Die besten Feiertipps von München bis Berlin in der Übersicht...
„United in Defence. United in Recovery. Stronger together“ – Gemeinsam für den Wiederaufbau der Ukraine
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Russland führt seit mehr als zwei Jahren einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine, was zu großem Leid und verheerender Zerstörung der zivilen Infrastruktur führt. Mit Bomben und Drohnen legt Russland Kraftwerke, Baumärkte, Wohnhäuser, Schulen, und Krankenhäuser in Schutt und Asche. Deutschland und viele andere Länder weltweit stehen beim Wiederaufbau des Landes fest an der Seite der Ukraine.
Dazu sagte Außenministerin Baerbock:
Jeden Tag verteidigen ukrainische Männer und Frauen ihr Land gegen brutale russische Angriffe, die sich gezielt gegen die Lebensadern des Landes richten. Ob in den Schützengräben und Kasernen, im Parlament, am Arbeitsplatz oder im Fußballverein: der Mut und die Widerstandskraft der Ukrainerinnen und Ukrainer sind beeindruckend. Stein für Stein bauen sie ihr Land trotz des permanenten russischen Raketenbeschusses wieder auf. Die Ukraine verteidigt mit großer Entschlossenheit auch unsere freiheitliche europäische Lebensweise. Wir unterstützen die Ukraine dabei umfassend: wirtschaftlich, humanitär, politisch und mit der Lieferung von dringend benötigten Waffen.
Vernetzung von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft im Mittelpunkt
 Durch die Vernetzung der mehr als 2000 Teilnehmenden aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Kommunen sollen langfristige Vereinbarungen und internationale Initiativen in Bereichen wie der Unternehmensförderung und Fachkräfteausbildung entstehen. Die Konferenz bildet zum Beispiel den Startschuss für eine neue Fachkräfte-Allianz, die „Skills Alliance for Ukraine“, einer internationalen Aktionsplattform für „Green Recovery“ of Ukraine oder eine Allianz für kleine und mittlere Unternehmen. Viele weitere Kooperationsvereinbarungen sollen unterzeichnet werden.
Durch die Vernetzung der mehr als 2000 Teilnehmenden aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Kommunen sollen langfristige Vereinbarungen und internationale Initiativen in Bereichen wie der Unternehmensförderung und Fachkräfteausbildung entstehen. Die Konferenz bildet zum Beispiel den Startschuss für eine neue Fachkräfte-Allianz, die „Skills Alliance for Ukraine“, einer internationalen Aktionsplattform für „Green Recovery“ of Ukraine oder eine Allianz für kleine und mittlere Unternehmen. Viele weitere Kooperationsvereinbarungen sollen unterzeichnet werden.
Eine besonders wichtige Rolle beim Wiederaufbau spielt der Privatsektor. Über 600 ukrainische, deutsche und internationale Unternehmensvertreterinnen und Vertreter aus Sektoren wie Energie, Gesundheit, Logistik und Rüstung sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Kommunen und Zivilgesellschaft werden ihre Arbeit während der Veranstaltung auf dem „Recovery Forum“ präsentieren. Erstmals stehen auch der soziale und gesellschaftliche Wiederaufbau – also Themen wie Ausbildung, Gesundheit und Teilhabe – sowie der Wiederaufbau von Gemeinden und Regionen im Fokus einer Ukraine-Wiederaufbaukonferenz.
Zukunft der Ukraine in der EU
Damit der EU-Beitritt der Ukraine bald gelingt, liegt ein weiterer Schwerpunkt auf den damit verbundenen notwendigen Reformen in der Ukraine. In rund 30 Panels diskutieren die Teilnehmenden diese vielfältigen Themen unter dem Motto „United in Defence. United in Recovery. Stronger together“.
Dazu unterstrich die Außenministerin:
„Wir setzen alle Hebel in Bewegung, damit die Ukraine schon bald mit uns am Tisch unserer Europäischen Union sitzt. Denn neben unserer militärischen Unterstützung ist das der beste Schutz. Mit der Wiederaufbaukonferenz wollen wir der Ukraine gemeinsam mit vielen Partnern aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Kommunen auf ihrem Weg der Reform und des Wiederaufbaus mit aller Kraft unter die Arme greifen. Unsere gemeinsame Botschaft ist klar: Wir stehen fest zusammen und unterstützen die Ukraine mit aller Kraft - so lange sie uns braucht. Für eine Ukraine in Frieden und Freiheit, innerhalb unserer Europäischen Union.“
Die Berliner Wiederaufbau-Konferenz ist die dritte Wiederaufbau-Konferenz seit Beginn des vollumfänglichen russischen Angriffs auf die Ukraine 2022. Im Juli 2022 einigten sich die Teilnehmenden in Lugano auf die Grundprinzipien für den Wiederaufbau. Diese legen fest, dass der Wiederaufbau reformorientiert, transparent, demokratisch und nachhaltig gestaltet werden soll. Auf der Ukraine Recovery Conference in London 2023 lag der Fokus auf der Mobilisierung der Privatwirtschaft. 2025 wird Italien die Konferenz gemeinsam mit der Ukraine ausrichten.
Unter den mehr als 2.000 Teilnehmenden sind ungefähr zu je ein Drittel Regierungen und internationale Organisationen, die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft sowie Kommunen und Regionen vertreten. Die Ukraine und Deutschland richten die Konferenz gemeinsam aus. Gastgeber sind Bundeskanzler Scholz und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung haben die Konferenz gemeinsam vorbereitet.
Das Programm der Konferenz und der Live-Stream zur Konferenz gibt es hier: www.urc-international.com.
Fussballbotschafter auf Tour
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Um Lust auf dieses “Heimspiel für Europa” zu machen und in den Teilnehmerländern für unsere europäische Fußballbegeisterung und einen modernen Blick auf Deutschland zu werben, hat das Auswärtige Amt in den vergangenen Monaten Fußball-Botschafter nach ganz Europa entsandt. Von Lissabon bis Belgrad, von Edinburgh nach Istanbul führt die Reiseroute. Mit dabei: Steffi Jones, Arne Friedrich, Thomas Hitzlsperger, Gerald Asamoah, Bibiana Steinhaus-Webb und Jimmy Hartwig. Ihre Botschaft ist so einfach wie eindrücklich: "Beim Fußball ist jeder willkommmen!". Ihr Programm: so bunt und vielfältig wie die Turnierteilnehmer selbst: Vom Straßenfußballprojekt in Portugal über ein Turnier mit der Amputiertennationalmannschaft der Ukraine bis zum Torwandschießen in Paris und Tirana. Die Fußballbotschafter werben dabei nicht nur für das Gastgeberland Deutschland und die Schwerpunktthemen Vielfalt und Inklusion, Solidarität, Good Governance, Umwelt, Gesundheit und Wohlbefinden, sondern sie tragen auch die Begeisterung für Sport und das Fussballfieber aus den Teilnehmerländern zurück nach Deutschland.
Der Startschuss für die Europameisterschaft fällt am 14. Juni 2024 in München und das Finale findet genau einen Monat später, am 14. Juli, im Berliner Olympiastadion statt. Auch einige der Amtskolleginnen und -kollegen von Außenministerin Baerbock werden zu Spielen zu Gast sein...
Fußballbotschafter auf Tour
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Um Lust auf dieses “Heimspiel für Europa” zu machen und in den Teilnehmerländern für unsere europäische Fußballbegeisterung und einen modernen Blick auf Deutschland zu werben, hat das Auswärtige Amt in den vergangenen Monaten Fußball-Botschafter nach ganz Europa entsandt. Von Lissabon bis Belgrad, von Edinburgh nach Istanbul führt die Reiseroute. Mit dabei: Steffi Jones, Arne Friedrich, Thomas Hitzlsperger, Gerald Asamoah, Bibiana Steinhaus-Webb und Jimmy Hartwig. Ihre Botschaft ist so einfach wie eindrücklich: "Beim Fußball ist jeder willkommen!". Ihr Programm: so bunt und vielfältig wie die Turnierteilnehmer selbst: Vom Straßenfußballprojekt in Portugal über ein Turnier mit der Amputiertennationalmannschaft der Ukraine bis zum Torwandschießen in Paris und Tirana. Die Fußballbotschafter werben dabei nicht nur für das Gastgeberland Deutschland und die Schwerpunktthemen Vielfalt und Inklusion, Solidarität, Good Governance, Umwelt, Gesundheit und Wohlbefinden, sondern sie tragen auch die Begeisterung für Sport und das Fußballfieber aus den Teilnehmerländern zurück nach Deutschland.
Der Startschuss für die Europameisterschaft fällt am 14. Juni 2024 in München und das Finale findet genau einen Monat später, am 14. Juli, im Berliner Olympiastadion statt. Auch einige der Amtskolleginnen und -kollegen von Außenministerin Baerbock werden zu Spielen zu Gast sein...
Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Dazu hat das Auswärtige Amt die Arbeiten eines internationalen Forschungsteams unterstützt. Gemeinsam haben sie die Rolle des Auswärtigen Amts betrachtet, dessen damalige Kolonialabteilung in den Jahren 1890 bis 1907 unmittelbar zuständig für die deutsche Kolonialherrschaft in Afrika, Asien und Ozeanien war. Aus ihr ging 1907 das Reichskolonialamt hervor. Die Untersuchung der deutschen Kolonialpolitik sowie die Folgen für die Außenpolitik der anschließenden Jahrzehnte ist nun im Sammelband „Das Auswärtige Amt und die Kolonien. Geschichte, Erinnerung, Erbe.“ veröffentlicht worden.
Die Forschenden stellen klar: Das Auswärtige Amt trägt als Institution eine Mitverantwortung für Gewalt und Verbrechen in den deutschen Kolonien.
Wir können unsere Vergangenheit nicht ändern. Aber wir können unsere Geschichte im Lichte unserer heutigen Kenntnisse reflektieren – und gemeinsam mit unseren Partnern Lehren für die Gegenwart und für unsere Zukunft ziehen.
- Außenministerin Annalena Baerbock bei der Vorstellung des Sammelbandes „Das Auswärtige Amt und die Kolonien. Geschichte, Erinnerung, Erbe.“ am 06. Juni 2024
Aufarbeitung im Dialog
 Zur Überwindung kolonialer Kontinuitäten ist es wichtig, miteinander zu sprechen und einander zuzuhören, auch, um nicht-eurozentrische Perspektiven zu gewinnen. Dieser Dialog muss in jedem Kontext neu bestimmt werden und braucht unterschiedlich viel Raum und Zeit, denn auch die kolonialen Erfahrungen sind in den verschiedenen Gesellschaften und Bevölkerungsgruppen unterschiedlich.
Zur Überwindung kolonialer Kontinuitäten ist es wichtig, miteinander zu sprechen und einander zuzuhören, auch, um nicht-eurozentrische Perspektiven zu gewinnen. Dieser Dialog muss in jedem Kontext neu bestimmt werden und braucht unterschiedlich viel Raum und Zeit, denn auch die kolonialen Erfahrungen sind in den verschiedenen Gesellschaften und Bevölkerungsgruppen unterschiedlich.
Der Dialog mit Ländern, die von deutschem kolonialem Handeln betroffen waren, befindet sich in vielen Fällen erst am Anfang. Diese Prozesse können nur gemeinsam gestaltet werden. Sie umfassen sowohl betroffene Zivilgesellschaften als auch Vertreter*innen aus Diaspora und Wissenschaft sowie staatliche Partner*innen.
Zu einem ehrlichen und offenen Umgang mit der Vergangenheit gehört, begangenes Unrecht zu benennen und anzuerkennen: Während seiner Reise nach Tansania im November 2023 hat Bundespräsident Steinmeier um Verzeihung für deutsche Kolonialverbrechen im ehemaligen „Deutsch-Ostafrika“ gebeten. Staatsministerin Katja Keul hat diese Bitte um Verzeihung auf ihrer Reise nach Tansania im März 2024 anlässlich einer Gedenkveranstaltung in Moschi bekräftigt. Sie hat zudem im November 2022 bei einer Rede in Douala die Hinrichtungen von König Rudolf Douala Manga Bell und Adolf Ngoso Din in der damaligen deutschen Kolonie „Kamerun“ als koloniales Unrecht benannt. Die im Jahr 2021 paraphierte Gemeinsame Erklärung ist ein wichtiges Element auf dem Weg zur Aussöhnung mit Namibia nach den im damaligen „Deutsch-Südwestafrika“ begangenen Gräueltaten, die in dem Völkermord an den Herero und Nama mündeten. Bundespräsident Steinmeier hat bei seiner Rede anlässlich des Staatsbegräbnisses für den ehemaligen namibischen Staatspräsidenten Hage Geingob im Februar 2024 deutlich gemacht, dass Deutschland der historischen Aufarbeitung dieser Verbrechen verpflichtet bleibt.
Zahlreiche Akteure auf Bundes-, Länder- und Kommunalebene engagieren sich in der Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit.
In folgenden Bereichen ist das Auswärtige Amt aktiv:
- Das Auswärtige Amt unterstützt Rückgaben von menschlichen Überresten und Kulturgütern aus kolonialem Kontext. Prominentes Beispiel ist die Rückgabe der Benin Bronzen an Nigeria. Die Rückgaben selbst erfolgen zumeist durch Länder und Kommunen als Träger der Sammlungen. Die Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten dient als erste Anlaufstelle für alle Fragen zu Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland.
- Das Auswärtige Amt und die Auslandsvertretungen in ehemaligen Kolonialgebieten stellen Informationen über Geschichte und Erbe der Kolonialzeit bereit, fördern Ausstellungen und Kulturveranstaltungen und ermöglichen Austauschprogramme für Kulturschaffende oder zivilgesellschaftliche Initiativen für Aufklärung und gemeinsame Aufarbeitung. So fördern wir Zusammenarbeit und Austausch zwischen Menschen.
- Das Auswärtige Amt fördert unabhängige wissenschaftliche Forschung zur Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit. Einen wichtigen Beitrag zu einem Ausbau von Forschungspartnerschaften und einer kritischen Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit leistet dabei seit 2022 das vom Auswärtigen Amt finanzierte und vom DAAD koordinierte Forschungsstipendienprogramm German Colonial Rule - Scholarship Programme for Cooperative Research, in dem Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aus Burundi, Kamerun, Namibia, Ruanda, Tansania und von den Philippinen zur Rolle des Auswärtigen Amtes und anderer deutscher Behörden während der deutschen Kolonialzeit forschen. Das kooperative Stipendienprogramm fördert gezielt Perspektiven auf die Kolonialvergangenheit aus den Gesellschaften ehemaliger Kolonien.
- Auch über Projekte zum Kulturerhalt wird die Kolonialvergangenheit thematisiert und Menschen in den jeweiligen Ländern sowie der deutschen Öffentlichkeit zugänglich gemacht. ]
- Als Teil einer selbstkritischen Aufarbeitung der eigenen Rolle wird das Auswärtige Amt auch die Aus- und Fortbildung seiner Diplomatinnen und Diplomaten zum Thema koloniale Vergangenheit Deutschlands ausbauen.
Weiterführende Informationen
- Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien ist zuständig für die Förderung von Provenienzforschung und Digitalisierung von Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten sowie für die Schaffung eines Lern- und Erinnerungsortes.
- Rede von Außenministerin Baerbock anlässlich der Vorstellung des Buches „Das Auswärtige Amt und die Kolonien“
- Rede von Außenministerin Annalena Baerbock anlässlich der Übergabe der Benin-Bronzen
- Rede von Außenministerin Annalena Baerbock zu Klima und Sicherheit in Palau
- Rede von Staatsministerin Katja Keul anlässlich der Gedenkveranstaltung in Moschi, Tansania
- Rede von Staatsministerin Katja Keul zur Rehabilitierung von Rudolf Manga Bell in Kamerun
- Speech by Minister of State Katja Keul at the conference “New Perspectives on German Colonial Rule - A Scholarship Programme for Cooperative Research”
- Bundespräsident Steinmeier in Tansania
- Rede von Bundespräsident Steinmeier anlässlich des Staatsbegräbnisses für Präsident Hage G. Geingob am 24.02.2024
Endspurt zum NATO-Gipfel in Washington: Informelles Treffen der NATO-Außenministerinnen und Außenminister in Prag
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Tschechien ist nach Berlin und Oslo erst der dritte Gastgeber dieses neuen Formats mit informellem Charakter. Die Ministerinnen und Minister treffen sich hier in einem sehr kleinen, vertraulichen Rahmen. Anstelle eines vorstrukturierten Ablaufs ist ein offenerer, direkterer und interaktiverer Austausch geplant – ohne vorher festgelegtes Drehbuch. Das heißt ganz konkret: Die Ministerinnen und Minister sitzen alleine im Raum, ohne ihre Beraterinnen und Berater. Es werden keine vorbereiteten Statements verlesen, sondern miteinander diskutiert und gerungen, es geht um eine echte Debatte.
Schwerpunkt der Arbeitssitzung: Unterstützung der NATO für die Ukraine
Den inhaltlichen Schwerpunkt der Diskussionen der NATO-Außenministerinnen und Außenminister bildet die Vorbereitung des Gipfeltreffens in Washington Mitte Juli. Zudem wird es darum gehen, wie die Ukraine weiter in ihrer Verteidigung und ihrem Kampf für den Frieden gegen den seit mehr als 800 Tagen andauernden russischen Angriffskrieg unterstützt werden kann. Im letzten Jahr haben die Alliierten gemeinsam mit der Ukraine den NATO-Ukraine-Rat ins Leben gerufen und die Zusammenarbeit auf eine neue Ebene gehoben. Jetzt geht es darum, konkrete Schritte zu gehen, um die Rolle der NATO bei der Unterstützung der Ukraine und beim Aufbau einer widerstandsfähigen ukrainischen Armee weiter zu stärken.
Besonders wichtig ist, dass die Ukraine jetzt die so dringend benötigte Luftabwehr erhält. In diesem Zusammenhang ist auch die globale Initiative für mehr Luftverteidigung zu sehen, die Außenministerin Baerbock zusammen mit Verteidigungsminister Pistorius gestartet hat. Inzwischen ist fast eine Milliarde Euro zur zusätzlichen Unterstützung der ukrainischen Luftverteidigung zusammengekommen. Bei dem Treffen wird es auch darum gehen, bei den Allierten für rasche weitere Unterstützung der ukrainischen Luftabwehr zu werben.
Deutschland bei Verteidigungsausgaben vorne dabei
Die NATO ist das entscheidende Fundament für die euroatlantische Sicherheit. Gemeinsam mit unseren Partnern in der Nachbarschaft, wollen wir daher den europäischen Pfeiler der NATO stärken. In diesem Jahr erreicht Deutschland erstmals gemeinsam mit weiteren 19 Alliierten das 2%-Ziel der NATO.
Nahost, Georgien und die Lage in der Ukraine stehen im Fokus des Mai-Außenrats in Brüssel
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Wie können wir den humanitären Zugang nach Gaza verbessern? Wie kann der Druck auf die Hamas – gemeinsam mit den arabischen Partnern – erhöht werden, damit die israelischen Geiseln, die seit mehr als einem halben Jahr in den Fängen der Hamas ausharren, freikommen? Das sind nur zwei der Fragen, welche die Außenministerinnen und Außenminister zur Lage im Nahen Osten heute erneut beschäftigen wird. Dass sich diese Fragen seit Monaten ähneln, zeigt, wie schwierig die Situation vor Ort ist, aber auch wie dringend nötig Fortschritte sind. Ein großes Problem stellt die immer schlechtere Gesundheitsversorgung in Gaza dar, es droht unter anderem eine Verbreitung von Cholera und Hepatitis Infektionen.
Ein nachhaltiger Frieden in der Region hat nur im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung eine Chance, die auch in der Region mitgetragen werden muss. Die EU27 werden sich daher heute auch mit ihren Amtskollegen aus fünf arabischen Staaten (Saudi-Arabien, Jordanien, Vereinigte Arabische Emirate Ägypten & Katar) sowie der Arabischen Liga beraten.
An der Seite der Menschen in Georgien
Die Menschen in Georgien wollen in die EU – das bringen sie immer wieder auf beeindruckende Art und Weise zum Ausdruck. So wie in den vergangenen Tagen und Wochen mit ihren Protesten gegen die Pläne der Regierung, mit dem sogenannten "Transparenzgesetz" nach russischem Vorbild gegen die Zivilgesellschaft vorzugehen. Schon 2023 brachte der Druck der Straße die georgische Regierung dazu – vorübergehend wie sich nun herausstellt – von ihren Plänen Abstand zu nehmen.
Würde das Gesetz umgesetzt werden, hätte es erhebliche negative Auswirkungen für die Freiheit der Meinungsäußerung, der Unverletzlichkeit der Privatsphäre und würde Diskriminierungsverbote aushebeln. Laut der Venedig Kommission widerspricht das Gesetz der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) – die Außenministerinnen und Außenminister werden darüber beraten, was dies für die EU-Beitrittsperspektive Georgiens bedeutet und wie den Menschen vor Ort der Rücken gestärkt werden kann.
Nach dem Veto der Präsidentin steht die Regierung Georgiens an einem Scheideweg.
Lage in der Ukraine & russische Provokationen im Ostseeraum
Die Ukraine braucht dringend eine stärkere Luftverteidigung – dies wurde beim Besuch von Außenministerin Baerbock in Kyjiw letzte Woche noch einmal deutlich, denn Putin bombardiert ohne Unterlass die Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung. Er zielt damit direkt auf die Lebensadern der Gesellschaft. Deutschland ist mit einer neuen Beschaffungsinitiative vorangegangen. Die EU27 beraten heute über weitere Schritte, auch ein Austausch mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba ist geplant.
Daneben steht die Sicherheitslage im Ostseeraum auf der Agenda der Außenministerinnen und Außenminister. Mit der Entfernung von Bojen im russisch-estnischen Grenzfluss Narva zündelt Russland zum wiederholten Male an den Grenzen zur Europäischen Union. Diese Provokationen sind inakzeptabel. Außenministerin Baerbock hat hierzu bereits vergangenen Woche deutlich gemacht: wir stehen fest an der Seite unserer baltischen und finnischen Partner.
Der „Rat für Auswärtige Angelegenheiten" (RfAB) ist zuständig für das außenpolitische Handeln der EU, was die Bereiche der Außen‑, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, den Handel, die Entwicklungszusammenarbeit und die humanitäre Hilfe umfasst. Er hat vor allem die Aufgabe, gemeinsam mit der Europäischen Kommission und unter Einbindung des Hohen Vertreters der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, ein einheitliches und koordiniertes außenpolitisches Handeln der EU sicherzustellen. Der RfAB tagt in der Regel einmal im Monat.
75 Jahre Grundgesetz- Ein Fest für die Demokratie
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Seit dem 23. Mai 1949 regelt das Grundgesetz unser Zusammenleben. 75 Jahre Freiheit, Frieden und Demokratie in Deutschland – eine Erfolgsgeschichte. Aber sie ist keine Selbstverständlichkeit. Daher wollen wir gemeinsam das Grundgesetz feiern!
Die Feierlichkeiten beginnen bereits am 23. Mai 2024 mit einem Staatsakt in Berlin. Im Anschluss findet vom 24. bis zum 26. Mai 2024 ein Demokratiefest mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm statt, zu dem alle herzlich eingeladen sind.
Drei Tage, vier Bühnen und unzählige Highlights
Neben den Bundesländern, der UEFA Euro 2024 und vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen beteiligen sich der Bundespräsident, Bundestag und Bundesrat, der Bundeskanzler, das Bundesverfassungsgericht und die Bundesministerien und das Presse-und Informationsamt der Bundesregierung mit Ständen und Beiträgen..
Auch das Auswärtige Amt ist beim Demokratiefest vertreten: Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Pavillon direkt gegenüber des Dialogforums. Dort können Sie mit Mitarbeitenden ins Gespräch kommen und sich zur deutschen Außenpolitik informieren. Besonderes Highlight sind drei Dialogveranstaltungen:
- Am Sonntag, den 26.05.2024, laden wir Sie ein, mit Außenministerin Annalena Baerbock zum Thema „Stürmische Zeiten – wie Außenpolitik für die Sicherheit unserer Demokratie sorgt* zu diskutieren. Los geht’s um 14:30 Uhr im Tipi am Kanzleramt.
- Europa-Staatsministerin Anna Lührmann wird am Sonntag, den 26.05.2024, von 11:30 bis 12:30 Uhr auf der Aktionsfläche „Dialog und Diskurs“ im Spreebogenpark) zu europäischen Themen Rede und Antwort stehen.
- Und allen, die mehr zum Thema Feministische Außenpolitik erfahren möchten, empfehlen wir das Gesprächsformat „Warum feministische Außenpolitik allen in einer Gesellschaft dient“ am Samstag, den 25.05.2024, von 17:30 bis 18:30 Uhr auf der Aktionsfläche „Dialog und Diskurs“ im Spreebogenpark.
Bitte beachten Sie, dass die Plätze bei den Bürgerdialogen begrenzt sind und Einlasskontrollen stattfinden können. Alle Informationen zum Demokratiefest und den vollständigen Veranstaltungskalender finden Sie auf der Website der Bundesregierung:
Gemeinsam für Europa – Außenministerin Baerbock empfängt ihren französischen und polnischen Amtskollegen zum Weimarer Dreieck
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

„Wer nichts waget, der darf nichts hoffen“ – sagt der Wachmeister in einem Drama der Weimarer Klassik, und könnte damit fast genauso gut ein Motto der europäischen Gemeinschaft ausgerufen haben. Frankreich, Deutschland und Polen sind die Triebfedern im Herzen der EU. Außenministerin Baerbock empfängt daher heute ihre französischen und polnischen Amtskollegen Stéphane Séjourné und Radosław Sikorski zu einem Treffen des Weimarer Dreiecks. Weimar war vor fast 33 Jahren auch namensgebend für das trilaterale Dialogformat, in dem sich Frankreich, Deutschland und Polen seither regelmäßig abstimmen.
In Weimar stehen die aktuellen außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen auf der Agenda von Außenministerin Baerbock und ihren beiden Amtskollegen. Das Weimarer Dreieck steht geschlossen an der Seite der Ukraine. Auch um die Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Europa und die gemeinsame Unterstützung der Ukraine wird es in den Gesprächen gehen. Bei allem im Fokus: die Weiterentwicklung der EU und die Stärkung ihrer Handlungsfähigkeit.
Weimar – eine Stadt erzählt europäische Geschichte
Am 28. August 1991 trafen sich die damaligen Außenminister Frankreichs, Deutschlands und Polens erstmals in Weimar und hoben das Format aus der Taufe, das seitdem im dreigliedrigen Schulterschluss die Grundinteressen Europas stärkt.
Auch wenn Weimar keine Weltstadt ist, ist der Geburtsort des Weimarer Dreiecks keineswegs ein Zufall. Wenige Orte verkörpern so sehr die dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte - und gleichzeitig den Aufbruch auf unserem Kontinent. Von Weimar aus traten Ideen ihren Weg an, um Europa zu verändern. Bekanntermaßen waren hier nicht nur Johann Wolfgang Goethe und Friedrich Schiller am Werk. Weimar ist auch mit seiner Bauhaus-Universität ein Ort, an dem immer wieder neuen Formen der Gestaltung gefunden wurden. Und das auch politisch: 1919 traf sich hier die Nationalversammlung und erarbeitete Deutschlands erste demokratische Verfassung – die Geburtsstunde der Weimarer Republik.
12 Jahre später hielt Hitlers NSDAP nach ihrer Neugründung ihren ersten Parteitag in Weimar ab, vor der Haustür der Stadt ließen die Nationalsozialisten später eines der größten Konzentrationslager auf deutschem Boden errichten und ermordeten zehntausende Menschen. Das KZ Buchenwald bei Weimar wurde zum Synonym für die nationalsozialistischen Verbrechen. In der DDR wurde die Stadt zu einem wichtigen Standort sowjetischer Streitkräfte und seine Bürgerinnen und Bürger schließlich Teil der Friedlichen Revolution.
Gemeinsam stark für ein geeintes Europa
Heute steht Weimar auch für die französischen, deutschen und polnischen Impulse zur Überwindung von Gräben und zur Stärkung der Handlungsfähigkeit Europas. Dabei ist der Austausch im Weimarer Dreieck viel mehr als der so wichtige Draht zwischen Paris, Berlin und Warschau. Städtepartnerschaften, Jugendbegegnungen oder gemeinsame Kulturveranstaltungen verbinden die Menschen und lassen sie immer enger zusammenwachsen. Und das ist wichtig. Denn Europa ist so gefordert wie selten zuvor – und das Weimarer Dreieck über drei Jahrzehnte nach seiner Gründung wichtiger denn je.
Putin wollte die Ukraine in seinem imperialen Wahn an sich reißen, stattdessen hat er sie fest mit Europa zusammengeschweißt.“ – Außenministerin Baerbock ist erneut in die Ukraine gereist
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Seit mehr als 800 Tagen überzieht Putin die Ukraine mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Seit mehr als 800 Tagen stellen sich die Ukrainerinnen und Ukrainer den Angreifern mutig und entschlossen entgegen. Auch wenn kein Tag vergeht, an dem die Menschen nicht irgendwo im Land von Raketenalarmen aus dem Schlaf gerissen werden und Russland weitere Häuser, Schulen, Krankenhäuser oder die Energieversorgung bombardiert, lassen sie sich nicht entmutigen und bauen ihr Land unermüdlich wieder auf. Davon, wie beeindruckend dieser unbändige Wille ist, den Angreifern Stand zu halten und die zerstörte Infrastruktur direkt wieder aufzubauen, will sich die Außenministerin vor Ort selbst ein Bild machen.
Gleichzeitig kämpfen die Ukrainerinnen und Ukrainer mit Mut und Hoffnung für einen festen Platz ihres Landes als Teil Europas. Auch Außenministerin Baerbock ist überzeugt, dass der Platz der Ukraine in der Europäischen Union ist:
Putin wollte die Ukraine in seinem imperialen Wahn an sich reißen, stattdessen hat er sie fest mit Europa zusammengeschweißt. Nie war unser Schicksal als Europäer so eng mit dem der Ukraine verbunden. Die Ukraine verteidigt mit großer Entschlossenheit ihre Freiheit und kämpft damit auch für unser aller Freiheit. Der EU-Beitritt der Ukraine ist die notwendige geopolitische Konsequenz aus Russlands völkerrechtswidrigem Angriffskrieg. Die Ukraine hat beeindruckende Fortschritte gemacht und ist trotz der russischen Zerstörungswut auf Reformkurs. Es gilt jetzt, in den Anstrengungen nicht nachzulassen – bei der Justizreform, der Korruptionsbekämpfung und der Medienfreiheit.
Außenministerin Baerbock ist zu einem entscheidenden Zeitpunkt in die Ukraine gereist: Vor wenigen Tagen hat Putin eine erneute Offensive auf Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, gestartet. Ziel der Reise der Außenministerin ist es, ihren ukrainischen Gesprächspartnern auch in Anbetracht der sich zuspitzenden Lage in den Kampfgebieten zu versichern, dass Deutschland und Europa weiter fest an der Seite der Ukraine stehen und in ihrer Unterstützung nicht nachlassen werden.
In diesem Zusammenhang ist auch die globale Initiative für mehr Luftverteidigung zu sehen, die die Außenministerin vor Kurzem zusammen mit Verteidigungsminister Pistorius gestartet hat. Inzwischen ist fast eine Milliarde Euro zur zusätzlichen Unterstützung der ukrainischen Luftverteidigung zusammengekommen. Und die Arbeit geht weiter, damit die Ukrainerinnen und Ukrainer auch in Zukunft selbstbestimmt leben können. Gleichzeitig wird mit der Initiative auch die Sicherheit der EU- Staaten vor der Aggression Russlands geschützt.
Unsere Unterstützung ist verwurzelt in der tiefen Überzeugung, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen wird. Putin spekuliert darauf, dass uns irgendwann die Luft ausgeht, aber wir haben einen langen Atem. Deutschland steht gemeinsam mit vielen anderen Ländern aus allen Teilen der Welt felsenfest an der Seite der Ukraine. Darauf können die Menschen in der Ukraine dauerhaft bauen.
- Außenministerin Annalena Baerbock
Dieser lange Atem und die Überzeugung, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer in ihrem unermüdlichen Engagement für den Wiederaufbau ihres Landes unterstützt werden müssen, sind auch die Grundpfeiler für die Wiederaufbaukonferenz im Juni in Berlin. Bei der Konferenz wird neben globalen Partnern auch ein Bündnis aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Kommunen zusammenkommen. Die Reise der Außenministerin dient auch der Vorbereitung der Berliner Wiederaufbaukonferenz als Investition in die Zukunft der Ukraine.
75 Jahre Europarat - gemeinsam für Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

 Beim zweitägigen Besuch am Sitz des Europarats im elsässischen Straßburg wird Außenministerin Baerbock am Festakt sowie an der Arbeitssitzung des Ministerkomitees der 46 Mitgliedstaaten teilnehmen.
Beim zweitägigen Besuch am Sitz des Europarats im elsässischen Straßburg wird Außenministerin Baerbock am Festakt sowie an der Arbeitssitzung des Ministerkomitees der 46 Mitgliedstaaten teilnehmen.
46 Staaten, das sind seit dem Ausschluss Russlands infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine 700 Millionen Menschen, für die der Europarat Garant für Demokratie und Menschenrechte ist. Mit dem weltweit einzigartigen Instrument des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte garantiert der Europarat den 700 Millionen Bürgerinnen und Bürgern des Europarats, bei Verstößen gegen Menschenrechte ihren eigenen Staat zur Rechenschaft ziehen zu können. Damit spiegelt er die Grundüberzeugung des Europarats wider, dass jeder Mensch die gleichen Rechte hat.
'Die letzte Chance zur Rettung Europas' – so beschrieb der damalige französische Außenminister Robert Schuman vor 75 Jahren die Gründung des Europarats.
Seitdem steht der Europarat für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und das Recht jeder und jedes Einzelnen auf ein selbstbestimmtes Leben.
46 Mitgliedstaaten) tun das auf einem starken Fundament gemeinsamer Werte und Regeln.
Mit Institutionen wie dem Europarat, die uns dazu bringen, uns selbst als Demokratien immer wieder zu überprüfen.- Außenministerin Annalena Baerbock
75 Jahre nach seiner Gründung sind die Werte, für die der Europarat steht, lebendig wie kaum zuvor. Viele seiner über 200 Übereinkommen und Protokolle, zu denen die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte, die Istanbul Konvention gegen Gewalt an Frauen, die Anti-Folter-Konvention oder die Europäische Sozialcharta zählen, wirken über die Länder Europas hinaus. In Anbetracht des andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat der Europarat ein Schadensregister eingerichtet, in der Ukrainerinnen und Ukrainer die Schäden, die ihnen persönlich entstanden sind, dokumentieren können. Auch im Bereich der digitalen Sicherheit denkt der Europarat zukunftsgewandt und wird am Freitag eine Konvention zu Künstlicher Intelligenz verabschieden, die die Bürgerinnen und Bürger auch im digitalen Raum schützt.
Der Europarat in Zeiten multipler Bedrohungen
Die Tatsache, dass ein Mitgliedstaat des Europarats, die Ukraine, von einem anderen Mitgliedstaat, Russland, seit nun über zwei Jahren brutal angegriffen wird, erforderte nicht nur den Ausschluss Russlands, sondern auch eine starke Verteidigung unserer gemeinsamen Werte gegen die Bedrohungen, die der Europarat erlebt:
Von außen, durch Autokraten wie Wladimir Putin, der mit seiner Aggression gegen die Ukraine den Eroberungskrieg zurück nach Europa gebracht hat.
Aber auch von innen. Von den Populisten und Nationalisten Europas, die Journalisten einsperren, Gerichte manipulieren und gegen so genannte 'Fremde' hetzen.
Von Kräften, die all das zurückdrehen wollen, was wir uns seit 75 Jahren aufgebaut haben.Die Autokraten von außen und die Demagogen im Innern haben eines gemeinsam: Sie halten unsere demokratischen Werte für eine Schwäche.
Aber sie liegen falsch.- Außenministerin Annalena Baerbock
Dem Europarat gehören heute 46 Staaten an und damit – bis auf Russland, Belarus und den Kosovo – alle europäischen Länder, darunter alle 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Türkei und die drei Kaukasusländer. Aus dem ehemals exklusiven „Club der Demokratien“ ist seit dem Ende des Kalten Krieges eine paneuropäische Organisation geworden. Fünf Staaten haben Beobachterstatus: Heiliger Stuhl, USA, Kanada, Japan und Mexiko. Deutschland ist seit dem 13. Juli 1950 Mitglied des Europarats. Sitz ist Straßburg (Frankreich).
Zu den zentralen Einrichtungen des Europarats gehören neben dem Europäischen Gerichtshof der Menschenrechtskommissar, die Parlamentarische Versammlung sowie der Kongress der Gemeinden und Regionen.
Massentourismus: Kapverden statt Kanaren, Treviso statt Venedig
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Die Kanaren? Sind die Touristenmassen leid. Amsterdam? Will nicht noch mehr Besucher. Venedig? Ein überfülltes Museum. Hier kommen lohnende Alternativen für acht überlaufene Reiseziele in Europa...
Australien, Neuseeland, Fidschi: Außenministerin Baerbock reist in die Schlüsselregion Indopazifik
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Gemeinsam mit unseren Partnern in Australien und Neuseeland stehen wir für den Schutz der internationalen Ordnung, unserer Lebensgrundlagen und Sicherheitsinteressen ein, insbesondere auch im Hinblick auf die von China ausgehenden Herausforderungen für die Region.
Australien: Von der Sicherheitspolitik bis zur Restitution von Kulturgütern
In Adelaide wird Außenministerin Baerbock ihre australische Amtskollegin Wong und andere politische Partner treffen, um mit ihnen die deutsch-australischen Beziehungen und die Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheitspolitik zu vertiefen. Dabei geht es insbesondere um die Situation im Indopazifik und die Rolle Chinas in der Region. Passend zum Thema steht unter anderem der Besuch eines Zentrums für Cyber-Zusammenarbeit und die Besichtigung eines Patrouillenboots auf dem Programm.
Ähnlich wie wir setzt auch Australien darauf, wirtschaftliche Abhängigkeiten zu verringern. Groß ist das gemeinsame Zukunftspotenzial bei grünem Wasserstoff und Rohstoffen, während die Rückführung indigener Kulturgüter Ausdruck unserer langjährigen Freundschaft ist.
- Außenministerin Annalena Baerbock
Australien ist ein Kontinent kultureller Vielfalt. Daher wird Annalena Baerbock auch die Ministerin für Indigene Australier, Burney, treffen. Im Vorfeld der Reise wurden Kulturgüter aus kolonialen Kontexten an die indigene Gemeinschaft der Kaurna zurückgegeben – auch ihre Vertreterinnen und Vertreter wird die Außenministerin besuchen. Denn die Wahrung indigener Rechte ist die Grundlage für kulturelle Selbstbestimmung und Entwicklung.
Neuseeland: Brücke zu den pazifischen Inselstaaten
 Bei Außenministerin Baerbocks Aufenthalt in Auckland am 4. Mai und dem Treffen mit ihrem Amtskollegen Peters wird es neben der bilateralen und wirtschaftlichen Kooperation unserer Länder um die Zusammenarbeit mit den pazifischen Inselstaaten, die Stabilität im Indo-Pazifik und die Eindämmung der Klimakrise gehen. Auch dafür werden deutsche und neuseeländische Wissenschaftsinstitutionen eine Forschungspartnerschaft in der Antarktis beschließen. Im Anschluss wird Außenministerin Baerbock das Weltraumzentrum an der Universität Auckland besuchen.
Bei Außenministerin Baerbocks Aufenthalt in Auckland am 4. Mai und dem Treffen mit ihrem Amtskollegen Peters wird es neben der bilateralen und wirtschaftlichen Kooperation unserer Länder um die Zusammenarbeit mit den pazifischen Inselstaaten, die Stabilität im Indo-Pazifik und die Eindämmung der Klimakrise gehen. Auch dafür werden deutsche und neuseeländische Wissenschaftsinstitutionen eine Forschungspartnerschaft in der Antarktis beschließen. Im Anschluss wird Außenministerin Baerbock das Weltraumzentrum an der Universität Auckland besuchen.
Neuseeland ist einerseits das Tor zur pazifischen Inselwelt. Aber es richtet seinen Blick auch weit nach Süden - Richtung Antarktis. Hier wollen wir unsere wissenschaftliche Zusammenarbeit verstärken und dabei auch die wachsenden strategischen Risiken beobachten.
- Außenministerin Annalena Baerbock
Fidschi: Verbündeter im Kampf gegen die Klimakrise
 Die Reise endet mit einem zweitägigen Aufenthalt in der Republik Fidschi – es ist der erste Besuch einer deutschen Außenministerin in dem Inselstaat. Fidschi ist ganz direkt vom steigenden Meeresspiegel bedroht, daher stehen die Auswirkungen der Klimakrise und der Katastrophenschutz hier ganz besonders im Fokus. Außenministerin Baerbock wird unter anderem mit Fidschis Premierminister Rabuka zusammentreffen, ein Peacekeeping Camp besuchen und ein Gespräch mit dem Generalsekretär der Regionalorganisation „Pacific Islands Forum“ führen. Beim Besuch zweier Dörfer, die wegen Landerosion und Überschwemmungen ganz besonders von den Folgen der Klimakrise betroffen sind, trifft Außenministerin Baerbock Bewohnerinnen und Bewohner, um sich über deren persönliche Situation zu informieren.
Die Reise endet mit einem zweitägigen Aufenthalt in der Republik Fidschi – es ist der erste Besuch einer deutschen Außenministerin in dem Inselstaat. Fidschi ist ganz direkt vom steigenden Meeresspiegel bedroht, daher stehen die Auswirkungen der Klimakrise und der Katastrophenschutz hier ganz besonders im Fokus. Außenministerin Baerbock wird unter anderem mit Fidschis Premierminister Rabuka zusammentreffen, ein Peacekeeping Camp besuchen und ein Gespräch mit dem Generalsekretär der Regionalorganisation „Pacific Islands Forum“ führen. Beim Besuch zweier Dörfer, die wegen Landerosion und Überschwemmungen ganz besonders von den Folgen der Klimakrise betroffen sind, trifft Außenministerin Baerbock Bewohnerinnen und Bewohner, um sich über deren persönliche Situation zu informieren.
Ticketsteuer ab 1. Mai: Was Flugpassagiere wissen müssen
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Zum 1. Mai steigt die Ticketsteuer in Deutschland um mehr als 20 Prozent. Die meisten Airlines verzichten auf Nachzahlungen für schon gebuchte Flüge – nur Ryanair fordert: Zahlen Sie, oder Ihr Flug wird storniert! ...
Der Weg nach vorne beim internationalen Klimaschutz: 15. Petersberger Klimadialog im Auswärtigen Amt
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Der Weg nach Baku führt über den Petersberger Klimadialog – dort steht die Vorbereitung der Weltklimakonferenz COP29 in Aserbaidschans Hauptstadt im Fokus. Auf Einladung von Außenministerin Baerbock und dem designierten COP29-Präsidenten Mukhtar Babayev ist er ein wichtiger Meilenstein im internationalen Klimakalender. Es geht darum, auf politischer Ebene die zentralen Herausforderungen der internationalen Klimapolitik zu besprechen.
 Bei der COP28 in Dubai im vergangenen Jahr wurden konkrete Beschlüsse gefasst, die es nun ehrgeizig und konsequent umzusetzen gilt. Dazu gehören insbesondere der Ausbau von erneuerbaren Energien – vereinbart wurde eine globale Verdreifachung bis 2030 - und eine Verdopplung bei der Energieeffizienz. Nur so kann die Abkehr von fossilen Energien gelingen, die bei der COP28 von der Weltgemeinschaft beschlossen wurde.
Bei der COP28 in Dubai im vergangenen Jahr wurden konkrete Beschlüsse gefasst, die es nun ehrgeizig und konsequent umzusetzen gilt. Dazu gehören insbesondere der Ausbau von erneuerbaren Energien – vereinbart wurde eine globale Verdreifachung bis 2030 - und eine Verdopplung bei der Energieeffizienz. Nur so kann die Abkehr von fossilen Energien gelingen, die bei der COP28 von der Weltgemeinschaft beschlossen wurde.
Konkret wird es in diesem Jahr darum gehen, dass alle Länder klare und eindeutige neue Klimaziele oder Klimapläne aufstellen, und so den Weg bereiten für eine klimaneutrale Wirtschaft. Nur wenn jedes Land konkrete Pläne erarbeitet, wie es seine Etappenziele erreichen möchte, kann es gelingen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Vor allem die großen Volkswirtschaften sind gefragt – die G20, darunter die EU, die USA, aber gerade auch China, Indien und Länder wie Saudi-Arabien. 80% der Emissionen werden von den größten Emittenten, den G20, verursacht. Ihre Emissionsminderung entscheidet, ob das 1,5 Grad-Ziel erreichbar bleibt.
Alle Staaten müssen sich jetzt neue und ehrgeizige Klimapläne, sogenannte NDCs, geben. Das klingt technisch, aber Klimapläne sind Pläne für Investitionen und Wohlstand. Es geht eben nicht nur um Ankündigungen auf dem Papier. Es geht darum, die technischen Umsetzungsfragen anzugehen, unsere Wirtschaft umzubauen und die Chancen, die daraus entstehen, zu nutzen.
- Außenministerin Annalena Baerbock
Dafür muss auch die Wirtschaft einbezogen werden, damit sich künftige Investitionen an diesen Klimazielen orientieren. Nur mit ausreichend privaten Investitionen in umweltfreundliche Energien und Technologien kann die globale Energiewende gelingen. Die Finanzierung der globalen Klimawende wird daher auch im Fokus der Diskussionen in diesem Jahr stehen.
Auch in diesem Jahr wird auf dem Petersberger Klimadialog sehr hochrangig diskutiert - neben Bundeskanzler Olaf Scholz und dem aserbaidschanischen Staatspräsidenten Ilham Aliyev als Gastgeber der COP29 werden auch Wirtschaftsminister Robert Habeck und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (BMZ) mit den Vertreterinnen und Vertretern aus rund 40 Staaten sprechen. Beim Petersberger Klimadialog treten aber auch Entscheidungsträgerinnen und -träger aus Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern gemeinsam ans Reißbrett, um für die anstehenden Entscheidungen erste Weichen zu stellen.
Die Klimapolitik bildet einen Schwerpunkt der deutschen Außenpolitik. Mit Amtsantritt von Außenministerin Baerbock hat das Auswärtige Amt die Steuerung und Koordination der internationalen Klimapolitik – einschließlich der internationalen Klimaverhandlungen – übernommen.
Der Petersberger Klimadialog wurde 2010 von Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel ins Leben gerufen und bringt jährlich ausgewählte Staaten zusammen, um die Weichen für erfolgreiche Verhandlungen bei den Weltklimakonferenzen COP zu stellen. Der erste Petersberger Klimadialog fand auf dem namensgebenden Petersberg in Bonn statt, seither erfolgt das Treffen in Berlin. Von 2011-2021 wurde der Petersberger Dialog durch das Umweltministerium ausgerichtet. Mit Übernahme der Zuständigkeit für Klimaaußenpolitik findet die Konferenz seit 2022 im Auswärtigen Amt statt. Mitgastgeber ist jeweils das Land, das als nächstes den Vorsitz für die Weltklimakonferenz übernimmt. Die nächste Weltklimakonferenz COP29 findet vom 11. November bis 22. November 2024 in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, statt.
Unterstützung für die Ukraine & Nahost-Krisendiplomatie - Außenministerin Baerbock beim EU-Außenrat in Luxemburg
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Die EU-Außenministerinnen und Außenminister kommen heute zu ihrem monatlichen Ratstreffen in Luxemburg zusammen. Für Außenministerin Annalena Baerbock ist dies eine weitere Etappe in der laufenden Krisendiplomatie, nachdem sie vergangene Woche in Israel war und am Treffen der G7-Außenministerinnen und Außenminister in Italien teilgenommen hat. Die Tagesordnung dominieren weiter die Unterstützung für die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg und die Lage im Nahen und Mittleren Osten.
Gemeinsam für kurzfristige Hilfe bei der Luftverteidigung der Ukraine
Die derzeitige militärische Lage in der Ukraine wird ein zentrales Thema beim EU-Außenrat sein. Neben den Außenministerinnen und Außenminister der EU sind auch ihre Kolleginnen und Kollegen aus den Verteidigungsressorts eingeladen. Auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba und Verteidigungsminister Rustem Umerov werden zu Anfang der Beratungen virtuell mit am Tisch sitzen. Für die Bundesregierung bedeutet dieser erste Tagesordnungspunkt heute Teamwork: Außenministerin Annalena Baerbock und Siemtje Möller, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium der Verteidigung, werden gemeinsam teilnehmen. Beide werden erneut dafür werben, der Ukraine auch kurzfristig die so überlebenswichtigen Flugabwehr-Systeme zur Verfügung zu stellen. Dazu hatten Außenministerin Baerbock und Verteidigungsminister Pistorius letzte Woche die „Immediate Action on Air Defence“ ins Leben gerufen. Ziel der Initiative ist, dass Partnerstaaten aus der EU, der NATO und darüber hinaus koordiniert und zügig Flugabwehr-Systeme und entsprechende Munition an die Ukraine liefern. Die Bundesregierung hatte ihrerseits vor wenigen Tagen angekündigt, der Ukraine unmittelbar ein weiteres Patriot-System zu liefern. Deutschland und die EU stehen an der Seite der Ukraine. Finanziell, humanitär, militärisch und auch wirtschaftlich setzen wir unsere Unterstützung fort.
Der Blick richtet sich auch auf den Wiederaufbau in der Ukraine. Die durch Russland verursachte Zerstörung trifft die Menschen in ihrem Alltag hart – bewusst nimmt die russische Kriegsführung zivile Infrastruktur ins Visier und damit Leid und Tod von Hunderttausenden Zivilistinnen und Zivilisten in Kauf. Um die internationale staatliche wie privatwirtschaftliche Unterstützung zu stärken, veranstalten die Ukraine und Deutschland im Juni gemeinsam eine Wiederaufbaukonferenz. Die „Ukraine Recovery Conference“ (URC2024) wird führende Vertreter von Regierungen, internationalen Organisationen, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft zusammenbringen. Sie wird am 11. und 12. Juni 2024 in Berlin stattfinden.
Solidarität mit Israel nach Irans Angriff: Krisendiplomatie geht weiter
Nachdem die EU-Außenministerinnen und -Außenminister sich bereits am vergangenen Dienstag zu einer virtuellen Krisensitzung zusammengeschaltet haben, wird es auch heute erneut um die Krise im Nahen und Mittleren Osten gehen. Auf den präzedenzlosen Drohnen- und Raketenangriff des iranischen Regimes auf Israel haben die Bundesregierung und die EU mit scharfer Kritik an Iran und mit Solidarität gegenüber Israel reagiert. Außenministerin Baerbock war vergangene Woche zu Gesprächen auf höchster Ebene in Israel. Sie hat dabei den israelischen Partnern die volle Solidarität Deutschlands versichert. Nach den Entwicklungen der vergangenen Woche geht es weiter darum, wie eine zunehmende Eskalation, die Zug um Zug mehr Gewalt bedeuten würde, verhindert werden kann.
Es kommt darauf an, Iran Einhalt zu gebieten, ohne einer weiteren Eskalation Vorschub zu leisten. Um die nächsten Schritte der EU mit Blick auf Iran wird es daher hinter verschlossenen Türen heute auch in Luxemburg gehen. Die EU hat in den letzten Jahren und Monaten mehrmals Sanktionen gegen Iran verhängt, um dessen Menschenrechtsverletzungen, die Aktivitäten rund um das Nuklearprogramm und die militärische Unterstützung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zu ahnden. In Luxemburg werden die Außenministerinnen und Außenminister darüber sprechen, welche weiteren Schritte die EU gemeinsam geht.
Zugleich wird es um die die desolate humanitäre Lage im Gazastreifen gehen. Das Leid von Hunderttausenden Menschen im Gaza-Streifen bleibt weiter im Fokus der Krisendiplomatie. Außenministerin Baerbock hat in Israel vergangene Woche erneut klare Worte gefunden. Sie betonte, dass über den so wichtigen Landweg endlich mehr humanitäre Güter an die leidende Zivilbevölkerung gelangen müsse. Dafür wird die EU weiter gemeinsam ihr gesamtes diplomatisches Gewicht in die Waagschale werfen und gemeinsam mit Partnern weltweit und in der Region auf eine Verbesserung der humanitären Situation drängen.
Ein Jahr nach Konfliktbeginn: Blick auf Sudan
Seit über einem Jahr tobt in Sudan ein blutiger Bürgerkrieg mit einer furchtbaren Bilanz: Knapp 15.000 Tote und rund 8,5 Millionen Vertriebene, der Kollaps des Gesundheitssystems, ein Land in Schutt und Asche. Während ihrer Reise in die Nachbarländer Sudans im Januar 2024 hat Außenministerin Baerbock eine Fünf-Punkte-Initiative vorgeschlagen, um den internationalen Friedensbemühungen mehr Nachdruck zu verleihen. Ein zentraler Punkt der Initiative ist, die internationalen Vermittlungsbemühungen besser zu koordinieren und so den Druck auf die Konfliktparteien zu erhöhen.
Mit einer internationalen Konferenz vor einer Woche in Paris konnten Außenministerin Baerbock, ihr französischer Amtskollege Séjourné und die EU gemeinsam über zwei Milliarden Euro internationale Hilfe für die notleidenden Menschen mobilisieren. Die Konferenz in Paris war wichtig, auch um den Vermittlungsbemühungen in dem Bürgerkrieg neuen Schwung verleihen. Die Außenministerinnen und Außenminister der EU werden heute auch über die nächsten Schritte sprechen, um den Zugang für humanitäre Hilfe in das Bürgerkriegsland zu verbessern. Ebenso wird es bei den Diskussionen in Luxemburg um Wege aus der Krise und die Stärkung der Friedensbemühungen gehen.
Dark Tourism bei US-Atomraketen-Silos: »Könnten Sie den Schlüssel umdrehen?«
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Die USA machen kein Geheimnis aus den Standorten ihrer Atomwaffen. Unser Reporter ist zu Silos und Kontrollzentren in Colorado und South Dakota gefahren und hat festgestellt: Man kommt verblüffend nah ran...
Woche der Krisendiplomatie: Außenministerin Baerbock reist zum Treffen der G7-Außenministerinnen und Außenminister nach Capri
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Zwei Tage intensive Beratungen, meist abseits der Hauptstädte an einem abgeschiedenen Ort: Die G7-Außenministertreffen sind echte Klausurtagungen, bei denen sich die Außenministerinnen und Außenminister über aktuelle sicherheits- und geopolitische Themen beraten. Vom 17. bis 19. April 2024 findet das erste Treffen der Außenministerinnen und Außenminister unter italienischem Vorsitz auf Capri bei Neapel statt.
Lage im Nahen und Mittleren Osten im Fokus
Das bestimmende Thema der letzten Tage wird auch einen großen Anteil der Gespräche der Außenministerinnen und Außenminister in Capri einnehmen. Außenministerin Baerbock wird über ihre heutigen Gespräche in Israel berichten und die volle Solidarität Deutschlands für Israel gegen die Bedrohung durch Iran bekräftigen. Zugleich darf die katastrophale humanitäre Lage in Gaza und das Schicksal der weiterhin durch die Hamas verschleppten Geiseln nicht aus dem Fokus verschwinden. Die Außenministerinnen und Außenminister werden deswegen auch darüber sprechen, wie weitere humanitäre Hilfe nach Gaza gelangen und eine Freilassung der Geiseln erreicht werden kann. Auch die Sicherheit der Schifffahrtswege im Roten Meer angesichts der fortgesetzten Angriffe der Huthi werden ein Thema der Gespräche sein.
Außenministerin Baerbock sagte vor ihrer Abreise am 17. April 2024:
Bei unserem Treffen werden wir beraten, wie wir nach dem präzedenzlosen Angriff Irans auf Israel verhindern, dass aus der brandgefährlichen Lage in Nahost ein regionaler Flächenbrand wird. Als G7 sprechen wir mit einer Stimme: Alle Akteure in der Region sind zu maximaler Zurückhaltung aufgefordert. Denn mit einer Eskalationsspirale wäre niemanden gedient – nicht der Sicherheit Israels, nicht den noch immer vielen Dutzend Geiseln in den Händen der Hamas, nicht der notleidenden Bevölkerung Gazas, nicht den vielen Menschen in Iran, die selbst unter dem Regime leiden, und auch nicht den Drittstaaten der Region.
Felsenfest an der Seite der Ukraine
Mit unerbittlichen Drohnen- und Raketenangriffen setzt Russland seinen Luftterror gegen die zivile Infrastruktur der Ukraine fort und versucht den Menschen ihre Lebensgrundlage zu nehmen. Alleine in den vergangenen Wochen wurden erhebliche Teile der ukrainischen Energieinfrastruktur beschädigt oder zerstört. Deutschland hat die Lieferung einer weiteren Patriot Luftabwehreinheit angekündigt – wie die G7 und Partner weltweit die ukrainische Luftverteidigung darüber hinaus stärken können, wird eines der Themen in Capri sein. Wie schon unter dem deutschen Vorsitz 2022 und dem japanischen Vorsitz letztes Jahr sind die G7 bei der Unterstützung der Ukraine weiter der entscheidende Abstimmungsmechanismus.
Außenministerin Baerbock:
Egal welches Mittel der Kriegsführung Russland gegen die Ukraine einsetzt, gemeinsam halten wir seit zwei Jahren dagegen: mit präzedenzlosen Sanktionen, einem Winterschutzschild, gemeinsamer Kraftanstrengung für die Energieversorgung und einem immer dichteren Netz aus bilateralen Sicherheitszusagen für die Ukraine. Genauso entschlossen müssen wir und Partner weltweit jetzt bei der Abwehr des russischen Terrors aus der Luft nachlegen. Eine stärkere Luftabwehr ist eine Frage des Überlebens für Tausende Menschen in der Ukraine und der beste Schutz für unsere eigene Sicherheit. Und das bedarf unseres vollen Einsatzes.
Weitere Themen: Afrika, Indo-Pazifik, Konnektivität
Einen besonderen Schwerpunkt legt die italienische G7-Präsidentschaft auf die Zusammenarbeit mit den Ländern Afrikas und der Afrikanischen Union. Ein Fokus liegt dabei auf der Sicherheit in der Sahelzone. Italien hat hierzu Vertreterinnen und Vertreter der Afrikanischen Union und Mauretaniens als AU-Vorsitz eingeladen. In weiteren Arbeitssitzungen werden sich die G7-Außenministerinnen und Außenminister darüber hinaus mit weiteren Fragen wie beispielsweise der Zusammenarbeit im indopazifischen Raum und globalen und fairen Infrastrukturpartnerschaften der EU mit Partnerländern in der Europäischen Nachbarschaft, Afrika, Lateinamerika, der Karibik und Asien befassen. Der informelle Charakter des Treffens erlaubt den Ministerinnen und Ministern einen sehr engen und vertrauensvollen Austausch.
Die G7 (Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten - die Europäische Kommission hat einen Beobachterstatus) bieten ein Forum zum informellen - und damit sehr offenen – Austausch zu aktuellen Herausforderungen. Die gemeinsamen Werte verbinden die teilnehmenden wirtschaftsstarken Demokratien hierbei und ermöglichen auch für die Öffentlichkeit vielfach eine klare Positionierung z.B. zu akuten Krisen in der Außen- und Sicherheitspolitik. Dabei sind die G7 keine internationale Organisation und verfügen über keine festen Strukturen wie ein Sekretariat, der Vorsitz organisiert die Vorbereitung insbesondere der Ministertreffen und des Gipfels jedoch zumeist in Arbeitsgruppen. Der Vorsitz bzw. die Präsidentschaft der G7 rotiert jährlich unter den Mitgliedern. Deutschland übernahm im Jahr 2022 die G7-Präsidentschaft, 2023 war Japan an der Reihe und zum 1.1.2024 übernahm Italien.
Jahresabrüstungsbericht 2023
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Der Jahresabrüstungsbericht 2023 beleuchtet wie jedes Jahr die wichtigsten Abkommen und Bestimmungen, zentrale Entwicklungen und die Schwerpunktsetzung der deutschen Rüstungskontroll-, Abrüstungs- und Nichtverbreitungspolitik des vergangenen Jahres. Dass die Umstände widrig bleiben, zeichnet sich deutlich ab. Dennoch können wir weiterhin wichtige Beiträge zu Frieden und Sicherheit leisten. Die Bundesregierung wird deshalb zusammen mit ihren Partnern die vielfältigen Anstrengungen auf diesem Gebiet fortsetzen.
Die Sicherheitslage verschlechtert sich
Die europäische und globale Sicherheitsarchitektur wurde auch 2023 durch den anhaltenden russischen Angriffskrieg auf die Ukraine weiter stark beschädigt. Russland setzt die Verletzung zentraler Prinzipien der europäischen und internationalen Sicherheits- und Abrüstungsarchitektur fort. Russlands hat sich aus zahlreichen internationalen Verträgen zurückgezogen oder seine Teilnahme suspendiert, dazu gehört der New START-Vertrag mit den USA, der KSE-Vertrag über die konventionellen Streitkräfte sowie der umfassende nukleare Testtoppvertrags (CTBT). Das sind harte weitere Rückschläge für die Abrüstungsbemühungen. Die russische Besetzung des ukrainischen Kernkraftwerks Saporischschja gefährdet außerdem die nukleare Sicherheit und Sicherung nicht nur in der Ukraine.
Und auch China setzt den Ausbau seines Arsenals an nuklearen und konventionellen Waffen fort und lehnt jegliche Transparenz- und Rüstungskontrollmaßnahmen ab. Zusätzlich stellen die sich verschärfenden Proliferationskrisen in Nordkorea und Iran eine Bedrohung für die regionale und globale Sicherheit dar.
Fortgesetztes Engagement unter schwierigen Bedingungen
Unter diesen schwierigen Bedingungen übernahm die Bundesregierung auch im Jahr 2023 international Verantwortung für Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung. Dafür formulierte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock vor der Genfer Abrüstungskonferenz im Jahr 2023 die folgenden Ansätze:
- Abrüstung und Rüstungskontrolle sind komplementär zu Abschreckung und Verteidigung – denn beide dienen demselben Ziel: die Sicherheit für Europa erhöhen. Dieser Leitgedanke wurde bereits 2022 im Strategischen Konzept der NATO verankert und wird auch in der Nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesregierung betont.
- Alle Bemühungen um Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung müssen dem Umstand Rechnung tragen, dass Russland fundamental gegen das Völkerrecht verstoßen hat und in historischem Ausmaß Vertrauen gegenüber Russland verloren gegangen ist. Daher ist es besonders dringlich, Schritte zu unternehmen, um Risiken zu vermindern und unbeabsichtigte Eskalationen zu vermeiden.
Nukleare Nichtverbreitung - eine sichere Welt ohne Nuklearwaffen
Die Bundesregierung setzt sich weiterhin dafür ein, den Nuklearen Nichtverbreitungsvertrag (NVV) als Eckpfeiler der globalen Nichtverbreitungsarchitektur zu erhalten und zu stärken. Dazu gehört auch, allen Widrigkeiten zum Trotz zu versuchen, Irans nukleare Bewaffnung zu verhindern und den Ausbau des völkerrechtswidrigen Nuklearwaffen- und Raketenprogramm Nordkoreas zu stoppen. Langfristiges Ziel bleibt eine Welt ohne Nuklearwaffen. Der russische Angriffskrieg darf auch nicht dazu führen, das Chemie- und Biowaffentabu aufzuweichen, weder in Europa noch in anderen Regionen.
Neuen Technologien und humanitäre Rüstungskontrolle
Die rasante technologische Entwicklung verlangt auch nach gemeinsamen Antworten auf die Frage, wie Regelungen zur Nutzung neuer Technologien mehr Sicherheit schaffen können. Dazu gehört die Arbeit an verhaltensbasierten Ansätzen zur Rüstungskontrolle im Weltraum und an universell zu entwickelnden Vereinbarungen zur militärischen Nutzung von Waffensystemen mit autonomen Funktionen. Die Bundesregierung wird mit ihren Partnern die gemeinsamen Anstrengungen fortsetzen, Sicherheit im Cyberraum herzustellen.
Zuletzt setzt sich die Bundesregierung auf internationaler Ebene für humanitäre Rüstungskontrolle ein, unter anderem bei der Eindämmung der unkontrollierten Proliferation von Kleinwaffen, der Ächtung bestimmter Waffensysteme, die nicht mit dem humanitären Völkerrecht in Einklang zu bringen sind, und der Schaffung verbindlicher Mindeststandards im Umgang mit Munition.
Solidarität und politische Gespräche: Außenministerin Baerbock reist erneut nach Israel
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Mit über 300 auf Israel abgefeuerten Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern hat Iran am Wochenende Israel auf präzedenzlose Art und Weise direkt angegriffen. Ein Großteil konnte von Israel, den Vereinigten Staaten sowie Partnern in der Region abgefangen werden. Die Unterstützung Israels auch durch Staaten der Region zeigt, wie sehr sich das iranische Regime auch mit seinem Spiel mit dem Feuer isoliert hat.
Seit dem Wochenende ist Außenministerin Baerbock im diplomatischen Dauereinsatz, um eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern. Deutschland stimmt sich dabei aufs engste mit der israelischen Regierung sowie mit unseren Partnern in EU, G7 und NATO sowie der Region ab. Erst heute ist etwa der jordanische Außenminister Safadi in Berlin zu einem Krisenbesuch in Berlin zu Gast.
Flächenbrand verhindern
Heute reist Außenministerin Baerbock erneut nach Israel, zum nunmehr siebten Mal seit dem 7. Oktober 2023, zum achten Mal seither in die Region. Sie wird dabei vor Ort unter anderem mit dem israelischen Außenminister Katz sowie Premierminister Netanyahu über die aktuelle Lage sprechen und Deutschlands Solidarität mit Israel nach dem Angriff Irans unterstreichen. Iran versucht mit seinen Drohnen und Raketen eine ganze Region zu destabilisieren – in den Gesprächen in Israel wird es deswegen insbesondere darum gehen, wie verhindert werden kann, dass sich die Eskalationsspirale der Gewalt immer weiterdreht.
Menschen in Gaza und Geiseln weiter im Fokus
Zugleich darf die weiter katastrophale humanitäre Lage in Gaza nicht in den Hintergrund treten. Außenministerin Baerbock wird deswegen mit ihren Gesprächspartnern erneut auf eine massive Steigerung der Hilfslieferungen dringen. Noch immer hält Hamas zudem israelische Frauen, Männer und Kinder in ihren Tunneln in Geiselhaft – seit mehr als einem halben Jahr. Sie müssen endlich freikommen, auch darum wird es im Rahmen der Gespräche gehen.
Frieden kann es nur geben, wenn er für alle gilt. Deutschland setzt sich deswegen seit Monaten gemeinsam mit aller Kraft für eine humanitäre Feuerpause ein, die zu einem nachhaltigen humanitären Waffenstillstand führt und den Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung ebnet.
Sudan auf der Agenda halten: Deutschland, Frankreich und die EU richten internationale Konferenz aus
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Anfang 2023 waren die Menschen in Sudan und die internationale Gemeinschaft voller Hoffnung. Ein Durchbruch bei der Transition hin zu einer zivilen Regierung war zum Greifen nah. Doch dann kam alles ganz anders. Am 15. April 2023 stürzten zwei machthungrige Generäle, die ihre Pfründe nicht teilen wollten, den Sudan in einen blutigen Krieg, der bis heute andauert.
Die Bilanz des einjährigen Bürgerkriegs ist dramatisch: Knapp 15.000 Tote und rund 8,5 Millionen Vertriebene, der Kollaps des Gesundheitssystems, ein Land in Schutt und Asche. Besonders die Bilder aus Darfur rufen düstere Erinnerungen an den Völkermord wach, der dort vor 20 Jahren begangen wurde. Und auch die regionalen Auswirkungen sind enorm: Die oft bitterarmen Nachbarstaaten haben in den letzten Monaten 1,9 Millionen Flüchtlinge aus Sudan aufgenommen.
Seit Beginn des Konflikts haben viele internationale Akteure versucht, in dem Krieg zu vermitteln, um einen Waffenstillstand und eine bessere humanitäre Versorgung zu erreichen – leider ohne nachhaltige Ergebnisse. Die Konfliktparteien haben die Vermittlungsinitiativen gegeneinander ausgespielt, sich nicht an Abmachungen gehalten und Resolutionen des UN-Sicherheitsrats ignoriert.
Die Pariser Sudan-Konferenz
Während ihrer Reise in die Nachbarländer Sudans im Januar 2024 hat Außenministerin Baerbock eine Fünf-Punkte-Initiative vorgeschlagen, um den internationalen Friedensbemühungen mehr Nachdruck zu verleihen. Ein zentraler Punkt der Initiative ist, die internationalen Vermittlungsbemühungen besser zu koordinieren und so den Druck auf die Konfliktparteien zu erhöhen.
Hier setzt die Pariser Sudankonferenz an. Erstmalig kommen auf Einladung von Außenministerin Baerbock, Frankreichs Außenminister Séjourné und der EU alle relevanten Akteure, die sich um eine Lösung des Konflikts in Sudan bemühen, hochrangig zusammen, um sich auf ein gemeinsames Vorgehen zu einigen.
Die humanitäre Krise eindämmen
Die humanitäre Lage in Sudan ist katastrophal. Rund die Hälfte der Bevölkerung Sudans ist für ihr Überleben dringend auf humanitäre Hilfe angewiesen – das sind 25 Mio. Menschen. Die UN schätzt, dass es 2,5 Milliarden Euro braucht, um die humanitäre Krise in Sudan zu bewältigen und abertausende Menschen vor dem Hungertod zu bewahren.
Und auch in den Nachbarstaaten Sudans ist die Lage dramatisch. Dort spielt sich gerade unter unseren Augen eine der größten Flüchtlingskrise der Welt ab. Eines der vielen vollkommen überfüllten Flüchtlingslager hat Außenministerin Baerbock im Januar in Südsudan besucht.
Bei der Pariser Sudankonferenz sollen deswegen Hilfszusagen aus aller Welt eingeworben werden. Die deutsche Bundesregierung plant, hier mit gutem Beispiel voranzugehen.
Deutschland trägt als zweitgrößter Geber dazu bei, die notleidenden Menschen in Sudan und den Nachbarländern mit dem Nötigsten zu unterstützen. Letztes Jahr belief sich die deutsche humanitäre Hilfe im Sudan-Kontext auf 250 Mio. Euro.
Die sudanesische Zivilgesellschaft zusammenbringen
Bisher ist es den zivilen Akteurinnen und Akteuren Sudans nicht gelungen, sich auf eine gemeinsame politische Position zu einigen, der eine möglichst große Anzahl verschiedener Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Positionen zustimmen kann. Die Pariser Sudan-Konferenz bietet daher den zivilen Akteurinnen und Akteuren Sudans eine Plattform, zusammenzukommen, sich zu organisieren und eine gemeinsame Vision für einen demokratischen Sudan zu entwickeln. Sie standen in erster Reihe, als die sudanesische Bevölkerung 2019 Diktator al-Baschir aus dem Amt gejagt hat. Viele von ihnen haben danach Regierungsverantwortung übernommen, bevor sich das Militär 2021 an die Macht geputscht hat.
Schönste Schwimmbäder: Schwimmbad-Tourist Philipp Reußner gibt Tipps
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Philipp Reußner liebt Schwimmbäder – in mehr als einhundert Becken hat er schon Bahnen gezogen. Hier verrät er, welche Bäder ihn besonders reizen und wie er die schönsten in Deutschland und im Ausland findet...
Tokio: Als ich gegen Sumokämpfer in den Ring stieg
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Die Sumokultur gehört zu Japan. In Tokio kann man mit dem Nationalsport hautnah in Kontakt kommen – im wahrsten Sinne des Wortes...
„Einer für alle, alle für einen“: Außenministerin Baerbock beim NATO-Treffen in Brüssel
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Das Treffen der Außenministerinnen und Außenminister der NATO, das heute und morgen in Brüssel stattfindet, ist in gewisser Weise historisch. Zum einen wird Schweden als jüngster und 32. Alliierter zum ersten Mal als Vollmitglied am Tisch des Nordatlantikrats sitzen. Zum anderen werden die Außenministerinnen und Außenminister das 75. Jubiläum der Gründung der Allianz begehen.
Auf der Tagesordnung des Treffens stehen die Sicherheitslage im Bündnisgebiet seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sowie die Fortsetzung der Unterstützung für die Ukraine, die Vorbereitung des NATO-Gipfels am 9.-11. Juli in Washington D.C. und die Zusammenarbeit mit NATO-Partnern in der Asien-Pazifik-Region.
Kollektive Verteidigung – seit 75 Jahren das Herzstück der Allianz
Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gehört die NATO zu den wichtigsten Garanten von Freiheit und Sicherheit auf dem europäischen Kontinent. Für die Sicherheit Deutschlands und Europas ist das transatlantische Bündnis unverzichtbar. Kernstück dieses Bündnisses ist Artikel 5 des NATO-Vertrags, der besagt, dass jedes Mitgliedsland sich im Falle eines bewaffneten Angriffs auf den Beistand seiner Alliierten in Europa und Nordamerika verlassen kann und jedes Mitglied seinerseits seine Alliierten unterstützt.
Am 4. April 1949 schlossen zwölf Staaten Europas und Nordamerikas in Washington den Nordatlantikvertrag. Als 15. Mitglied trat die Bundesrepublik Deutschland am 6. Mai 1955 der NATO bei. Heute gehören ihr folgende 32 Staaten an: Albanien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Island, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, die Slowakei, Slowenien, Spanien, die Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und die Vereinigten Staaten von Amerika. Amtierender NATO-Generalsekretär ist der Norweger Jens Stoltenberg.
Austausch im Rahmen des NATO-Ukraine-Rats
 Am Donnerstag wird der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba im Rahmen des NATO-Ukraine-Rats mit den Außenministerinnen und Außenministern über die Lage angesichts Russlands Krieg gegen die Ukraine und weitere Hilfen sprechen. Die Sicherheit der Ukraine ist für die NATO und ihre Mitgliedsstaaten von enorm wichtiger Bedeutung. Das Bündnis unterstützt uneingeschränkt das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung. Die Zukunft der Ukraine liegt in der EU und in der NATO. Auf dem Gipfeltreffen in Vilnius im Jahr 2023 bekräftigten die Bündnispartner, dass die Ukraine Mitglied der NATO werden wird, wenn die Bündnispartner zustimmen und die Bedingungen für einen Beitritt erfüllt sind. Die Beziehungen zwischen der NATO und der Ukraine reichen bis in die frühen 1990er Jahre zurück und haben sich seitdem zu einer der bedeutendsten Partnerschaften der NATO entwickelt. Seit 2014, nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland, wurde die Zusammenarbeit in wichtigen Bereichen intensiviert: zum Beispiel durch die Teilnahme von ukrainischen Soldatinnen und Soldaten an NATO-Übungen und Operationen sowie durch die Kooperation bei der Abwehr von Cyberattacken.
Am Donnerstag wird der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba im Rahmen des NATO-Ukraine-Rats mit den Außenministerinnen und Außenministern über die Lage angesichts Russlands Krieg gegen die Ukraine und weitere Hilfen sprechen. Die Sicherheit der Ukraine ist für die NATO und ihre Mitgliedsstaaten von enorm wichtiger Bedeutung. Das Bündnis unterstützt uneingeschränkt das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung. Die Zukunft der Ukraine liegt in der EU und in der NATO. Auf dem Gipfeltreffen in Vilnius im Jahr 2023 bekräftigten die Bündnispartner, dass die Ukraine Mitglied der NATO werden wird, wenn die Bündnispartner zustimmen und die Bedingungen für einen Beitritt erfüllt sind. Die Beziehungen zwischen der NATO und der Ukraine reichen bis in die frühen 1990er Jahre zurück und haben sich seitdem zu einer der bedeutendsten Partnerschaften der NATO entwickelt. Seit 2014, nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland, wurde die Zusammenarbeit in wichtigen Bereichen intensiviert: zum Beispiel durch die Teilnahme von ukrainischen Soldatinnen und Soldaten an NATO-Übungen und Operationen sowie durch die Kooperation bei der Abwehr von Cyberattacken.
Seit dem Einmarsch Russlands im Februar 2022 haben viele Länder, die zugleich auch Verbündete in der Allianz sind, ein noch nie dagewesenes Maß an Unterstützung geleistet. Viele Partner haben der Ukraine, auch über den EU-Rahmen, mit Waffen, Munition sowie der Lieferung leichten und schweren Militärgeräts geholfen, darunter Panzerabwehr- und Luftabwehrsysteme, Haubitzen, Drohnen, Panzer und Kampfjets. Im NATO-Rahmen selbst haben die Bündnispartner mehr als 640 Mio. Euro für dringende Bedarfe der Ukraine zugesagt, darunter Kleidung für kaltes Wetter, Schutzwesten, Treibstoff, Transportfahrzeuge, sichere Kommunikationsmittel, Minenräumgeräte und medizinische Hilfsgüter. Wie die Ukraine weiter am besten und zielgenau bei ihrem Kampf gegen die russische Aggression unterstützt werden kann, wird bei den Gesprächen heute und morgen in Brüssel sicher eines der wichtigsten Themen sein.
Onsen-Erfahrung in Nagano: Auf der Suche nach der göttlichen Erfahrung
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Japan hat Tausende heiße Quellen. Die traditionellen Onsen versprechen Reinigung für Körper und Seele. Wie fühlt sich das an? ...
Die Welt stemmt die globale Energiewende - Berlin Energy Transition Dialogue 2024
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Die (Wirtschafts-)welt ist im Umbruch, die Märkte der Zukunft werden nicht auf Öl und Gas, sondern auf Erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff gebaut. Und auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat uns vor Augen geführt: Bei der Energiewende geht es um mehr als Klimaschutz, es geht um unsere Sicherheit, denn fossile Energien machen viele Länder der Welt abhängig und verwundbar. Dabei ist klar: Damit die globale Energiewende gelingt, braucht es mehr internationale Zusammenarbeit.
Am 19./20.3. findet der 10. Berlin Energy Transition Dialogue im Auswärtigen Amt statt – er hat sich als international zentrale Energiewendeplattform für den Austausch zwischen Regierungen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft etabliert. Entsprechend groß ist die Resonanz, mit vielen Ministerinnen und Ministern, zum Beispiel Namibia, Oman, Uruguay oder Bangladesch.
Die globale Energiewende voranbringen
 Die Weltklimakonferenz COP28 in Dubai hat das Ende des fossilen Zeitalters besiegelt und deutlich gemacht: Die Erneuerbaren sind die globale Lösung für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. Die Weltgemeinschaft hat eine Verdreifachung der globalen Kapazitäten von erneuerbaren Energien bis 2030 und eine Verdopplung der jährlichen Steigerungsrate der Energieeffizienz im gleichen Zeitraum beschlossen. Es geht darum, Ideen und Erfahrungen auszutauschen, best practices und Chancen der Energiewende zu diskutieren und um Energiepartnerschaften zu schmieden, um eine umweltverträgliche, sichere und erschwingliche globale Energiewende zu erreichen. Es geht zum Beispiel um Fragen rund um die Finanzierung der globalen Energiewende, von Kohleausstieg, Industriedekarbonisierung, Fachkräfte und Nachhaltigkeit. Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft aus über 100 Ländern werden auf dem BETD zusammenkommen.
Die Weltklimakonferenz COP28 in Dubai hat das Ende des fossilen Zeitalters besiegelt und deutlich gemacht: Die Erneuerbaren sind die globale Lösung für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. Die Weltgemeinschaft hat eine Verdreifachung der globalen Kapazitäten von erneuerbaren Energien bis 2030 und eine Verdopplung der jährlichen Steigerungsrate der Energieeffizienz im gleichen Zeitraum beschlossen. Es geht darum, Ideen und Erfahrungen auszutauschen, best practices und Chancen der Energiewende zu diskutieren und um Energiepartnerschaften zu schmieden, um eine umweltverträgliche, sichere und erschwingliche globale Energiewende zu erreichen. Es geht zum Beispiel um Fragen rund um die Finanzierung der globalen Energiewende, von Kohleausstieg, Industriedekarbonisierung, Fachkräfte und Nachhaltigkeit. Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft aus über 100 Ländern werden auf dem BETD zusammenkommen.
Erneuerbare Energie als wirtschaftliche Chance
 Und weltweit wird kontinuierlich an neuen Technologien und Lösungen für die Energiewende gearbeitet. Getrieben wird die Entwicklung einer sauberen und effizienten Energieversorgung nicht allein von Klimaschutzzielen, sondern auch aus ökonomischen Gründen: Erneuerbare Energien sind schon jetzt meist die günstigste verfügbare Energiequelle weltweit. So können wir von unseren Partnern in der Welt viel lernen, denn die Energiewende bietet die große Chance einer grundlegenden wirtschaftlichen Modernisierung. Sie bringt erhebliche Investitionen mit sich, die Wertschöpfung und Arbeitsplätze bedeuten. Zahlreiche der am BETD teilnehmenden Länder schreiten mutig voran: So schafft es Uruguay teilweise heute schon, 98% seines Stroms aus Erneuerbaren zu produzieren. Auch zahlreiche andere Länder in Lateinamerika haben einen ambitionierten Kurs zur Umstellung ihrer Stromversorgung eingeschlagen. Die dortigen Erfahrungen nimmt der BETD 24 mit einem eigenen Panel in den Blick.
Und weltweit wird kontinuierlich an neuen Technologien und Lösungen für die Energiewende gearbeitet. Getrieben wird die Entwicklung einer sauberen und effizienten Energieversorgung nicht allein von Klimaschutzzielen, sondern auch aus ökonomischen Gründen: Erneuerbare Energien sind schon jetzt meist die günstigste verfügbare Energiequelle weltweit. So können wir von unseren Partnern in der Welt viel lernen, denn die Energiewende bietet die große Chance einer grundlegenden wirtschaftlichen Modernisierung. Sie bringt erhebliche Investitionen mit sich, die Wertschöpfung und Arbeitsplätze bedeuten. Zahlreiche der am BETD teilnehmenden Länder schreiten mutig voran: So schafft es Uruguay teilweise heute schon, 98% seines Stroms aus Erneuerbaren zu produzieren. Auch zahlreiche andere Länder in Lateinamerika haben einen ambitionierten Kurs zur Umstellung ihrer Stromversorgung eingeschlagen. Die dortigen Erfahrungen nimmt der BETD 24 mit einem eigenen Panel in den Blick.
Das aktuelle Programm der Konferenz sowie eine Übertragung des BETD 24 finden Sie auf der Webseite www.energydialogue.berlin .
Die Konferenzsprache ist Englisch.
Das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz laden seit 2015 zum Berlin Energy Transition Dialogue (BETD), der vom Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE), dem Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar), der Deutschen Energie-Agentur (dena) und der Firma eclareon organisiert wird. Ziel des BETD ist es, die Energiewende global voranzutreiben und die internationale Vernetzung zu fördern.
Lufthansa-Streik am Dienstag und Mittwoch: Was Passagiere wissen müssen
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Zwei Drehkreuze sind vom angekündigten Streik der Lufthansa-Flugbegleiter betroffen: Frankfurt am Dienstag und München am Mittwoch. Wie kommen Reisende trotzdem ans Ziel? Und welche Ansprüche haben sie? ...
Streik der Flugbegleiter am Dienstag und Mittwoch: Was Lufthansa-Passagiere wissen müssen
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Zwei Drehkreuze sind vom angekündigten Streik der Lufthansa-Flugbegleiter betroffen: Frankfurt am Dienstag und München am Mittwoch. Wie kommen Reisende trotzdem ans Ziel? Und welche Ansprüche haben sie? ...
Japan: Kyoto will Zutritt zu beliebtem Geisha-Viertel einschränken
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Sie zerren am Kimono oder werfen Zigarettenkippen in den Ausschnitt: Weil Touristen immer wieder Geishas belästigen, schreitet nun der Stadtrat von Kyoto ein. Begründung: »Wir wissen nicht mehr weiter.« ...
Tourismus in Japan: Kyoto reagiert auf Rüpel-Touristen im Geisha-Viertel
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Sie zerren am Kimono oder werfen Zigarettenkippen in den Ausschnitt: Weil Touristen immer wieder Geishas belästigen, schreitet nun der Stadtrat von Kyoto ein. Begründung: »Wir wissen nicht mehr weiter.« ...
Europa erweitern und stärken – Außenministerin Baerbock reist nach Montenegro und Bosnien und Herzegowina
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Heute bricht Außenministerin Annalena Baerbock zu einer Reise auf den Westbalkan auf. Im Zentrum der Gespräche steht die EU-Erweiterungspolitik. Zuerst reist die Außenministerin heute in die montenegrinische Hauptstadt Podgorica. Im Anschluss geht es weiter nach Sarajewo in Bosnien und Herzegowina. Alle sechs Staaten des Westlichen Balkans befinden sich auf dem Weg in die EU: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Besonders seit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ist die schnelle Annäherung der Region an die EU zu einer geopolitischen Notwendigkeit geworden. Fortschritte auf dem Weg in die EU sind entscheidend – dafür braucht es Reformen in den Kandidatenländern, aber auch Geschlossenheit und Zusammenhalt innerhalb der EU. Auf den Tag, an dem über 30 Mitgliedstaaten am EU-Tisch Platz nehmen werden, muss sich die EU zudem auch mit Reformen vorbereiten.
Der EU-Erweiterungsprozess ist an klare Kriterien geknüpft. Die Kandidatenländer haben einen häufig schwierigen Beitrittsprozess vor sich. Es geht darum, die beitrittswilligen Länder bereit für die Aufnahme in die EU zu machen. Dafür müssen zentrale rechtstaatliche und demokratische Grundprinzipien garantiert sein. Auch die Aufnahme in den gemeinsamen Binnenmarkt muss gründlich vorbereitet werden. Die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten begleiten die Reformen in den jeweiligen Ländern mit aller Kraft, mit finanzieller und technischer Unterstützung.
Vor ihrer Abreise nach Podgorica und Sarajewo sagte Außenministerin Baerbock heute (04.03.):
Die Länder des Westlichen Balkans gehören untrennbar zu unserem Europa. Dass wir den sechs Staaten der Region auf ihrem Weg in die Europäische Union mit aller Kraft unter die Arme greifen, ist spätestens angesichts Russlands brutalem Imperialismus zur geopolitischen Notwendigkeit geworden. Wir können uns in Europa nirgendwo Grauzonen erlauben und müssen gemeinsam alles dafür tun, Flanken zu schließen, die Russland für seine Politik der Destabilisierung, Desinformation und Unterwanderung nutzen kann. Dazu gehört, die Länder des Westlichen Balkans dabei zu unterstützen, ihre demokratischen Institutionen zu stärken, ihre Widerstandsfähigkeit zu verbessern und den Menschen eine wirtschaftliche Perspektive zu bieten.
Montenegro – viele Fortschritte seit dem Beginn der EU-Gespräch in 2012
Montenegro, das Land an der Adriaküste, ist im Erweiterungsprozess bereits weit vorangeschritten – weiter als alle anderen beitrittswilligen Länder. Seit 2012 laufen die sogenannten Beitrittsverhandlungen zwischen der EU einerseits und der Regierung von Montenegro andererseits. In allen Themenbereichen, allen 33 sogenannten „Verhandlungskapiteln“, gibt es bereits Gespräche und Montenegro arbeitet am Reformkatalog. Die Regierung von Premierminister Spajić in Podgorica, die seit Ende Oktober 2023 im Amt ist, hat das Ziel, dem Beitrittsprozess nochmal neuen Schwung zu geben. Sie hat Reformen angekündigt, bei deren Umsetzung Deutschland weiter unterstützen wird.
In der NATO ist Montenegro bereits seit Jahren unser Verbündeter. Im EU-Beitrittsprozess hat sich Montenegro eine ambitionierte Agenda gegeben und geht diese nun wieder beherzt an. Wir wollen den neuen Elan gemeinsam nutzen und Montenegro auf dem Weg in die EU als enger Partner und guter Freund begleiten. In Podgorica wird es auch darum gehen, wie Montenegro bei Rechtsstaatsreformen und im Kampf gegen Korruption und das organisierte Verbrechen noch besser vorankommen kann und wie wir das Land dabei unterstützen können.
- Außenministerin Baerbock vor ihrer Abreise nach Podgorica
Bosnien und Herzegowina vor Weggabelung im EU-Beitrittsprozess
Der Europäische Rat hat im Dezember 2023 beschlossen, dass die Beitrittsverhandlungen mit Bosnien und Herzegowina dann eröffnet werden, wenn das erforderliche Maß an Übereinstimmung mit den Beitrittskriterien erreicht ist. Im März wird ein neuer Bericht der EU-Kommission zu den Reformen erwartet. Dabei wird es darum gehen, wie weit das Land bei den Reformen in den von der EU aufgestellten Schlüsselprioritäten Fortschritte gemacht hat. Auf Grundlage des nächsten Berichts der EU-Kommission wird sich dann voraussichtlich auch der Europäische Rat Ende März erneut mit der Frage befassen, ob die Beitrittsverhandlungen beginnen können.
Auf dem Weg in Richtung EU müssen die Verantwortlichen in Sarajewo die notwendigen Reformen Schritt für Schritt angehen. Die Verabschiedung des Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung war solch ein europäischer Reformschritt. Mit Blick auf die im Oktober anstehenden Kommunalwahlen ist es zentral, dass die Wahlrechtsreform mit einem Integritätspaket nun angepackt wird. Freie und faire Wahlen sind das Fundament einer demokratischen Gesellschaft. Wir stellen uns dabei denjenigen entschieden entgegen, die Bosnien und Herzegowina mit ihren Spaltungsphantasien Steine in den Weg in die EU legen und europäische Werte in Frage stellen.
- Außenministerin Baerbock vor ihrer Abreise nach Montenegro und Bosnien und Herzegowina
Nach Abschluss ihrer Westbalkan-Reise wird Außenministerin Baerbock noch zu einem Arbeitsbesuch nach Paris reisen. Im Gespräch mit ihrem französischen Amtskollegen Stéphane Séjourné wird es um aktuelle europa- und außenpolitische Fragen gehen. Im Zentrum wird dabei Europas Unterstützung für die Ukraine stehen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer verteidigen seit mehr als zwei Jahren ihr Land und damit auch Europas Frieden und Sicherheit gegen Russlands Imperialismus.
Glenorchy in Neuseeland: Wie der Luxus ins Backpacker-Paradies einzieht
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Spätestens seit »Herr der Ringe« ist Glenorchy ein Touristen-Hotspot. Nun zeigt das abgelegene Dorf zwischen Bergen und Gletschersee, wie die Zukunft der Neuseelandreisen aussehen könnte...
Warnstreik beim Lufthansa-Bodenpersonal: Was Flugreisende jetzt wissen müssen
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Von Dienstagmorgen bis Mittwochmorgen geht nicht viel. Die Lufthansa rechnet damit, nur zehn bis zwanzig Prozent der geplanten Flüge anbieten zu können. Diese Rechte haben Reisende...
Außenministerin Baerbock beim EU-Rat in Brüssel: Startschuss für EU-Mission im Roten Meer und Ukraine-Unterstützung zwei Jahre nach Kriegsbeginn
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Von München nach Brüssel: Der heutige EU-Außenrat knüpft nahtlos an die Gespräche und Beratungen auf der Münchener Sicherheitskonferenz am vergangenen Freitag und Samstag an. Die dominierenden Themen bleiben die Lage im Nahen und Mittleren Osten, und, kurz vor dem zweiten Jahrestag des russischen Überfalls, die weitere Unterstützung der Ukraine.
Start der maritimen EU-Operation Aspides & humanitäre Lage in Gaza
„Decision to launch“ heißt es im EU-Jargon – heute werden die Außenministerinnen und Außenminister formell den Beginn der maritimen EU-Operation im Roten Meer, Arabischen Meer und Persischen Golf beschließen. Ihre Aufgabe: für mehr Sicherheit für die internationale Schifffahrt auf dieser wichtigen Lebensader des Welthandels zu sorgen. Deutschland hat sich in den vergangenen Wochen intensiv für ein Zustandekommen der Operation im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU eingesetzt – mit der Fregatte „Hessen“ ist eine deutsche Beteiligung am Einsatz, vorbehaltlich der parlamentarischen Zustimmung, geplant.
Über das Rote Meer hinaus bleibt die Lage im Nahen Osten zum Zerreißen gespannt – und ist insbesondere für die Menschen in Gaza eine humanitäre Katastrophe. Außenministerin Baerbock wird heute im EU-Kreis über die Gespräche und Ergebnisse ihrer jüngsten Reise nach Israel berichten. Dort hat sie unter anderem noch einmal deutlich gemacht: Die israelische Armee muss die Zivilbevölkerung besser schützen, denn die Menschen vor Ort können sich schlicht nicht in Luft auflösen. Neben einem deutlich verbesserten humanitären Zugang nach Gaza wird es heute auch um das Thema der Gewalt radikaler Siedler im Westjordanland gehen – hier beraten die Außenministerinnen und Außenminister über EU-Sanktionen. Die EU27 werden zudem darüber sprechen, wie sie den Druck auf die Terroristen der Hamas, etwa über Listungen unter dem EU-Menschenrechtssanktionsregime, weiter ausbauen können.
EU-Ukraine Unterstützung
Kommenden Samstag (24.02.) jährt sich der Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine zum zweiten Mal – dass die Ukraine der russischen Vollinvasion bis heute Stand hält, ist zuallererst ein Erfolg der mutigen Ukrainerinnen und Ukrainer, die für ihr Land kämpfen – sowie der geschlossenen Unterstützung ihrer Partner. Am Freitag haben Deutschland und Frankreich mit bilateralen Sicherheitszusagen noch einmal ihre Unterstützung für die Ukraine unterstrichen und klar gemacht: Die Sicherheit der Ukraine ist auch die Sicherheit Europas. Die EU27 werden heute über (weitere) Sicherheitszusagen beraten und diskutieren, wie die finanzielle und militärische Unterstützung der Ukraine noch effektiver gestaltet werden kann. Auch Verhandlungen zum – nunmehr bereits 13. – Sanktionspaket gegen Russland stehen auf der Agenda.
Weitere Themen: Sahel, Belarus
Die Sahelregion ist in den letzten Wochen und Monaten wieder aus dem Rampenlicht der Medienöffentlichkeit geraten – die Lage vor Ort bleibt nach den diversen Militärputschen jedoch komplex. Die Außenministerinnen und Außenminister werden über den strategischen Ansatz im Umgang mit der Region und den dortigen Militärregierungen in Burkina Faso, Mali und Niger beraten. Für Deutschland ist es zentral, eine weitere Destabilisierung der Region zu verhindern – dazu ist insbesondere eine verstärkte Zusammenarbeit mit den westafrikanischen Küstenstaaten und in Nordafrika wichtig. Anlässlich der Parlaments- und Regionalwahlen in Belarus am 25.02. werden sich die EU27 zudem über die Lage und Unterstützung der demokratischen Opposition und Zivilgesellschaft austauschen.
Der „Rat für Auswärtige Angelegenheiten" (RfAB) ist zuständig für das außenpolitische Handeln der EU, was die Bereiche der Außen‑, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, den Handel, die Entwicklungszusammenarbeit und die humanitäre Hilfe umfasst. Er hat vor allem die Aufgabe, gemeinsam mit der Europäischen Kommission und unter Einbindung des Hohen Vertreters der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, ein einheitliches und koordiniertes außenpolitisches Handeln der EU sicherzustellen. Der RfAB tagt in der Regel einmal im Monat.
„As long as it takes”: Die Sicherheit der Ukraine ist auch unsere Sicherheit
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Heute haben Bundeskanzler Scholz und Präsident Selenskyj in Berlin bilaterale Sicherheitszusagen mit der Ukraine unterzeichnet. Außenministerin Baerbock und weitere Bundesministerinnen und Bundesminister waren ebenfalls anwesend. Die bilateralen Sicherheitszusagen gehen auf eine G7-Erklärung der Staats- und Regierungschefinnen und -chefs vom Juli letzten Jahres am Rande des NATO-Gipfels in Vilnius zurück. Darin gaben die G7-Länder die Zusage, dass alle Unterzeichnerstaaten Vereinbarungen über Sicherheitszusagen mit der Ukraine schließen werden. Die Ukraine verteidigt nämlich nicht nur seine eigene Freiheit, seine Menschen und seine territoriale Integrität, sondern auch die Freiheit und Sicherheit Europas.
Die Sicherheitszusagen machen Deutschland nicht zur Kriegspartei in der Ukraine. Sie sind aber ein starkes Signal, dass wir in unserer Unterstützung nicht nachlassen, und Schulter an Schulter mit der Ukraine stehen. Sie bauen dabei auf die breite Unterstützung auf, mit der Deutschland die Ukraine seit zwei Jahren in ihrer Verteidigung unterstützt. Die Vereinbarung gibt der Ukraine Planungssicherheit und sendet auch ein deutliches Signal an Russland: Unsere Unterstützung ist auf lange Sicht angelegt, wir haben einen langen Atem, „as long as it takes“.
32 Länder bereit Netz an Sicherheitszusagen über Ukraine zu spannen
Der Erklärung haben sich neben der G7 auch 25 weitere Staaten sowie die EU angeschlossen.
Alle Partner arbeiten derzeit mit Hochdruck am Abschluss ihrer Vereinbarung mit der Ukraine. Das Vereinigte Königreich ist bisher der einzige Staat, der seine Vereinbarung mit der Ukraine abgeschlossen und veröffentlich hatte. Die Unterzeichnung mit Frankreich wird ebenfalls heute erfolgen.
Außenministerin Baerbock betonte:
Wir haben heute Morgen als Bundesrepublik Deutschland ein neues Kapitel unserer Unterstützung für die Menschen in der Ukraine, aber auch für unsere gemeinsame Freiheit aufgeschlagen. Ein neues Kapitel mit Sicherheitszusagen für die nächsten Jahre - solange unsere Unterstützung für die Freiheit der Menschen in der Ukraine gebraucht wird.
Sicherheitszusagen breit gefächert
Es handelt es sich um eine politisch verbindliche Vereinbarung. Sie ist auf zehn Jahre ausgelegt, mit der Option zu verlängern. Inhaltlich liegt der Schwerpunkt auf den Bereichen militärische und sicherheitspolitische Unterstützung: Dazu zählt insb. die zukünftige Ausrichtung der ukrainischen Streitkräfte und deren Ausbildung, die Kooperation der Rüstungsindustrie, die Reform des ukrainischen Sicherheits- und Verteidigungssektors, Cyber- und nachrichtendienstliche Zusammenarbeit.
Ergänzend bekräftigt der Text auch unser breites Engagement im zivilen Bereich, insbesondere wirtschaftliche Zusammenarbeit und Wiederaufbau. Deutschland und die Ukraine haben zudem einen Konsultationsmechanismus vereinbart, für den Fall zukünftiger russischer Aggressionen gegen die Ukraine.
Intensive Verhandlungen und Vorbereitung seit Sommer 2023 als „Team Bundesregierung“
Die Verhandlungen wurden für die Bundesregierung gemeinsam vom Bundeskanzleramt und Auswärtige Amt geführt, unter Einbindung weiterer betroffener Ressorts.
Münchner Sicherheitskonferenz: Von „Lose-lose“ zu „Win-win“
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Mit über 900 Teilnehmenden, rund 50 Staats- und Regierungschefs, mehr als 100 Ministerinnen und Ministern sowie Vertreterinnen und Vertretern von Think-Tanks, Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen ist die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) eines der wichtigsten Treffen der sicherheitspolitischen Community weltweit. Jedes Jahr diskutieren die Teilnehmenden im Hotel Bayerischer Hof über zentrale Herausforderungen für die globale Sicherheit. „Engage and interact with each other: Don’t lecture or ignore one another“ – diese sogenannte „Munich Rule” wird sich auch dieses Jahr wie ein roter Faden durch die Münchner Sicherheitskonferenz ziehen. Kurz gesagt: Es geht darum, miteinander zu interagieren und voneinander zu lernen, statt übereinander zu sprechen.
Die Konferenz fand erstmals 1963 statt. In den ersten Jahrzehnten nannte sich die MSC noch „Wehrkundetagung“. Damals war die Gruppe der Teilnehmer recht klein, nur rund ein paar Dutzend. Obwohl die Tagung schon damals als internationale Konferenz geplant war, ging es vor allem darum, den deutschen Teilnehmern eine Gelegenheit zu geben, ihre Kollegen aus den USA und aus anderen NATO-Staaten zu treffen. Im Laufe der Jahre weitete sich der Kreis immer weiter aus. Zwar finden sich in den Fluren weiterhin viele Generäle, jetzt aber auch Vorstandsvorsitzende, Menschenrechtlerinnen, Umweltschützer und andere Führungspersönlichkeiten aus der ganzen Welt.
Übersicht über das Programm
Neben öffentlichen Terminen wie Panels und Diskussionsrunden, ist die MSC vor allem ein Speed-Dating der Diplomatie. Kaum irgendwo anders bietet sich die Gelegenheit, mit so vielen Amtskolleginnen und -kollegen und Praktikerinnen und Praktikern der Sicherheitspolitik in so kurzer Abfolge und informell ins Gespräch zu kommen. Im Zentrum der Gespräche werden die Lage in Nahost nach dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel sowie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und seine dramatischen Auswirkungen weltweit stehen.
Außenministerin Baerbock:
Wir brauchen endlich eine Sicherheits- und Verteidigungsunion, die den europäischen Pfeiler in der NATO stärkt - im Maßstab unserer wirtschaftlichen Größe, und unabhängig davon, wer in den USA regiert. Die nationalen militärischen Fähigkeiten der EU-Mitglieder müssen dafür nicht nur in der Realität auch wirklich miteinander kompatibel sein, sondern es braucht eine gemeinsame strategische europäische Beschaffung, Entwicklung und Industriekooperation, in die jeder seine besondere nationale Stärke einbringt.
Es wird bei der MSC auch um die Beziehungen zu China und Indien sowie um die Bedeutung einer feministischen Außenpolitik für unsere globale Sicherheit gehen.
Außenministerin Baerbock wird sich zusammen mit ihrem indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar und US-Außenminister Antony Blinken zum Thema „Growing the Pie: Seizing Shared Opportunities“ auf einem Panel dazu austauschen, wie die internationale Gemeinschaft die Prinzipien verteidigen kann, die uns alle gleichermaßen schützen: das internationale Recht, die Charta der Vereinten Nationen und die universellen Menschenrechte. Auch ein Treffen der G7-Außenministerinnen und Außenminister findet am Rande der MSC statt – auf Einladung Italiens, das den Vorsitz im Jahr 2024 innehat.
Die MSC steht natürlich immer auch ganz besonders für die transatlantische Zusammenarbeit. Außenministerin Baerbock wird sich daher mit einer großen US-Kongressdelegation austauschen. Die Teilnahme von parteiübergreifenden US-Kongressdelegationen ist langjährige Tradition bei der MSC. Gemeinsam ins Gespräch zu kommen und Stimmen aus den verschiedenen politischen Lagern zu hören, ist nicht nur mit Blick auf die anstehende Präsidentschaftswahl in den USA besonders wichtig.
Hinzu kommen zahlreiche weitere Veranstaltungen wie zum Beispiel ein Treffen zur Bedeutung feministischer Außenpolitik für die Menschen in Afghanistan, auf Einladung von Außenministerin Baerbock und der Ministerin für Auswärtige Angelegenheiten von Kanada, Mélanie Joly, sowie ein Austausch einer großen Gruppe sicherheitspolitisch engagierter Frauen, an der unter anderem die ehemalige Außenministerin und US-Senatorin Hillary Clinton teilnehmen wird.
Themenschwerpunkt der Veranstalter
„Lose-Lose?“ ist das Motto der Münchner Sicherheitskonferenz 2024. Dahinter verbirgt sich für die Autorinnen und Autoren des gleichnamigen Berichts, dass sich angesichts wachsender geopolitischer Spannungen und zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheit viele Regierungen nicht länger auf die Vorteile globaler Zusammenarbeit konzentrieren. Stattdessen, so die Autorinnen und Autoren, sind viele Länder zunehmend besorgt darüber, dass sie weniger von internationaler Kooperation profitieren als andere. Sie warnen, dass dieser Fokus zu einer Dynamik des „Lose-Lose“ führen könnte: eine Abwärtsspirale also, die eine Zusammenarbeit gefährdet und die bestehende internationale Ordnung untergräbt, die trotz ihrer Mängel immer noch dazu beitragen kann, den sprichwörtlichen Kuchen zum Wohle aller wachsen zu lassen. Deutschland wird seinen Beitrag zu einem guten Miteinander auf der Basis des internationalen Rechts leisten. Wir schauen über Europa hinaus, helfen bei Krisen und Konflikten weltweit und stehen mit unserem Engagement, von humanitärer Hilfe bis hin zur Klimaaußenpolitik, für Menschen weltweit ein.
Ideenschmiede und Impulsgeber für Europa: Außenministerin Baerbock beim Weimarer Dreieck
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Vor den Toren von Paris, in der Stadt La Celle-Saint-Cloud, trifft sich heute auf Einladung des französischen Außenministers Stéphane Séjourné das sogenannte „Weimarer Dreieck“. Es ist das erste Treffen auf Außenministerebene seit dem Amtsantritt des polnischen Außenministers Radosław Sikorski und seines französischen Amtskollegen Stéphane Séjourné. Gemeinsam will das Trio dem Weimarer Dreieck als Format für den engen Dialog miteinander neuen Schwung geben.
Vor ihrer Abreise nach La Celle-Saint-Cloud sagte Außenministerin Baerbock heute (12.02.):
Der Zusammenhalt Europas ist unsere Lebensversicherung gerade in Zeiten, in denen Russland die europäische Friedensordnung unter Beschuss nimmt, Krisen weltweit für Verunsicherung sorgen und demokratiefeindliche Tendenzen an den Grundfesten europäischer Werte rütteln. Für ein starkes, widerstandsfähiges Europa in stürmischen Zeiten kann das Weimarer Dreieck mehr denn je in seiner 30-jährigen Geschichte Kraftzentrum und Ideenschmiede sein. Denn unsere Stärke liegt gerade darin, dass wir in Frankreich, Polen und Deutschland auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf unser Europa schauen. Dass wir daraus Impulse entwickeln, erwarten die Menschen in Europa zurecht.
Volle Tagesordnung: u.a. Ukraine-Unterstützung, Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit
Wenige Tage vor dem zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine wird es heute vor allem um Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Europa gehen. Polen, Deutschland und Frankreich stehen an der Seite der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf. Uns eint die Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern. Ihre Unterstützung – sei es finanziell, militärisch, humanitär und auch politisch – hat für die Bundesregierung weiter höchste Priorität.
Zudem wird es heute um nächste Schritte bei der EU-Erweiterungspolitik gehen. Seit vielen Jahren streben u.a. die Staaten des Westlichen Balkans in Richtung EU-Mitgliedschaft. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Europa auf dramatische Weise vor Augen geführt, wie sehr Europa und seine Wertepartner sich wechselseitig brauchen. Dass kommende EU-Erweiterungen auch mit inneren Reformen in der EU einhergehen, ist eine wichtige Herausforderung. Beide Prozesse wollen wir als Bundesregierung in der EU gemeinsam voranbringen.
Es gibt viel zu tun, wir wollen es anpacken: Wir arbeiten daran, wie wir die Ukraine gemeinsam noch besser unterstützen können, denn das stärkt unser aller Sicherheit. Wir bauen unsere EU weiter, damit sie wetterfest und handlungsfähig für eine Zukunft mit 30 Mitgliedern und mehr wird. Wir stärken Austausch und Zusammenhalt unserer Bürgerinnen und Bürger. Denn uns eint in Paris, Warschau und Berlin die tiefe Überzeugung, dass europäische Antworten die besseren Antworten sind.
- Außenministerin Baerbock vor ihrer Abreise zum Treffen des Weimarer Dreieiecks
Ein Format mit langer Geschichte und viel Zukunft
Am 28. August 1991 trafen sich die damaligen Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens – Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas und Krzysztof Skubiszewski – an Goethes Geburtstag in Weimar, um das Weimarer Dreieck ins Leben zu rufen. Ihr Bestreben war es, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs gemeinsame Grundinteressen für die Zukunft Europas zu identifizieren sowie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auszubauen. Über drei Jahrzehnte nach seiner Gründung ist dieses trilaterale Gesprächs- und Kooperationsformat heute wichtiger denn je, um dem politischen und zivilgesellschaftlichen Austausch neue Impulse zu geben und damit Europa geeinter und handlungsfähiger zu machen. Das Weimarer Dreieck versinnbildlicht dabei, wie auf vielen verschiedenen Ebenen gemeinsam und über Grenzen hinweg Zukunft in Europa gestaltet werden kann.
Chinesisches Neujahrsfest: So wird das Jahr des Drachen gefeiert
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Von Peking über Manila bis New York und Sydney: In internationalen Metropolen haben die Menschen das neue Mondjahr begrüßt. Es steht im Zeichen des Drachen und ist für viele verheißungsvoll...
Lebensmittel und Medikamente für Gaza – Deutschland hat humanitäre Hilfe aufgestockt
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Auch wenn in den Tagen der humanitären Feuerpause wesentlich mehr Hilfsgüter die Grenze passierten, bleibt die humanitäre Lage in Gaza katastrophal. Nach dem brutalen Angriff der Terrororganisation Hamas auf den Staat Israel und seine Menschen am 7. Oktober leidet auch die Zivilbevölkerung in Gaza unter den Folgen des Terrors der Hamas. Die Basisversorgung für die Zivilbevölkerung ist zusammengebrochen und es fehlt dort hunderttausenden Menschen, unter ihnen vielen Kindern, am Allernötigsten: Lebensmittel, Wasser und medizinische Versorgung. Deshalb ist es wichtig, dass humanitäre Hilfe schnell und ungehindert an die Zivilbevölkerung in Gaza verteilt werden kann. Auch darum ging es bei den vier Reisen von Außenministerin Baerbock in die Region seit dem 7. Oktober 2023.
Außenministerin Baerbock hat angekündigt, dass Deutschland seine humanitäre Hilfe für die Menschen in den Palästinensischen Gebieten aufstocken wird.
Auf einer Pressekonferenz in Amman sagte die Außenministerin am 19.10.:
Wir verstärken unsere Unterstützung für die Palästinenserinnen und Palästinenser, die auch Opfer dieses terroristischen Angriffs der Hamas geworden sind. Wir haben als deutsche Bundesregierung beschlossen, dass wir unsere humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza jetzt sofort um 50 Millionen Euro erhöhen.
Mit dem Geld unterstützen wir internationale Organisationen wie das Welternährungsprogramm, UNICEF, und vor allen Dingen auch UNRWA, damit die Menschen in Gaza mit Nahrungsmitteln versorgt werden können. Unsere Botschaft ist klar: Wir lassen die unschuldigen palästinischen Mütter, Väter und Kinder nicht alleine.
Die Bundesregierung sieht die Not der Menschen in Gaza und hat seither die humanitäre Hilfe mehrfach aufgestockt, zuletzt am 09. Januar 2024 um 8 Millionen Euro. Die Gesamthilfe für die Palästinensischen Gebiete steigt damit auf 211 Millionen Euro, davon 138 Millionen Euro neue Mittel seit dem 7. Oktober 2023.
Lebensmittel, Wasser, Medikamente und Hygieneartikel
Das Auswärtige Amt arbeitet mit den Vereinten Nationen und erfahrenen internationalen Hilfsorganisationen zusammen, um die dringend benötigte Hilfe zu den Menschen in Gaza zu bringen. Unsere Partner vor Ort sind unter anderem das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge UNRWA, das Welternährungsprogramm und das Deutsche Rote Kreuz.
Mit der von Deutschland zur Verfügung gestellten humanitären Hilfe können die Organisationen Grundnahrungsmittel, medizinische Versorgung und Hygieneprodukte nach Gaza bringen. Verteilt werden zum Beispiel Hirse, Reis, Kichererbsen und Öl, aber auch medizinische Produkte wie Verbandsmaterial und Spritzen.
Ernennung der deutschen Sondergesandten für humanitäre Hilfe im Nahen und Mittleren Osten
Außenministerin Baerbock hat die erfahrene Karrierediplomatin Deike Potzel zur deutschen Sondergesandten für humanitäre Hilfe im Nahen und Mittleren Osten ernannt. Damit fungiert sie u.a. als Counterpart des US-Sondergesandten David Satterfield und ist zentrale deutsche Ansprechpartnerin für die Akteure in der Region. Das Engagement der Sondergesandten bettet sich ein in die internationalen Bemühungen, die humanitäre Notlage in Gaza abzumildern, unter der die Zivilbevölkerung Gazas in Folge der Terrorangriffe der Hamas leidet.
Die Sondergesandte ist im Rahmen von humanitärer Pendeldiplomatie in der Region Ansprechpartnerin für UN-Organisationen (OCHA, UNRWA, WFP, UNICEF), das IKRK sowie internationale und regionale Partner. Zudem hält sie engen Kontakt zu den Verantwortlichen für humanitäre Hilfe in der Region sowie den Hauptstädten unserer Partner. Ihre Arbeit baut auf dem langjährigen deutschen humanitären Engagement und Bemühungen für Frieden und Stabilität in der Region auf.
Vorwürfe gegen Mitarbeiter von UNRWA
Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge UNRWA ist für die Grundversorgung der palästinensischen Bevölkerung lebenswichtig. Ende Januar 2024 sind Vorwürfe gegen Mitarbeiter der Organisation erhoben worden. Generalkommissar Lazzarini hat daraufhin umgehend Maßnahmen ergriffen. Bis zum Ende der Aufklärung wird Deutschland in Abstimmung mit anderen Geberländern temporär keine neuen Mittel für UNRWA in Gaza bewilligen – ohnehin stehen derzeit keine neuen Zusagen an. Unsere sonstige humanitäre Hilfe für Gaza läuft weiter.
Seit dem 7. Oktober hat Deutschland mit über UNRWA abgewickelter humanitärer Hilfe und aus Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit überlebenswichtige Grundversorgungsmittel wie Wasser, Lebensmittel, Notunterkünfte, Hygiene und Sanitäranlagen sowie medizinische Güter für die Menschen im Gaza-Streifen finanziert.
Sony World Photography Awards 2024: Eine Extraportion Schönheit
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Haben Sie kurz Zeit, einen Berggipfel in Vietnam zu bestaunen? Oder im ägyptischen Dahab abzutauchen? Diese Fotos wurden bei den Sony World Photography Awards prämiert...
Wintercamping mit dem Wohnmobil: »Meine Frau wollte kurz spazieren gehen«
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Eigentlich waren wir zu dritt losgefahren mit dem Wohnmobil. Doch dann stieg mir mein Mann aufs Dach, und ich stieg aus – um den Zauber des Wintercampings zu genießen...
Außenministerin Baerbock stellt Fußballbotschafterinnen und -botschafter für die Europameisterschaft 2024 vor
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Der Fußball bringt uns zusammen. Egal, woher wir kommen. Egal, an welchen Gott wir glauben oder eben nicht. Egal, was wir sonst noch so im Leben machen. Auf dem Bolzplatz sind wir alle einfach nur Menschen.
- Außenministerin Annalena Baerbock
Wir drücken unserem Team nicht nur alle Daumen. Die Fußball-Europameisterschaft der Herren, die vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 in Deutschland stattfinden wird, soll auch für das europäische Modell von Vielfalt, Freiheit, gegenseitigem Respekt und Nachhaltigkeit stehen und ein Beispiel für andere Sportgroßveranstaltungen weltweit setzen. Diese Werte sind unser Erfolgsmodell – als Gesellschaft und eben auch im Fußball. Denn ein Land, in dem Teile der Bevölkerung von der Teilhabe ausgeschlossen sind, wird kaum ein so gutes Team aufstellen können wie ein freies Land, in dem jeder und jede sein Potential entfalten kann.
Um diese Werte in die Welt zu tragen und für Deutschland als Gastgeberland zu werben, hat Außenministerin Baerbock sieben ehemalige Fußballprofis zu deutschen Fußballbotschafterinnen und -botschaftern ernannt: die ehemaligen Nationalspielerinnen und -spieler Steffi Jones, Thomas Hitzlsperger, Arne Friedrich, Gerald Asamoah, Jimmy Hartwig und Miroslav Klose sowie die ehemalige Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb.
Fußball integriert Menschen. Wir dürfen jetzt repräsentieren, dass wir ein tolles Gastgeberland sind und ein Europa mit starken Werten vertreten.
- Fußballbotschafterin Steffi Jones
Die nachhaltigste Europameisterschaft jemals
Insbesondere mit Blick auf die Klimakrise wollen wir mit der kommenden EM in Deutschland ein Beispiel für andere Sportgroßveranstaltungen weltweit setzen. Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, dass diese Europameisterschaft die bislang nachhaltigste werden soll. So werden zum Beispiel keine neuen Stadien gebaut, CO2-Emissionen kompensiert und Bahntickets für anreisende Fans vergünstigt angeboten.
Das sind die Spieldaten
Vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 findet die UEFA EURO 2024 in Deutschland statt. Ausgetragen wird die EM in insgesamt 10 Stadien (Berlin, Hamburg, Leipzig, Köln, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt und München). Erstmals seit 1988 treten die 24 teilnehmenden Mannschaften wieder in Deutschland an, um den Titel zu erringen. Das Eröffnungsspiel wird am 14. Juni in München mit der Begegnung Deutschland – Schottland angepfiffen. Das Finale wird am 14. Juli in Berlin ausgetragen.
Im Gedenken an die Leningrader Blockade
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Am 80. Jahrestag des Endes der Leningrader Blockade erinnern wir an die Schrecken und an das Leid, das die deutsche Wehrmacht über Leningrad und seine Bevölkerung gebracht hat. Mehr als eine Million Menschen starben durch die Belagerung. Die Stadt und ihre Menschen litten 872 Tage unter Hunger, Schrecken und unermesslichem Leid. Als brutaler Akt gegen eine ganze Stadt und ihre Bevölkerung hallt dieses furchtbare Kriegsverbrechen noch heute nach.
Deutschland steht zur seiner historischen Verantwortung
Deutschland setzt sich dafür ein, dass die Erinnerung an die Gräuel deutscher Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg weiterhin aufrechterhalten wird und bekennt sich ausdrücklich zu seiner historischen Verantwortung für die in Leningrad durch die deutsche Wehrmacht begangenen Verbrechen. Auf Grundlage einer Gemeinsamen Erklärung von 2019 hat die Bundesregierung eine „Humanitäre Geste“ gegenüber allen Blockadeüberlebenden ins Leben gerufen. Als Geste der Versöhnung und des Erinnerns fördert die Bundesregierung zum einen die Modernisierung eines Krankenhauses in St. Petersburg. In diesem Krankenhaus werden zahlreiche noch lebende Blockadeopfer behandelt. Zum anderen fördert die Bundesregierung in St. Petersburg Begegnungen mit Blockadeopfern. Dabei sollen junge Menschen mit den Überlebenden in den Austausch kommen, die Erinnerung an die Blockade soll gestärkt und weitergegeben werden.
Deutschland steht zu seiner historischen Verantwortung und setzt diese Maßnahmen – trotz des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine – weiter fort.
Für ein Ende der Gewalt in Sudan: Annalena Baerbock reist nach Dschibuti, Kenia und Südsudan
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Es war die Stunde der Frauen, als Sudan vor fünf Jahren Hoffnung schöpfte. Mit ihnen gingen große Teile der Bevölkerung auf die Straße und demonstrierten für Demokratie und Gleichstellung. Das Bild der 22-jährigen Studentin Alaa Salah ging damals um die Welt: auf einem Autodach stehend, mit anklagendem Zeigefinger in der Luft, trug sie der Menge ein Gedicht vor und wurde so zu einer lebendig gewordenen Freiheitsstatue - zum friedlichen Symbol des sudanesischen Widerstandes gegen die Diktatur. „Brecht den Widerstand der Mädchen, dann brecht ihr auch den Widerstand der Männer“, soll einer der sudanesischen Generäle das Militär damals angewiesen haben. Es gelang ihnen nicht. Die Massendemonstrationen führten dazu, dass der sudanesische Diktator al-Baschir abgesetzt wurde. Zivile Politiker und das Militär einigten sich auf eine geteilte Übergangsregierung, bis sie die Macht endgültig in zivile Hände geben wollten. Doch das Militär hielt sein Wort nicht.
Seit nunmehr acht Monaten bekämpfen sich Sudans Armee unter dem Kommando von General Burhan und die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) unter General Hemedti. Über 12.000 Tote, 7 Millionen Vertriebene, ein kollabiertes Gesundheitssystem, ein Land teilweise in Schutt und Asche – das ist die bittere Bilanz. Beiden Seiten werden Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und systematische Vergewaltigungen als Kriegswaffe vorgeworfen. Außenministerin Annalena Baerbock wird nun die Staaten und Akteure der Region besuchen, die bei den Bemühungen um Vermittlung und Frieden in Sudan eine zentrale Rolle spielen: Dschibuti, Kenia, Südsudan sowie die Regionalorganisation IGAD.
Außenministerin Baerbock:
Gemeinsam mit meinen Gesprächspartnern in Dschibuti, Kenia und Südsudan will ich Möglichkeiten ausloten, die Generäle Burhan und Hemedti endlich an den Verhandlungstisch zu bekommen, damit sie die Menschen in Sudan nicht weiter in den Abgrund reißen und die Region nicht weiter destabilisieren.
Für Stabilität in der Region
In Dschibuti wird Außenministerin Baerbock politische Gespräche führen und Vertreter der IGAD, des Staatenbundes der Länder am Horn von Afrika, treffen. Seit Beginn der Kämpfe in Sudan bemühen sich die Regierung von Dschibuti und die Regionalorganisation IGAD um Dialog und einen Waffenstillstand. Das kleine Land spielt eine enorm wichtige Rolle für die Stabilität und Sicherheit am Horn von Afrika. Frankreich, Italien, die USA, Japan und China sowie die europäische Anti-Piraterie-Mission ATALANTA haben Marinestützpunkte in Dschibuti und sichern damit die Handelsrouten im Roten Meer und am Horn von Afrika Roten Meer.
Auch in Kenia wird es vor allem um die Friedensbemühungen für Sudan gehen. Hier wird Außenministerin Baerbock neben ihren politischen Gesprächspartnern auch Vertreterinnen und Vertreter der sudanesischen Zivilgesellschaft im Exil treffen. Unsere beiden Länder verbinden aber auch vielfältige Beziehungen, die davon leben, dass wir immer wieder voneinander lernen können. Während Kenia Vorreiter beim Ausbau von erneuerbaren Energien ist und bereits rund 90 Prozent seiner Energie aus Erdwärme, Wasser- und Windkraft gewinnt, bekämpft das Land seine Jugendarbeitslosigkeit mit einem bewährten deutschen Exportschlager: dem dualen Ausbildungssystem. Außenministerin Baerbock wird daher auch eine von der GIZ geförderte Ausbildungsstätte besuchen und sich mit den Auszubildenden austauschen.
Auf der letzten Station ihrer Reise wird Außenministerin Baerbock in Südsudans Hauptstadt Dschuba politische Gespräche führen, mit deutschen Angehörigen der UN-Mission UNMISS sprechen und eine UNHCR-Flüchtlingssiedlung besuchen. Südsudan hat hunderttausenden Geflüchteten aus Sudan Zuflucht gegeben und sich aufgrund seiner engen Nachbarschaft und Geschichte mit Sudan als Vermittler im Konflikt angeboten. Deutschland trägt als zweitgrößter Geber dazu bei, die Geflüchteten in Sudans Nachbarstaaten mit dem Nötigsten zu versorgen. Doch es braucht internationalen Druck auf ein Ende der Kämpfe, um das Leid endlich zu stoppen.
Außenministerin Baerbock:
So dunkel die Lage in Sudan momentan auch scheinen mag: die mutigen jungen Menschen, allen voran Frauen, die 2019 für mehr gesellschaftliche Teilhabe und friedliche Veränderung auf die Straße gegangen sind, stehen für eine bessere Zukunft des Landes. Wir schulden ihnen, diesen Konflikt nicht zu einer „vergessenen Krise“ werden zu lassen.
Travel Photographer of the Year 2023: Das sind die besten Reisefotos aus aller Welt
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Der Schamane vom Baikalsee, versunkene Wälder in Japan, kuschelnde Schuppentiere in Simbabwe: Die Jury eines internationalen Wettbewerbs für Reisebilder hat die stärksten Aufnahmen des Jahres gekürt. Hier sind sie...
Außenministerin Baerbock beim EU-Rat in Brüssel: Fokus auf der Lage im Nahen & Mittleren Osten und Ukraine-Unterstützung
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Die EU-Außenministerinnen und -Außenminister kommen heute zu ihrem ersten Ratstreffen im neuen Jahr zusammen. Die Tagesordnung dominieren weiter der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie die schwierige Situation in Gaza und die Gefahr einer regionalen Eskalation. Außenministerin Baerbock wird heute im EU-Kreis auch über die Gespräche und Ergebnisse ihrer jüngsten Reise nach Israel, in die Palästinensischen Gebiete (Westjordanland), nach Ägypten und Libanon berichten.
Mehr als 100 Tage nach den brutalen Terrorangriffen der Hamas gegen Israel sind weiter über Hundert Menschen als Geiseln in der Gefangenschaft der Hamas. Israel hat das Recht, sich gegen den anhaltenden Terror der Hamas zu verteidigen. Zugleich gilt, dass Israel dabei alles tun muss, die Zivilbevölkerung zu schützen und sein militärisches Vorgehen anzupassen. Deutschland setzt sich mit Nachdruck für mehr humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza ein, um das unermessliche Leid der Menschen vor Ort zu lindern. Seit dem 7. Oktober hat Deutschland seine humanitäre Hilfe verdreifacht, auf rund 211 Millionen Euro für die Zivilbevölkerung in den palästinensischen Gebieten, vor allem in Gaza.
Um den Druck auf die Hamas weiter zu erhöhen, hat die EU im Vorfeld des EU-Außenrats auf Initiative Deutschlands ein neues Instrument für Sanktionen verabschiedet, um vor allem die Finanzströme der Hamas auszutrocknen. Die zunehmenden regionalen Spannungen werden ebenfalls ein Thema der heutigen Ratssitzung sein. Außenminister mehrerer Staaten der Region werden als Gäste an den heutigen Beratungen der EU teilnehmen.
Die Bundesregierung, gemeinsam mit vielen internationalen Partnern, hat die Angriffe der Huthi-Miliz auf zivile Handelsschiffe im Roten Meer deutlich verurteilt – für diese Attacken gegen zivile Ziele gibt es keine Rechtfertigung – sie müssen aufhören. Und die EU ist bereit, einen Beitrag zur Stabilität in der Region zu leisten. Deshalb werden die 27 EU-Mitgliedstaaten heute über einen gemeinsamen EU-Marineeinsatz zum Schutz der zivilen Schifffahrt und Verkehrsfreiheit im Roten Meer beraten. Dabei ist das Ziel, die Mission so bald wie möglich ins Leben zu rufen.
2024 wird die EU weiter an der Seite der Ukraine stehen
Beim heutigen EU-Außenrat wird es erneut um den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine gehen. Erneut wird der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba zu Beginn der Ratssitzung zugeschaltet sein. Die Bundesregierung bekennt sich zur Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Mit Unterstützung bei der Luftverteidigung und der Lieferung von Generatoren spannen wir gemeinsam mit Verbündeten einen Winterschutzschirm über die Ukraine, denn Russland greift gezielt Infrastruktur an, um die Ukraine auch im zweiten Kriegswinter zu schwächen. In unserer Unterstützung lassen wir nicht nach: Im Jahr 2024 wird die Bundesregierung bilateral militärische Hilfsgüter im Wert von über 7 Milliarden Euro zur Verfügung stellen.
Auch die EU wird die Unterstützung für die Ukraine fortsetzen. Denn die Ukraine verteidigt auch die europäische Friedensordnung. Die Beratungen in Brüssel, wie diese Unterstützung – finanziell, aber auch militärisch – für dieses und die nächsten Jahre aufgesetzt wird, laufen derzeit. Auch der Europäische Rat wird sich mit dieser Frage am 1. Februar erneut befassen.
Lake Dunstan Trail in Neuseeland: Großer Ritt auf neuen Fernradwegen
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Viele hielten den Bau für Verschwendung, doch die Idee wird zum Erfolg: Neuseelands neue Fernradwege »Great Rides« führen durch Regenwald, vorbei an Bergen, Fjorden oder Seen. So wie der Lake Dunstan Trail...
Aktuelle Lage in Nahost - Informationen für deutsche Staatsangehörige
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Am Morgen des 7. Oktober 2023 hat die Terrororganisation Hamas Israel brutal angegriffen: Wohnungen und Krankenhäuser wurden von Raketen getroffen, Menschen wahllos in ihren Häusern und auf offener Straße erschossen. Auch Besucherinnen und Besucher eines Musikfestivals wurden zu Hunderten ermordet. Mehr als 1.200 unschuldige Menschen verloren dabei ihr Leben. Ferner wurden mehr als 200 Menschen von der Hamas entführt und in den Gazastreifen verschleppt, darunter auch deutsche Staatsangehörige. Das Auswärtige Amt hat einen Sonderstab eingerichtet und die Bundesregierung setzt sich auf allen zur Verfügung stehenden Wegen für die Freilassung der Geiseln ein. Mittlerweile wurden erste Geiseln freigelassen- darunter auch vierzehn deutsche Doppelstaater.
Dieser beispiellose Terror ist durch nichts zu rechtfertigen. In der Folge geht die israelische Armee gegen die Hamas in Gaza vor, zuletzt auch mit einer Bodenoperation.
Israel kann bei der Verteidigung gegen den Terror der Hamas fest und unverbrüchlich auf Deutschland zählen. Als Demokratien stehen wir Schulter an Schulter. Selbstverständlich muss Israel alles in seiner Macht Stehende tun, um Zivilisten zu schützen. Dies gilt auch dann, wenn die Hamas sich weiter hinter Hunderttausenden von Zivilisten verschanzt und sich bewusst direkt unter Schulen und Krankenhäusern vergräbt.
- Außenministerin Annalena Baerbock
Auch die Lage im Westjordanland ist angespannt, es droht ein Übergreifen der Gewalt. Indes setzt die Hamas den Raketenbeschuss aus Gaza fort; auch aus dem Süden des Libanon werden wiederholt Drohnen- und Raketenangriffe auf Israel gemeldet. Der Krisenstab der Bundesregierung beobachtet die äußerst volatile Lage vor Ort weiterhin sehr genau.
In den palästinensischen Gebieten befindet sich derzeit noch eine registrierte mittlere dreistellige Zahl deutscher Staatsangehöriger. Aus dem Westjordanland sind Ausreisen weiterhin möglich. Und auch der Grenzübergang Rafah ist teilweise für Ausreisen geöffnet. Mehr als 700 Deutsche einschließlich ihrer Familienangehöriger konnten bisher mit Unterstützung der deutschen Auslandsvertretungen aus Gaza ausreisen.
Die humanitäre Lage in Gaza ist katastrophal. Es gibt tausende Tote und Verletzte. Die Zivilbevölkerung wird von der Hamas mutwillig als menschliches Schutzschild missbraucht. Deutschland hat seine humanitäre Hilfe für die Menschen in den palästinensischen Gebieten auf insgesamt 211 Mio. Euro aufgestockt. Seit dem bewaffneten Angriff der Hamas auf Israel ist Außenministerin Baerbock bereits vier Mal in die Region gereist: Am 13. und 14. Oktober 2023 nach Israel und Ägypten, vom 19. bis 21. Oktober 2023 nach Jordanien, Israel, Libanon und zum “Cairo Summit for Peace” in Ägypten sowie am 10. und 11. November 2023 in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Saudi-Arabien, ins Westjordanland und nach Israel. Und zuletzt reiste die Außenministerin vom 7. bis 10. Januar nach Israel, die Palästinensischen Gebiete, Ägypten und Libanon.
Empfehlungen für deutsche Staatsangehörige in der Region
Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für Israel, die gesamten Palästinensischen Gebiete und Libanon ausgesprochen.
Für Libanon gilt seit dem 19.10. eine Ausreiseaufforderung: Deutsche Staatsangehörige werden aufgerufen, aus Libanon auszureisen.
Für das Westjordanland und den Gazastreifen gilt eine Ausreiseempfehlung: Deutschen Staatsangehörigen, die sich derzeit im Gazastreifen und im Westjordanland aufhalten, wird empfohlen, auszureisen.
Deutsche sind dringend aufgerufen, sich in die Krisenvorsorgeliste ELEFAND einzutragen. Durch diese Eintragung können wir Sie regelmäßig mit Landsleutebriefen über weitere Entwicklungen und Maßnahmen informieren. Prüfen Sie zudem regelmäßig die Reise- und Sicherheitshinweise auf weitere Aktualisierungen.
Zukunftsregion Südostasien: Zwischen gefährlichen Spannungen im Südchinesischen Meer und Chancen im wirtschaftlichen „Powerhouse“ der Welt
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Mit den Philippinen, Malaysia und Singapur besucht Außenministerin Annalena Baerbock wichtige Partner Deutschlands in der Zukunftsregion Indopazifik. Schon heute ist ASEAN, der Verbund Südostasiatischer Nationen, der drittgrößte Handelspartner der EU. Diese Länder gewinnen als Investitionsstandorte und Märkte an Bedeutung und sind damit auch Schlüssel, um Abhängigkeiten bei Lieferketten abzubauen, etwa bei Halbleitern. Damit ist diese Reise auch ein wichtiges Puzzlestück, um die Ziele der Indopazifik-Leitlinien und der China-Strategie mit Leben zu füllen.
Dazu unterstrich Außenministerin Baerbock:
Mehr als 10.000 Kilometer sind die ASEAN-Staaten entfernt. Und doch ist bis nach Europa zu spüren, wie sehr Südostasien vor wirtschaftlicher Dynamik strotzt, welche strategische Bedeutung diese Region hat. Denn sie liegt im Epizentrum des globalen Wachstums – und ringt gleichzeitig mit dem immer raueren politischen Wind, der der regelbasierten internationalen Ordnung im Südchinesischen Meer entgegenweht.
Gefährliche Spannungen im Südchinesischen Meer
Es gibt schon seit Jahrzehnten Gebietsstreitigkeiten zwischen den Anrainerstaaten des Südchinesischen Meeres, also China, Vietnam, Malaysia, Brunei und den Philippinen. Eigentlich gibt UNCLOS, das UN-Seerechtsübereinkommen, klare Regeln vor, die für alle gelten. Diese Regeln geraten aber immer mehr unter Druck. China tritt zunehmend offensiv auf. Es stellt Ansprüche auf umfangreiche Seegebiete teils bis vor die Küsten der anderen Anrainerländer. Und das obwohl 2016 das internationale Schiedsgericht in Den Haag entschied, dass solche Ansprüche nicht vom Völkerrecht gedeckt sind. Die Lage hat sich im vergangenen Jahr deutlich zugespitzt. Die chinesische Küstenwache setzte gegen philippinische Boote innerhalb der philippinischen ausschließlichen Wirtschaftszone unter anderem Laser und Wasserkanonen ein, legte Barrieren mit Bojen und führte Blend- und Abdrängmanöver durch.
Solche Vorfälle führen vor Augen, wie leicht die Freiheit der Seewege und die Sicherheit von Lieferketten in Gefahr geraten können - mit Auswirkungen auf die globale Wirtschaftsentwicklung und damit auch Europa. Denn durch das Südchinesische Meer, ein Meeresgebiet fast zehnmal groß wie Deutschland, fließt ungefähr ein Drittel des globalen Seehandels.
Deutschland verbinden mit Südostasien nicht nur enge wirtschaftliche Beziehungen. Uns verbindet auch, dass wir gemeinsam Flagge für klare Regeln im Miteinander der Staaten zeigen.
– Außenministerin Baerbock
Deutschland setzt sich gemeinsam mit den südostasiatischen Partnern für eine friedliche Streitbeilegung auf der Basis des Völkerrechts ein und baut die sicherheitspolitische Kooperation in Südostasien aus. Auch darüber wird Außenministerin Baerbock vor Ort sprechen.
Philippinen: südostasiatischer Inselstaat, mit dem die bilateralen Beziehungen wieder Fahrt aufnehmen
Die Philippinen sind ein südostasiatischer Inselstaat am westlichen Rand des Pazifischen Ozeans mit ca. 114 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, das Land hat über 7.600 Inseln. Präsident Ferdinand Marcos, der seit 30.06.2022 im Amt ist, hat zuletzt beherzt Reformen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft angestoßen, die eine gute Grundlage für die Zusammenarbeit sind.
 Die Außenministerin wird mit der Journalistin und Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa und der ehemaligen Senatorin Leila de Lima über den aktuellen Zustand von Pressefreiheit, Menschenrechten und Demokratie in den Philippinen sprechen. Ressa und de Lima hatten Machtmissbrauch und wachsenden Autoritarismus unter dem damaligen Präsidenten Duterte kritisiert und wurden erst im November 2023 nach fast 7 Jahren Untersuchungshaft auf Kaution freigelassen.
Die Außenministerin wird mit der Journalistin und Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa und der ehemaligen Senatorin Leila de Lima über den aktuellen Zustand von Pressefreiheit, Menschenrechten und Demokratie in den Philippinen sprechen. Ressa und de Lima hatten Machtmissbrauch und wachsenden Autoritarismus unter dem damaligen Präsidenten Duterte kritisiert und wurden erst im November 2023 nach fast 7 Jahren Untersuchungshaft auf Kaution freigelassen.
Im Gespräch mit ihrem Amtskollegen Enrique Manalo wird sich die Außenministerin unter anderem zum großen Potenzial bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit austauschen. Ein Beispiel ist die Fachkräfteeinwanderung. Hier möchte Deutschland die Kooperation mit den Philippinen ausbauen, die Ministerin wird auch die die staatliche Berufsbildungsagentur TESDA besuchen. Dazu unterstrich die Ministerin:
Großes Potenzial birgt auch die Kooperation unserer Fachkräfte. Tausende philippinische Pflegekräfte leisten schon heute in Deutschland unverzichtbare Arbeit. Zu erfahren, wie wir weiter voneinander lernen und unsere Zusammenarbeit ausbauen können, ist mir ein wichtiges Anliegen.
Malaysia – wichtigster Handelspartner Deutschlands in Südostasien
Malaysia ist Deutschlands wichtigster Handelspartner in ASEAN. Über 700 deutsche Unternehmen sind hier ansässig. Gemeinsame Interessen bestehen auch im Bereich der grünen Transition. Malaysia will trotz eigener Öl- und Gasreserven zu einem Zentrum für erneuerbare Energien in Südostasien werden. Bei den Gesprächen der Außenministerin mit Ministerpräsident Anwar Ibrahim und dem neu ernannten Außenminister Mohamad Hassan steht der Ausbau der politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit im Mittelpunkt.
Die Außenministerin betonte in diesem Zusammenhang:
Malaysia ist unser wichtigster Handelspartner in Südostasien, seit vielen Jahren ein bedeutender Investitionsstandort für deutsche Unternehmen, ein Zukunftsmotor für die so notwendige Diversifizierung von Lieferketten. Gleichzeitig ist es mir wichtig, den Blick eines mehrheitlich muslimisch geprägten Landes auf den Krieg im Nahen Osten besser zu verstehen – und auch für unsere Sichtweise zu werben.
Dazu trifft sich die Ministerin zu einer Gesprächsrunde mit Vertreterinnen der islamischen Organisationen Sisters in Islam, ABIM und IKRAM. Dabei wird vor allem auch die Rolle der Frau in der insbesondere im Bereich des Familienrechts von der Scharia geprägten muslimischen Gemeinschaft gehen.
Singapur: Knotenpunkt der globalen Infrastruktur und globales Finanz- und Handelszentrum
Mit einer Gesamtfläche von 726 km² ist Singapur kleiner als Berlin (892 km), aber mit einem Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt von 82.808 US-Dollar im Jahr 2022 das reichste Land Südostasiens. Grundlage dessen sind u.a. der Hafen, der nach Shanghai der zweitgrößte Containerhafen der Welt ist. Für die ca. 2.200 deutschen Unternehmen ist Singapur ein sehr attraktiver Standort der Region.
Singapur ist nicht nur wirtschaftlich ein Schlüsselpartner in Südostasien. Es besteht auch eine große politische Übereinstimmung, beispielsweise bei der Haltung zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, zur Lage im Nahen Osten und in der Klimapolitik. Als einziger Staat in der Region erließ Singapur im Zuge des Angriffskriegs gegen die Ukraine Sanktionen gegen Russland. Wie wir setzt Singapur auf eine regelbasierte internationale Ordnung und das multilaterales System.
Dazu sagte Außenministerin Baerbock:
Als Knotenpunkt der globalen Infrastruktur, von der eine Exportwirtschaft wie die deutsche abhängt, ist Singapur ein Tor in die Welt. Dort treffen sich aber auch unterschiedliche Kulturen und Ideen. Mit seiner Weltoffenheit und seinen engen Beziehungen zu China ist der Stadtstaat ein Brückenbauer von unschätzbarem Wert.
Die Ministerin spricht vor Ort mit ihrem Amtskollegen Außenminister Balakrishnan.
Regionale Eskalation verhindern: Außenministerin Baerbock reist erneut in den Nahen Osten
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Auf den Tag genau drei Monate ist es her, seitdem die Terroristen der Hamas im Morgengrauen Israel angriffen und Tausende brutal aus dem Leben rissen. Der 7. Oktober markiert für die Menschen in Israel und Gaza, in der ganzen Region den Beginn eines nicht enden wollenden Albtraums. Für die Familien und Freunde der von der Hamas verschleppten Geiseln, die seit nunmehr 92 Tagen hin- und hergerissen zwischen Hoffnung und Verzweiflung um ihre Liebsten bangen. Und für die Menschen im Gaza-Streifen, deren humanitäre Lage katastrophal ist.
Außenministerin Baerbock sagte vor ihrer Abreise am 7. Januar 2024:
Wir alle spüren, das Drehbuch des Terrors darf nicht noch weiter aufgehen: Der Terror muss ein Ende haben. Die humanitäre Not der Menschen muss ein Ende haben. Die Region muss aus dem ewigen Zyklus der Gewalt herauskommen. Es ist der Moment, endlich den Grundstein für nachhaltigen Frieden und Sicherheit zu legen. Es sind in diesem Konflikt schon viel zu viele Menschen gestorben – Menschen, die diesen Krieg nicht wollten und sich nach nichts mehr als Frieden sehnen. Dafür darf keine Gefahr mehr für die Existenz Israels von Gaza ausgehen, muss Hamas die Waffen niederlegen, müssen Hisbollah und die Huthis mit ihrem gefährlichen Zündeln aufhören. Dafür brauchen die Menschen in Gaza und im Westjordanland die Chance auf ein Leben in Sicherheit, Würde und Selbstbestimmung.
Politische Gespräche in Israel und den Palästinensischen Gebieten
 Außenministerin Baerbock beginnt ihre Reise in Israel und wird am Sonntag und Montag politische Gespräche unter anderem mit dem Präsidenten Israels Jitzchak Herzog sowie dem neuen Außenminister Israel Katz führen. Darüber hinaus sind Treffen mit der Zivilgesellschaft geplant. Am Montag wird sie nach Ramallah weiterreisen und sich mit Vertretern der Palästinensischen Autonomiebehörde wie Außenminister al-Maliki treffen und über die Lage im Westjordanland und in Gaza beraten. Außenministerin Baerbock plant darüber hinaus einen Austausch mit palästinensischen Bewohnerinnen und Bewohnern des Westjordanlandes über das Leben in einem immer schwierigeren Umfeld zwischen Gewalt radikaler Siedler und Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts.
Außenministerin Baerbock beginnt ihre Reise in Israel und wird am Sonntag und Montag politische Gespräche unter anderem mit dem Präsidenten Israels Jitzchak Herzog sowie dem neuen Außenminister Israel Katz führen. Darüber hinaus sind Treffen mit der Zivilgesellschaft geplant. Am Montag wird sie nach Ramallah weiterreisen und sich mit Vertretern der Palästinensischen Autonomiebehörde wie Außenminister al-Maliki treffen und über die Lage im Westjordanland und in Gaza beraten. Außenministerin Baerbock plant darüber hinaus einen Austausch mit palästinensischen Bewohnerinnen und Bewohnern des Westjordanlandes über das Leben in einem immer schwierigeren Umfeld zwischen Gewalt radikaler Siedler und Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts.
Außenministerin Baerbock:
So entfernt dies gerade auch scheinen mag: Israelis und Palästinenser werden nur Seite an Seite in Frieden leben können, wenn die Sicherheit des Einen die Sicherheit des Anderen bedeutet. Das wird nur gelingen, wenn jeder das Leid des Anderen sieht. Es ist unsere Aufgabe, auf dem Weg hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung nichts unversucht zu lassen.
Humanitäre Lage in Gaza verbessern
 Außenministerin Baerbock wird im Anschluss nach Ägypten weiterreisen und dort unter anderem mit dem Außenminister Shoukry zusammentreffen. Das Land nimmt eine Schlüsselrolle ein als Vermittler und für den humanitären Zugang nach Gaza über den Grenzübergang Rafah. Rafah ist seit Beginn des Krieges Drehkreuz und war die meiste Zeit einziger Zugang nach Gaza. Die Versorgungslage für die Menschen in Gaza ist weiter katastrophal. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind 85 % der Bevölkerung Gazas binnenvertrieben, 53 % leiden unter Mangelernährung. Außenministerin Baerbock wird bei ihrer Reise nach Rafah weitere dringend benötigte Hilfsgüter für die Menschen in Gaza mitbringen.
Außenministerin Baerbock wird im Anschluss nach Ägypten weiterreisen und dort unter anderem mit dem Außenminister Shoukry zusammentreffen. Das Land nimmt eine Schlüsselrolle ein als Vermittler und für den humanitären Zugang nach Gaza über den Grenzübergang Rafah. Rafah ist seit Beginn des Krieges Drehkreuz und war die meiste Zeit einziger Zugang nach Gaza. Die Versorgungslage für die Menschen in Gaza ist weiter katastrophal. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind 85 % der Bevölkerung Gazas binnenvertrieben, 53 % leiden unter Mangelernährung. Außenministerin Baerbock wird bei ihrer Reise nach Rafah weitere dringend benötigte Hilfsgüter für die Menschen in Gaza mitbringen.
Über all diesem Leid schwebt zusätzlich die Gefahr einer regionalen Eskalation, die verheerende Folgen für den Nahen Osten hätte. Wie volatil die Lage ist, zeigen die beinahe täglichen Gefechte an der libanesisch-israelischen Grenze und die Angriffe der Huthi-Miliz auf zivile Schiffe im Roten Meer.
Damit aus diesen Schwelbränden kein Flächenbrand wird, ist unerlässlich, Gesprächskanäle offen zu halten und den Dialog zu suchen. Außenministerin Baerbock plant daher, im Anschluss an den Besuch in Ägypten in den Libanon weiterzureisen. Dort wird sie unter anderem mit dem Außenminister des Libanon Habib zusammentreffen. Zudem ist ein Besuch bei der Bundeswehr geplant, die sich mit der Fregatte Baden-Württemberg am maritimen Teil der Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon (United Nations Interim Force in Libanon, UNIFIL) beteiligt.
Seit dem bewaffneten Angriff der Hamas auf Israel ist Außenministerin Baerbock bereits drei Mal in die Region gereist: Am 13. und 14. Oktober nach Israel und Ägypten, vom 19. bis 21. Oktober nach Jordanien, Israel und Libanon sowie zum „Cairo Summit for Peace” in Ägypten und vom 10. bis 11. November in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Saudi-Arabien sowie nach Israel und in die Palästinensischen Gebiete. Die Bundesregierung hat ihre humanitären Mittel für die Menschen in Gaza seitdem auf über 200 Mio. Euro verdreifacht.
Wuzhi-Berg in China: Affenkönig gesucht! Bewerber sollte Bananen mögen
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Große Vorkenntnisse nicht vonnöten: In der chinesischen Provinz Hebei ist eine Stelle als Darsteller des mythischen Affenkönigs frei. Der erfolgreiche Bewerber sitzt in einer Höhle und lässt sich von Touristen füttern...
Wuzhi-Berg in China: Affenkönig gesucht! Sollte Bananen mögen
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Große Vorkenntnisse nicht vonnöten: In der chinesischen Provinz Hebei ist eine Stelle als Darsteller des mythischen Affenkönigs frei. Der erfolgreiche Bewerber sitzt in einer Höhle und lässt sich von Touristen füttern...
Was zum Jahreswechsel 2024 außenpolitisch wichtig ist
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Der zweite Kriegswinter und die anhaltende russische Aggression in der Ukraine, der Terror der Hamas und die humanitäre Lage in Gaza, die Klimakrise und unsere globalen Partnerschaften, nicht nur für mehr Klimagerechtigkeiten, bleiben auch 2024 wichtige außenpolitische Handlungsfelder – so viel wissen wir. Außen- und Sicherheitspolitik wird aber oft vor allem durch das Unvorhergesehene geprägt. Entwicklungen zu antizipieren und vorausschauend Lösungsansätze für globale Herausforderungen zu entwickeln, wird auch 2024 eine der Kernaufgaben unserer Kolleginnen und Kollegen im Auswärtigen Amt und unseren Auslandsvertretungen in der ganzen Welt sein. Was 2024 sonst mit Sicherheit wichtig wird, haben wir hier für Sie zusammengefasst.
An der Seite der Ukraine: Gemeinsam mit unseren Partnern die Unterstützung mit Nachdruck fortsetzen
Auch diesen Winter bombardiert Russland gezielt zivile Infrastruktur, um den Ukrainerinnen und Ukrainern im Winter die Lebensgrundlagen zu entziehen. Die Bundesregierung unterstützt die Ukraine daher mit einem Winterpaket und plant für das Jahr 2024, die Militärhilfe auf 8 Milliarden Euro zu verdoppeln.
Die Ukraine wehrt sich mit enormen Mut gegen die russische Aggression und verteidigt auch unsere Freiheit: Seit April 2022 hat das Land mehr als die Hälfte der von Russland ursprünglich besetzten Gebiete befreit. Den ukrainischen Streitkräften ist es zudem Schritt für Schritt gelungen, die russische Marine über das Schwarze Meer zurückzudrängen und einen sicheren Schifffahrtskorridor zu öffnen, der es schon über 200 Schiffen ermöglicht hat, Getreide und andere Waren auf die Weltmärkte zu exportieren. Obwohl der Verteidigungskampf gegen Russland der Ukraine unglaublich viel abverlangt, hat sie eine beeindruckende Reihe interner Reformen eingeleitet, die die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen ermöglichen.
Hieran wird die Bundesregierung im Jahr 2024 anknüpfen. Im Juni richtet Deutschland die diesjährige Ukraine Wiederaufbaukonferenz aus. Ziel wird es sein, Wiederbau, Reformen und EU-Beitrittsprozess noch enger zu verzahnen.
Einen Überblick über die deutschen nicht-militärischen Unterstützungsleistungen für die Ukraine finden Sie hier. Einen Überblick über die militärische Unterstützung finden Sie hier.
Israel und die palästinensischen Gebiete: Dauerhafter Frieden nur mit einer Zweitstaatenlösung
Der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober hat unglaubliches Leid über Israel gebracht und war eine Zäsur für den gesamten Nahen Osten. Nun bestimmt neben dem Schicksal der Geiseln, die noch immer in der Hand der Hamas sind, das furchtbare Leid der Menschen in Gaza die Schlagzeilen, weil sich die Hamas hinter der Zivilbevölkerung in Gaza verschanzt. Auch im neuen Jahr wird Krisendiplomatie gefragt sein, um einen regionalen Flächenbrand zu verhindern. Deutschland setzt sich energisch für neue humanitäre Pausen ein, um das katastrophale Leid der Menschen in Gaza zu lindern und Wasser, Nahrung und Medikamente zu den Menschen zu bringen. Und zugleich suchen wir den engen Austausch mit unseren arabischen Partnern. Katar und Ägypten haben sich als unverzichtbare Vermittler bewiesen, auch Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien spielen eine wichtige Rolle. Auch andere stehen bereit, um zu unterstützen. Der Schlüssel für den Frieden liegt vor Ort. Nur eine verhandelte Zweistaatenlösung kann dazu führen, dass Israelis und Palästinenser dauerhaft in Frieden und Sicherheit leben können. Diese Perspektive darf 2024 nicht aus dem Blick geraten.
75 Jahre NATO: Gemeinsam unsere Freiheit und Sicherheit bewahren
Die NATO ist zentraler Pfeiler der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Mit derzeit 31 Mitgliedern garantiert sie unsere Sicherheit und Stabilität im euroatlantischen Raum. Zuletzt ist Finnland im April 2023 der Allianz beigetreten. Nach der Ratifikation durch die Türkei und Ungarn wird Schweden 2024 folgen.
2024 steht im Zeichen des 75. Geburtstags der NATO. Die Allianz wurde im Jahr 1949 in Washington gegründet. Dort findet im Juli auch der „Jubiläums-Gipfel“ der Staats- und Regierungschefs statt.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat das Sicherheitsumfeld in Europa grundlegend verändert. Deutschlands Sicherheit ist untrennbar mit der Sicherheit seiner Alliierten verbunden. Darum arbeitet Deutschland beispielsweise auch 2024 mit Nachdruck weiter daran, erstmals eine permanent stationierte Brigade nach Litauen zu entsenden.
COP29 in Baku im November 2024: Klimafinanzierung ausbauen und gerechter machen
Steigende Meeresspiegel, dramatisches Artensterben, neue Hitzerekorde – die Klimakrise zeigt sich weltweit. Schon heute leben über 3 Milliarden Menschen in Regionen, die stark von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen bzw. bedroht sind. Es bleibt nur noch wenig Zeit, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die Umsetzung der COP28-Beschlüsse – dabei zentral die erstmalige Einigung auf die Abkehr von fossilen Brennstoffen – wird den Weg zur COP29 in Aserbaidschan im November 2024 prägen. Und es wird um eine gerechte Klimafinanzierung gehen. Vereinbart wurden In Dubai auch die Verdreifachung der erneuerbaren Energien und die Verdopplung der Energieeffizienz bis 2030. Im Rahmen der neuen Klimaaußenpolitik-Strategie plant Deutschland seine bilateralen Partnerschaften weiterzuentwickeln. Auch auf EU-Ebene stehen u.a. mit der Ausarbeitung des Klimaziels für 2040 wichtige Wegmarken bevor. Die Länder arbeiten 2024 an neuen Regelungen und Maßnahmen, um die EU-Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55% Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken.
Humanitäre Hilfe stärken - auch in Krisen abseits des Scheinwerferlichts
Humanitäre Hilfe bleibt integraler und prägender Bestandteil der deutschen Außenpolitik. Wir setzen uns ein für aktive zivile Krisenprävention und bleiben ein den humanitären Prinzipien verpflichteter Geber – und aktiver Mitgestalter des humanitären Systems. Denn der weltweite humanitäre Bedarf nimmt stetig zu – mehr Menschen denn je zuvor sind auf humanitäre Hilfe angewiesen – in Syrien, Sudan, im Sahel, in Afghanistan und anderswo. Gleichzeitig verschlechtern sich die Rahmenbedingungen für Hilfeleistung kontinuierlich: Immer wieder missachten Konfliktparteien die Regeln des humanitären Völkerrechts: der Zugang für Helferinnen und Helfer wird beschränkt oder sie selbst werden zum Ziel von Angriffen. Deshalb wird auch die humanitäre Diplomatie eine besondere Bedeutung behalten. In vielen Gesprächen und Verhandlungen setzen sich unsere Kolleginnen und Kollegen weltweit dafür ein, dass Konfliktparteien, Entscheidungsträger und Gestaltungsmächte stets im Interesse von Zivilbevölkerung und im Einklang mit den humanitären Prinzipien agieren.
Unser Anspruch: Deutschland als außenpolitische Gestaltungkraft auch im Jahr 2024
Wir treiben die Umsetzung der Nationalen Sicherheitsstrategie und der China-Strategie der Bundesregierung voran und setzen auf dieser Grundlage die Weichen für Deutschlands Rolle in Zeiten globaler Machtverschiebungen und systemischer Rivalität. Und wir setzen uns für die Gestaltung einer gerechten globalen Ordnung auf Grundlage des Rechts ein. In unseren auf gemeinsames Handeln ausgerichteten Zusammenarbeit mit unseren Partnern in Asien, Afrika und Lateinamerika können wir einiges in die Waagschale werfen: Deutschland ist nicht nur die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, sondern auch eine global führende Forschungsnation, leistet weltweit den zweitgrößten Beitrag zur humanitären Hilfe, ist bedeutender Unterstützer des UN-Systems und treibende Kraft in der internationalen Klimapolitik. Unsere Politik ist eigenbettet in starke Partnerschaften in EU, NATO, G7 und G20.
Was zum Jahreswechsel 2024 wichtig ist
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Der zweite Kriegswinter und die anhaltende russische Aggression in der Ukraine, der Terror der Hamas und die humanitäre Lage in Gaza, die Klimakrise und unsere globalen Partnerschaften, nicht nur für mehr Klimagerechtigkeiten, bleiben auch 2024 wichtige außenpolitische Handlungsfelder – so viel wissen wir. Außen- und Sicherheitspolitik wird aber oft vor allem durch das Unvorhergesehene geprägt. Entwicklungen zu antizipieren und vorausschauend Lösungsansätze für globale Herausforderungen zu entwickeln, wird auch 2024 eine der Kernaufgaben unserer Kolleginnen und Kollegen im Auswärtigen Amt und unseren Auslandsvertretungen in der ganzen Welt sein. Was 2024 sonst mit Sicherheit wichtig wird, haben wir hier für Sie zusammengefasst.
An der Seite der Ukraine: Gemeinsam mit unseren Partnern die Unterstützung mit Nachdruck fortsetzen
Auch diesen Winter bombardiert Russland gezielt zivile Infrastruktur, um den Ukrainerinnen und Ukrainern im Winter die Lebensgrundlagen zu entziehen. Die Bundesregierung unterstützt die Ukraine daher mit einem Winterpaket und plant für das Jahr 2024 die Militärhilfe auf 8 Milliarden Euro zu verdoppeln.
Die Ukraine wehrt sich mit enormen Mut gegen die russische Aggression und verteidigt auch unsere Freiheit: Seit April 2022 hat das Land mehr als die Hälfte der von Russland ursprünglich besetzten Gebiete befreit. Den ukrainischen Streitkräften ist es zudem Schritt für Schritt gelungen, die russische Marine über das Schwarze Meer zurückzudrängen und einen sicheren Schifffahrtskorridor zu öffnen, der es schon über 200 Schiffen ermöglicht hat, Getreide und andere Waren auf die Weltmärkte zu exportieren. Obwohl der Verteidigungskampf gegen Russland der Ukraine unglaublich viel abverlangt, hat sie eine beeindruckende Reihe interner Reformen eingeleitet, die die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen ermöglichen.
Hieran wird die Bundesregierung im Jahr 2024 anknüpfen. Im Juni richtet Deutschland die diesjährige Ukraine Wiederaufbaukonferenz aus. Ziel wird es sein, Wiederbau, Reformen und EU-Beitrittsprozess noch enger zu verzahnen.
Infobox: Einen Überblick über die deutschen nicht-militärischen Unterstützungsleistungen für die Ukraine finden Sie hier. Einen Überblick über die militärische Unterstützung finden Sie hier.
Israel und die palästinensischen Gebiete: Dauerhafter Frieden nur mit einer Zweitstaatenlösung
Der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober hat unglaubliches Leid über Israel gebracht und war eine Zäsur für den gesamten Nahen Osten. Nun bestimmt neben dem Schicksal der Geiseln, die noch immer in der Hand der Hamas sind, das furchtbare Leid der Menschen in Gaza die Schlagzeilen, weil sich die Hamas hinter der Zivilbevölkerung in Gaza verschanzt. Auch im neuen Jahr wird Krisendiplomatie gefragt sein, um einen regionalen Flächenbrand zu verhindern. Deutschland setzt sich energisch für neue humanitäre Pausen ein, um das katastrophale Leid der Menschen in Gaza zu lindern und Wasser, Nahrung und Medikamente zu den Menschen zu bringen. Und zugleich suchen wir den engen Austausch mit unseren arabischen Partnern. Katar und Ägypten haben sich als unverzichtbare Vermittler bewiesen, auch Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien spielen eine wichtige Rolle. Auch andere stehen bereit, um zu unterstützen. Der Schlüssel für den Frieden liegt vor Ort. Nur eine verhandelte Zweistaatenlösung kann dazu führen, dass Israelis und Palästinenser dauerhaft in Frieden und Sicherheit leben können. Diese Perspektive darf 2024 nicht aus dem Blick geraten.
75 Jahre NATO: Gemeinsam unsere Freiheit und Sicherheit bewahren
Die NATO ist zentraler Pfeiler der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Mit derzeit 31 Mitgliedern garantiert sie unsere Sicherheit und Stabilität im euroatlantischen Raum. Zuletzt ist Finnland im April 2023 der Allianz beigetreten. Nach der Ratifikation durch die Türkei und Ungarn wird Schweden 2024 folgen.
2024 steht im Zeichen des 75. Geburtstags der NATO. Die Allianz wurde im Jahr 1949 in Washington gegründet. Dort findet im Juli auch der „Jubiläums-Gipfel“ der Staats- und Regierungschefs statt.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat das Sicherheitsumfeld in Europa grundlegend verändert. Deutschlands Sicherheit ist untrennbar mit der Sicherheit seiner Alliierten verbunden. Darum arbeitet Deutschland beispielsweise auch 2024 mit Nachdruck weiter daran, erstmals eine permanent stationierte Brigade nach Litauen zu entsenden.
COP29 in Baku im Dezember 2024: Klimafinanzierung ausbauen und gerechter machen
Steigende Meeresspiegel, dramatisches Artensterben, neue Hitzerekorde – die Klimakrise zeigt sich weltweit. Schon heute leben über 3 Milliarden Menschen in Regionen, die stark von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen bzw. bedroht sind. Es bleibt nur noch wenig Zeit, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die Umsetzung der COP28-Beschlüsse – dabei zentral die erstmalige Einigung auf die Abkehr von fossilen Brennstoffen – wird den Weg zur COP29 in Aserbaidschan im Dezember 2024 prägen. Und es wird um eine gerechte Klimafinanzierung gehen. Vereinbart wurden In Dubai auch die Verdreifachung der Erneuerbaren Energien und die Verdopplung der Energieeffizienz bis 2030. Im Rahmen der neuen Klimaaußenpolitik-Strategie plant Deutschland seine bilateralen Partnerschaften weiterzuentwickeln. Auch auf EU-Ebene stehen u.a. mit der Ausarbeitung des Klimaziels für 2040 wichtige Wegmarken bevor. Die Länder arbeiten 2024 an neuen Regelungen und Maßnahmen, um die EU-Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55% Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken.
Humanitäre Hilfe stärken - auch in Krisen abseits des Scheinwerferlichts
Humanitäre Hilfe bleibt integraler und prägender Bestandteil der deutschen Außenpolitik. Wir setzen uns ein für aktive zivile Krisenprävention und bleiben ein den humanitären Prinzipien verpflichteter Geber – und aktiver Mitgestalter des humanitären Systems. Denn der weltweite humanitäre Bedarf nimmt stetig zu – mehr Menschen denn je zuvor sind auf humanitäre Hilfe angewiesen – in Syrien, Sudan, im Sahel, in Afghanistan und anderswo. Gleichzeitig verschlechtern sich die Rahmenbedingungen für Hilfeleistung kontinuierlich: Immer wieder missachten Konfliktparteien die Regeln des humanitären Völkerrechts: der Zugang für Helferinnen und Helfer wird beschränkt oder sie selbst werden zum Ziel von Angriffen. Deshalb wird auch die humanitäre Diplomatie eine besondere Bedeutung behalten. In vielen Gesprächen und Verhandlungen setzen sich unsere Kolleginnen und Kollegen weltweit dafür ein, dass Konfliktparteien, Entscheidungsträger und Gestaltungsmächte stets im Interesse von Zivilbevölkerung und im Einklang mit den humanitären Prinzipien agieren.
Unser Anspruch: Deutschland als außenpolitische Gestaltungkraft auch im Jahr 2024
Wir treiben die Umsetzung der Nationalen Sicherheitsstrategie und der China-Strategie der Bundesregierung voran und setzen auf dieser Grundlage die Weichen für Deutschlands Rolle in Zeiten globaler Machtverschiebungen und systemischer Rivalität. Und wir setzen uns für die Gestaltung einer gerechten globalen Ordnung auf Grundlage des Rechts ein. In unseren auf gemeinsames Handeln ausgerichteten Zusammenarbeit mit unseren Partnern in Asien, Afrika und Lateinamerika können wir einiges in die Waagschale werfen: Deutschland ist nicht nur die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, sondern auch eine global führende Forschungsnation, leistet weltweit den zweitgrößten Beitrag zur humanitären Hilfe, ist bedeutender Unterstützer des UN-Systems, treibende Kraft in der internationalen Klimapolitik. Unsere Politik ist eigenbettet in starke Partnerschaften in EU, NATO, G7 und G20.
Puan Klent auf Sylt: Großer Umbau von legendärem Jugenderholungsheim gescheitert
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Hunderttausende Hamburger kennen Puan Klent von Klassenreisen und Familienurlauben. Für eine Sanierung braucht das alte Jugenderholungsheim eine Finanzspritze in Millionenhöhe. Doch daraus wird wohl nichts...
Für mehr Ehrgeiz und Solidarität in der Klimakrise – Außenministerin Baerbock auf der COP28 in Dubai
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Für die Bundesregierung hat die Eindämmung der Klimakrise höchste Priorität. Sie setzt sich bei der 28. Weltklimakonferenz, der COP28, in den Vereinigten Arabischen Emiraten dafür ein, den internationalen Klimaschutz durch konkrete Vereinbarungen voranzubringen.
Seit dem ersten Tag der COP28 ist die Bundesregierung durch die Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik, Staatssekretärin Jennifer Morgan, in die Klimaverhandlungen eingebunden. Sie arbeitet bereits seit Monaten daran, dass wir für die Verhandlungen mit unseren Partnern weltweit gut aufgestellt sind.
Zum Start der COP28 war bereits der Bundeskanzler vor Ort. Auch andere Kabinettskolleginnen und -kollegen haben sich in die Verhandlungen eingebracht. Ab Donnerstag, den 7. Dezember, heißt es in Dubai Staffelübergabe: Außenministerin Baerbock wird in der Endphase der Weltklimakonferenz die Verhandlungsleitung für Deutschland übernehmen.
Wir brauchen dringend eine klare Kurskorrektur. Dafür werden wir in Dubai hart kämpfen, in den Verhandlungen auch noch am kleinsten Schräubchen drehen, wenn nötig.
- Außenministerin Annalena Baerbock
Mit Solidarität für mehr Klimaschutz
Schon am Starttag der COP28 wurden erste Nägel mit Köpfen gemacht: Deutschland und der Gastgeber, die Vereinigten Arabischen Emirate, verkündeten - als erste Geber überhaupt - jeweils 100 Millionen US-Dollar in den Fonds für Schäden und Verluste („Loss and Damage Fund“) einzuzahlen. Andere Länder wie die USA, Großbritannien, Japan, Italien, Dänemark und die EU zogen mit: über 700 Millionen Euro befinden sich so bereits im Fonds.
Anders als alle anderen Weltklimakonferenzen ist die COP28 gut aus den Startblöcken gekommen. Wir haben gleich am ersten Tag dem Fonds für Schäden und Verluste ins Leben geholfen. Darauf haben wir eineinhalb Jahre hingearbeitet. Hartnäckige Klimadiplomatie, die vorangeht und Bündnisse knüpft, zahlt sich aus.
- Außenministerin Annalena Baerbock
Die internationale Solidarität mit den Staaten, die besonders von der Klimakrise betroffen sind, ist eine der zentralen Vorhaben der Bundesregierung. Deshalb hatte sie sich im vergangen Jahr, auf der COP27 in Ägypten, sehr für die Einrichtung des „Loss and Damage Fund“ zum Umgang mit klimabedingten Schäden und Verlusten eingesetzt, mit dem die Weltgemeinschaft solidarisch Unterstützung bei der Bewältigung der Klimakrise leisten möchte. Das kann nur gelingen, wenn alle Staaten, die es sich als große Emittenten leisten können, finanziell zum Fonds beitragen. Auch dafür wird Außenministerin Baerbock in Dubai werben und verhandeln.
Raus aus den Fossilen, rein in die Erneuerbaren - weltweit
Das Ziel ist schon lange klar: Die globale Erderwärmung muss auf 1,5 Grad begrenzt werden. Bei der COP28 wird erstmals eine globale Bilanz darüber gezogen, wo wir heute beim Klimaschutz stehen. Leider wird jetzt schon deutlich: Wir sind nicht auf dem richtigen Weg. Die Klimaziele der Staaten und ihre bisherige Umsetzung reichen nicht aus.
Bei den Klimaverhandlungen in Dubai wird sich Außenministerin Baerbock als Verhandlungsführerin für die Bundesregierung gemeinsam mit der Europäischen Union dafür stark machen, dass sich die Staaten zu einem schrittweisen Ausstieg aus den fossilen Energien bekennen und die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Konkret setzen wir mindestens auf eine weltweite Verdreifachung der erneuerbaren Energien und eine Verdopplung der Energieeffizienz bis zum Jahr 2030.
Wenn wir es richtig angehen, dann stärken wir nicht nur den Klimaschutz, sondern geben Vertrauen zurück in eine Welt, in der Multilateralismus Ergebnisse schafft. Für uns alle.
- Außenministerin Annalena Baerbock
Weihnachten im Lichthof des Auswärtigen Amts
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

In diesem Jahr heißt Sie das Auswärtige Amt wieder herzlich im festlich dekorierten Lichthof willkommen. Ein gemütliches Ambiente lädt dabei vom 01. bis zum 22. Dezember zum Verweilen ein. Im Dezember haben wir für Sie unseren beliebten Weihnachts-Basar für den guten Zweck sowie kleine Konzerte geplant.
Der Lichthof ist ganzjährig von Montag bis Freitag jeweils von 07.00-19.00 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – kommen Sie einfach vorbei!
Der Einlass erfolgt über den Werderschen Markt 1 in 10117 Berlin. Aufgrund der Sicherheitskontrollen kann es zu kurzen Wartezeiten kommen. Der Zugang ist barrierefrei. Verpflegung finden Sie in unserem Coffee-Shop.
08. & 09. Dezember: Weihnachts-Basar
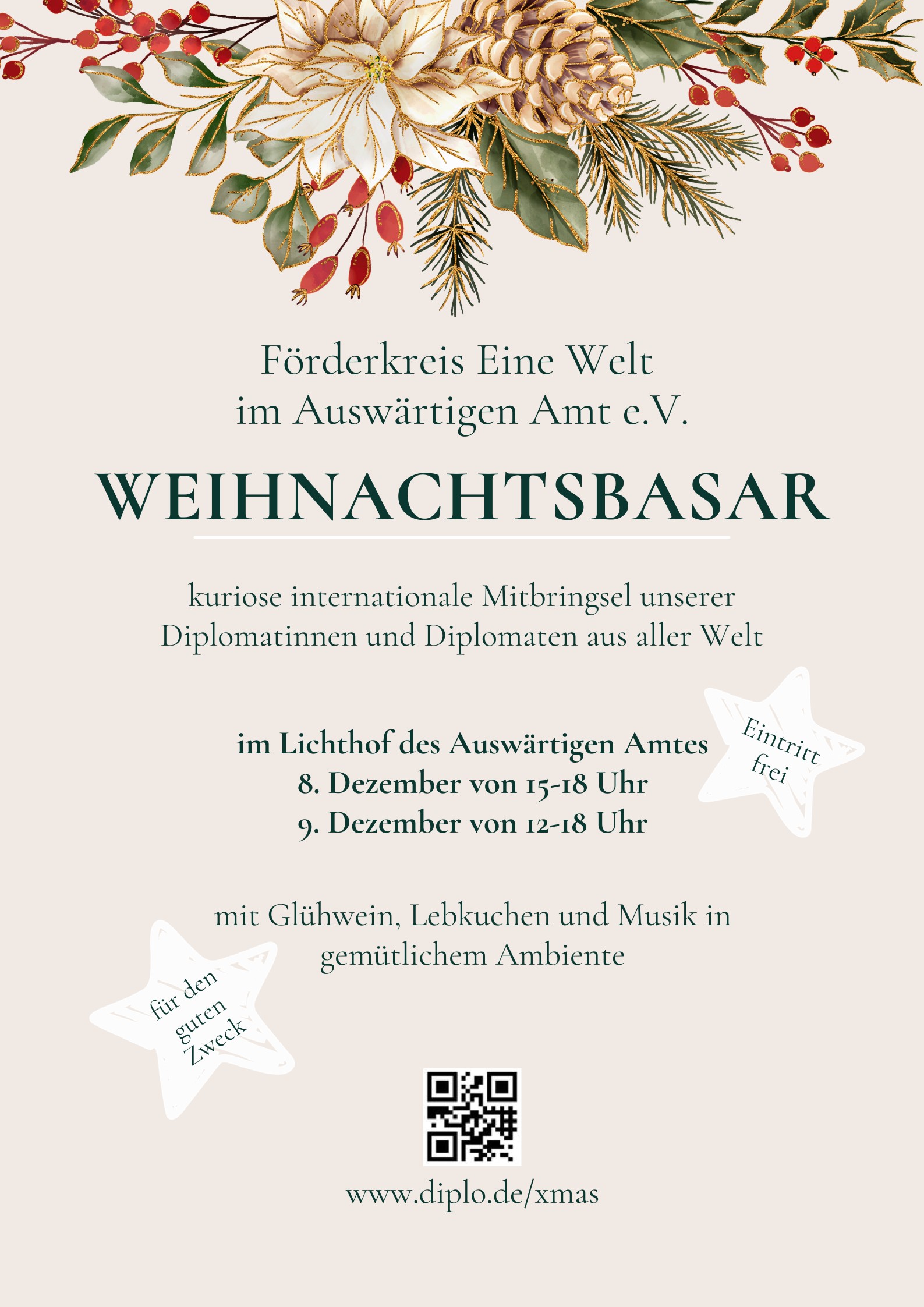 Sind Sie noch auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk für ihre Lieben? Dann besuchen Sie doch den Weihnachtsbasar im Lichthof des Auswärtigen Amts. Hier werden Sie garantiert fündig!
Sind Sie noch auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk für ihre Lieben? Dann besuchen Sie doch den Weihnachtsbasar im Lichthof des Auswärtigen Amts. Hier werden Sie garantiert fündig!
Weihnachtliche Marktstände
In der vorweihnachtlichen Zeit verwandelt sich der Lichthof des Auswärtigen Amtes in Berlin in einen Ort der Begegnung, des Austauschs und des Engagements. Für dieses alljährliche Event in der Weihnachtszeit spenden die Diplomatinnen und Diplomaten des Auswärtigen Amts ausgefallene und außergewöhnliche, neue und alte, triviale und seltene, kitschige und schöne Gegenstände aus aller Welt wie Bilder, Vasen, Schmuck und Textilien. Aber nicht nur die Mitbringsel aus aller Welt stehen auf dem Basar zum Verkauf, sondern auch Präsente, mit denen die Bundesaußenministerin oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Auswärtigen Amts in der Vergangenheit beschert wurden.
Der Verkaufserlös kommt dabei komplett dem Förderkreis Eine Welt im Auswärtigen Amt e.V. zugute, der Kleinstprojekte in den sich entwickelnden Ländern fördert. Informationen zum Förderkreis finden Sie hier.
Essen, Trinken und Unterhaltung
Für das leibliche Wohl ist gegen einen kleinen Obolus mit Glühwein, Kinderpunsch und weihnachtlichen Leckereien gesorgt. Ein kleines Musikprogramm sowie Malstation für Kinder runden den Besuch ab.
Lunchkonzerte
 An insgesamt sechs Tagen können Sie die Lunchkonzerte im Auswärtigen Amt besuchen. Diese kleinen musikalischen Einlagen sollen Ihnen die Mittagspause und den Nachmittag verschönern. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
An insgesamt sechs Tagen können Sie die Lunchkonzerte im Auswärtigen Amt besuchen. Diese kleinen musikalischen Einlagen sollen Ihnen die Mittagspause und den Nachmittag verschönern. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
- Beginn: jeweils um 13.00 Uhr
- Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Programm
- 11.12. Klaviermusik zu vier Händen - mit Werken von J.S. Bach, G. Rossini und J. Strauß
- 12.12. Trompetenklang und Weihnachtslieder
- 13.12. Liedermatinee zu Weihnachten - mit Werken von J.S. Bach, F. Schubert, S. Rachmaninow u.a.
- 14.12. Flötenklänge - mit Werken von J.S. Bach, P. Tschaikowsky, J. Haydn und E. Bozza
- 18.12. Celloklänge - mit Werken von A. Vivaldi, S. Rachmaninow, G. Fauré, J. Sibelius u.a.
- 19.12. Blechbläsermusik zu Weihnachten
Deutschland gibt sich Klimaaußenpolitikstrategie
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Der Text der Klimaaußenpolitikstrategie der Bundesregierung ist ab sofort hier abrufbar:
Klimaaußenpolitikstrategie der Bundesregierung (Deutsche Version)
Auf der 28. Weltklimakonferenz in Dubai verhandelt die Staatengemeinschaft derzeit konkrete Schritte gegen die Klimakrise. Es geht darum, die Erwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern.
Die Weltklimakonferenzen sind der sichtbarste Teil der internationalen Klimapolitik. Doch deren Instrumentenkasten ist sehr viel größer. Deutschland engagiert sich seit vielen Jahren auf der internationalen Bühne im Klimaschutz. Die neue Klimaaußenpolitikstrategie der Bundesregierung bündelt nun die klimapolitischen Ziele der verschiedenen Ministerien, richtet sie an gemeinsamen Prioritäten aus und schafft ein klares Gerüst für eine kohärente Klimaaußenpolitik.
Klimapolitik ist mehr als Umweltschutz - sie ist auch Politik für Innovation, Politik für den Wirtschaftsstandort und Politik für mehr Sicherheit. Und Klimapolitik ist in diesen geopolitisch herausfordernden Zeiten auch eine Chance, alte Gräben der Machtpolitik zu überwinden. Diejenigen Staaten, die zusammenarbeiten, die in der Klimapolitik etwas erreichen wollen, haben die Chance, alle zum Mitziehen zu bekommen und die Welt auf den überlebenswichtigen 1,5 Grad-Pfad zu führen. Und so in einer Welt, in der der globale Ordnungsrahmen immer stärker unter Druck kommt, einen Beitrag zur Stärkung des Multilateralismus zu leisten.
– Außenministerin Annalena Baerbock
Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, erklärt dazu:
Das Pariser Klimaabkommen setzen wir nur gemeinsam als internationale Gemeinschaft um. Deutschland legt daher jetzt als erstes Land eine Strategie für die eigene Klimaaußenpolitik vor.
Klimaschutz ist für unsere Regierung eine Querschnittsaufgabe. Dies gilt national, wie international. Wir sind dann am stärksten, wenn wir unsere unterschiedlichen Interessen im Klima-, Energie und Handelsbereich auf dem Weg in eine kohlenstofffreie Wirtschaft miteinander in Einklang bringen und mit unseren internationalen Partnern eng abstimmen. Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine hat gezeigt: eine sichere, klimaneutrale und kostengünstige Energieversorgung ist nicht nur wichtig, um der Klimakrise zu begegnen, sondern auch um unsere Versorgungssicherheit nach Innen und Außen auf ein starkes Fundament zu stellen und benachteiligten Regionen dieser Welt neue Wertschöpfung sowie eine sozial gerechtere Entwicklung zu ermöglichen. Das gehört nun auch zum Leitbild unserer Klimaaußenpolitik.
Die Klimaaußenpolitikstrategie ist die umfassendste Strategie dieser Art weltweit. Sie richtet Deutschlands Handeln klar am Übereinkommen von Paris aus und definiert sechs klimapolitische Handlungsfelder. Klima als Querschnittsaufgabe der Regierung wird auch institutionell verankert. So wird Deutschland sein Netzwerk an Auslandsvertretungen mit Klima-Schwerpunkt erweitern. Eine regelmäßige Runde von Staatssekretärinnen und Staatssekretären verschiedener Ministerien wird die Zusammenarbeit koordinieren und eine strategische Vorausschau sicherstellen. Denn Deutschland ist einer der größten Geber der internationalen Klimafinanzierung und damit einer der wichtigsten Partner in der grünen Transformation weltweit.
Die Strategie ist auch ein Zeichen an die Welt, dass Deutschland im internationalen Klimaschutz vorangeht und ein verlässlicher und solidarischer Partner ist. Deutschland sucht die Zusammenarbeit mit Schlüsselländern für den Klimaschutz, wie Brasilien, Indonesien, Senegal, Südafrika, Vietnam, Indien oder auch China. So wurde soeben erst bei den deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen in Berlin eine Partnerschaft für eine nachhaltige Transformation zwischen beiden Ländern beschlossen. Mit anderen wollen wir verstärkt im Energiebereich wie zum Beispiel Wasserstoff oder bei sozialen Fragen des Klimaschutzes kooperieren.
Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, erklärt dazu:
Klimaschutz gelingt nur als Gemeinschaftsprojekt. Gerade weil so vieles miteinander zusammenhängt, ist eine gute Abstimmung innerhalb der Bundesregierung so wichtig. Der Erfolg der Energiewende in Deutschland hängt auch von den Bedingungen in unseren Partnerländern ab, von denen wir zum Beispiel Rohstoffe beziehen für Batterien oder grünen Wasserstoff. Zugleich können wir viel dafür tun, dass der Klimaschutz in anderen Ländern gelingt. Das Entwicklungsministerium kann hier seine weltweiten Partnerschaften einbringen und wird sein politisches Engagement weiter ausbauen.
Steffi Lemke, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, erklärt:
Wir brauchen weltweit starke Partner, um der Größe der Herausforderungen durch die rasant voranschreitende Klimakrise gerecht zu werden. Dabei sollten wir konsequent Klimaschutz und Klimaanpassung mit dem Schutz der biologischen Vielfalt und der Bekämpfung von Umweltverschmutzung zusammendenken. Uns bleibt keine Zeit, die Krisen nacheinander anzugehen. Wir unterstützen daher weltweit unsere Partner beim Schutz ihrer Wälder, Moore und Mangroven. Mit der Klimaaußenpolitikstrategie der Bundesregierung kämpfen wir gemeinsam mit Partnern für umfassenden Klimaschutz. Denn: Naturschutz schützt das Klima, Klimaschutz schützt die Natur.
Für mehr Ehrgeiz und mehr Solidarität in der Klimakrise – Deutschland auf der COP28 in Dubai
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Stürme, Fluten, Dürren - überall auf der Welt nehmen dramatische Wetterereignisse zu und machen deutlich, dass die Klimakrise Lebensgrundlagen zerstört, Menschenleben bedroht und Konflikte verschärft. Für die Bundesregierung hat die Eindämmung der Klimakrise deswegen höchste Priorität. Sie setzt sich bei der 28. Weltklimakonferenz, der COP28, in den Vereinigten Arabischen Emiraten dafür ein, den internationalen Klimaschutz durch ehrgeizige Vereinbarungen voranzubringen.
Die Bundesregierung ist vom ersten Tag der COP28 an durch die Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik, Staatssekretärin Jennifer Morgan, in die Klimaverhandlungen eingebunden. Sie arbeitet bereits seit Monaten daran, dass wir für die Verhandlungen mit unseren Partnern weltweit gut aufgestellt sind. Außenministerin Baerbock übernimmt in der Endphase der Klimaverhandlungen dann die deutsche Verhandlungsleitung.
Die Klimakrise verschärft Konflikte weltweit. Sie bedroht unseren Wohlstand, unsere Entwicklungsfortschritte und in zunehmendem Maße unsere Sicherheit und damit unsere Freiheit.
- Außenministerin Annalena Baerbock
Erneuerbare Energien ausbauen
 Das Ziel ist schon lange klar: Die globale Erderwärmung muss auf 1,5 Grad begrenzt werden. Bei der COP28 in wird erstmals eine globale Bilanz darüber gezogen, wo wir heute beim Klimaschutz stehen. Leider wissen wir: Wir sind nicht auf dem richtigen Weg. Die Klimaziele der Staaten und deren bisherige Umsetzung reichen nicht aus.
Das Ziel ist schon lange klar: Die globale Erderwärmung muss auf 1,5 Grad begrenzt werden. Bei der COP28 in wird erstmals eine globale Bilanz darüber gezogen, wo wir heute beim Klimaschutz stehen. Leider wissen wir: Wir sind nicht auf dem richtigen Weg. Die Klimaziele der Staaten und deren bisherige Umsetzung reichen nicht aus.
Im Rahmen der zweiwöchigen Konferenz verhandeln Regierungsvertreterinnen und -vertreter aus aller Welt ein konkretes Arbeitsprogramm, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren und ehrgeizige nationale Reduktionsziele festzuschreiben. Neben den multilateralen Verhandlungen werden auch zahlreiche bilaterale Gespräche geführt, um die globale Energiewende voranzutreiben und den Ausstieg aus fossilen Energien zu beschleunigen.
Bei den Klimaverhandlungen in Dubai wird sich die Bundesregierung gemeinsam mit der Europäischen Union dafür stark machen, dass die Erneuerbaren ausgebaut werden. Konkret setzen wir mindestens auf eine weltweite Verdreifachung der Erneuerbaren Energien und eine Verdopplung der Energieeffizienz bis zum Jahr 2030.
In der Klimakrise niemanden alleine lassen
Die Menschen, die am Wenigsten für die Klimakrise können, trifft es häufig am Härtesten. Es braucht daher mehr Solidarität mit den Ländern, die besonders von der Klimakrise betroffen sind. Da reiche Industriestaaten für einen Großteil der Emissionen verantwortlich sind, haben diese sich zu größeren Beiträgen zur Finanzierung von Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen verpflichtet. Deutschland steht zu seinen Verpflichtungen und stellt jährlich mehr als 6 Milliarden Euro zur Verfügung. Wir sind außerdem zuversichtlich, dass die Industrieländer dieses Jahr erstmalig ihre Zusage, 100 Milliarden US-Dollar an Klimafinanzierung für Entwicklungsländern zur Verfügung zu stellen, erreichen werden.
Im vergangen Jahr, auf der COP27 in Ägypten, wurde ein neuer, spezieller Fonds zum Umgang mit klimabedingten Schäden und Verlusten („Loss and damage Fund“) beschlossen, mit dem die Weltgemeinschaft solidarisch Unterstützung bei der Bewältigung der Folgen der Klimakrise leisten möchte. Dieser muss nun möglichst rasch seine Arbeit aufnehmen und schrittweise befüllt werden. Das kann nur gelingen, wenn alle Staaten, die es sich leisten können und große Emittenten sind, finanziell zum Fonds beitragen.
Die Ziele, die wir uns für die COP gesetzt haben, zur Beschleunigung der Erneuerbaren und der Energieeffizienz, insbesondere aber beim schrittweisen Ausstieg aus den Fossilen, sie sind nicht nur ambitioniert, das sind nicht nur dicke Bretter, sondern bei all diesen Zielen klingt die Geopolitik immer mit.
- Außenministerin Annalena Baerbock
Mit geeinten Kräften für mehr Klimaschutz
Der Zivilgesellschaft kommt bei der Umsetzung der Klimaziele eine besondere Bedeutung zu. Im deutschen Pavillon wird es daher auch bei der COP28 zahlreiche Veranstaltungen zivilgesellschaftlicher Akteure geben.
Weitere Informationen zur COP28 und das Programm des deutschen Pavillons finden Sie hier:
Europa gemeinsam stärken: Außenministerin Baerbock besucht Slowenien
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Von München nach Ljubljana sind es mit dem Auto gerade mal 400 Kilometer – und damit weniger als von München nach Berlin. Wer von Deutschland aus einmal Urlaub an der Adriaküste gemacht hat, kennt die Hauptstadt Sloweniens mit ihrem malerischen barocken Zentrum vielleicht von einem Zwischenstopp.
Seit fast 20 Jahren ist Slowenien nun Mitglied der Europäischen Union. Mit seinen heute 2,1 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern ist das kleine Land am Südrand der Alpen ein enger Partner Deutschlands geworden. Auch auf der Weltbühne ist Slowenien sehr präsent: Das Land wird ab Januar für zwei Jahre Mitglied des UN-Sicherheitsrats sein.
Außenministerin Baerbock reist am 4. Dezember auf Einladung ihrer Amtskollegin Tanja Fajon nach Slowenien.
Die bilateralen Beziehungen zwischen Slowenien und Deutschland sind eng und vertrauensvoll. Als Slowenien im August von einer furchtbaren Flutkatastrophe heimgesucht wurde, war Deutschland als erstes Land vor Ort, um die Rettungskräfte mit Transporthubschraubern der Bundeswehr und zwei Behelfsbrücken des Technischen Hilfswerks zu unterstützen. Außenministerin Baerbock wird vor den Toren Ljubljanas ein Logistikzentrum besuchen, in dem Bergungsmaterial, Hochleistungspumpen, aber auch Schutzausrüstung der EU-Notfallreserve „rescEU“ gelagert werden.
Deutschland und Slowenien setzen sich dafür ein, die Europäische Union zu stärken und schrittweise zu erweitern – damit die EU auch weiterhin Sicherheit und Stabilität garantieren kann, wie sie es heute tut. In einer Diskussionsveranstaltung mit Studierenden zum Erweiterungs- und Reformprozess der EU werden beide Außenministerinnen über die EU-Perspektive des Westbalkans sprechen und sich zu Möglichkeiten austauschen, wie wir in der EU auch in Zukunft schnell und zukunftsfest Entscheidungen treffen können. Außenministerin Baerbock sagte vor ihrer Abreise am 4. Dezember 2023:
In einer Welt, in der sich Krisen und Konflikte in Europas unmittelbarer Nachbarschaft überlagern, brauchen wir eine Europäische Union, die auch morgen und übermorgen schnell und entschieden handelt und für uns alle in Europa Sicherheitsanker bleibt. Deutschland und Slowenien sind vereint in dem Ziel, unser gemeinsames Europa zu stärken, es fit für die Zukunft zu machen und die Länder des Westlichen Balkans in unsere Mitte aufzunehmen. Für uns ist eine starke Europäische Union genau wie die NATO eine unersetzliche Lebensversicherung in unsicheren Zeiten.
Für alle Länder des westlichen Balkans – das sind Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien – besteht die Perspektive eines Beitritts zur Europäischen Union. Klar ist dabei: Eine größere EU ist Notwendigkeit und Chance zugleich. Notwendigkeit, weil die EU nicht zulassen will und kann, dass in ihrer Nachbarschaft neue Krisenherde entstehen. Und Chance, weil eine größere EU Reformen benötigt. Dazu sagte Außenministerin Baerbock:
Die Länder des Westlichen Balkans gehören voll und ganz in unsere Europäische Union. Das ist keine Worthülse, sondern in unserem ganz eigenen Sicherheitsinteresse – in Ljubljana, in Berlin und in ganz Europa. Dafür braucht es die notwendigen Reformen in den Ländern, die Teil der europäischen Familie werden wollen. Zugleich muss die EU Wort halten und die nächsten Schritte im Erweiterungsprozess gehen, wenn die Bedingungen erfüllt sind.
Bei Ihrer Reise nach Ljubljana wird Außenministerin Baerbock auch von Ministerpräsident Robert Golob empfangen.
Deutschland und Slowenien arbeiten bei vielen Fragen eng zusammen. Gemeinsam setzen die beiden Länder einen am 1. Juli 2022 unterzeichneten deutsch-slowenischen Aktionsplan um, um entscheidende Zukunftsthemen voranzubringen: unter anderem die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit bei Energiefragen und die Stärkung des Jugendaustauschs. Im Jahr 2022 feierten Deutschland und Slowenien 30 Jahre diplomatische Beziehungen. Vor 31 Jahren hat Deutschland als erster EG-Mitgliedstaat Sloweniens Unabhängigkeit anerkannt.
Sinjar nach dem IS-Terror: Wie unterstützt das Auswärtige Amt Jesidinnen und Jesiden in Irak?
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Zerstörte Städte und Dörfer, vermintes Gelände, vergiftete Wasserquellen - das sind die Hinterlassenschaften der Terrorherrschaft des IS. Jesiden und Jesidinnen litten besonders unter diesem Schreckensregime.
Die Bundesregierung setzt sich gemeinsam mit ihren internationalen Partnern, den Vereinten Nationen und der irakischen Regierung vor Ort für verbesserte Lebensumstände der Jesidinnen und Jesiden und anderer Minderheiten in Irak ein. Das Auswärtige Amt begleitet über die Partnerorganisation IOM jesidische Überlebende der Gräueltaten des IS dabei, ihre Entschädigungsansprüche aus dem „Yazidi Survivors Law“ geltend zu machen. So können Männer und Frauen seit Anfang Oktober 2022 in Irak einen Antrag auf Entschädigung einreichen.
Jesidinnen und Jesiden eine Rückkehr in ihre Heimatorte ermöglichen
Das Auswärtige Amt unterstützt den irakischen Staat dabei, Jesiden und Jesidinnen, die vertrieben worden sind, eine Rückkehr in ihre Heimatorte zu ermöglichen und dort eine Zukunftsperspektive zu schaffen. Hier setzt der von Deutschland initiierte Fonds für Irak (FFS) an, oder auch der 500 Millionen Euro-Kredit der Bundesregierung für Irak. Ziel und Zweck des Geldes für Irak? Mit dem Geld werden in Sinjar z.B. die Stromversorgung und Straßen repariert, Abwasserkanäle, Schulen und Kindergärten wiederaufgebaut. Bei der Planung und Umsetzung dieser Projekte werden auch irakische staatliche Akteure auf der Provinzebene mit einbezogen.
Für ein Leben in Freiheit, Sicherheit und Würde
 Auch das vom Auswärtigen Amt geförderte IOM-Projekt „Community Policing“ ist im Distrikt Niniveh, darunter auch in Sinjar, an zahlreichen Standorten aktiv. Vertreter der Gemeinde und der Sicherheitsbehörden kommen mit deutscher Unterstützung zusammen, um über dringende Probleme zu beraten und Lösungen zu finden. Auf diese Weise sollen die Menschen Vertrauen in die Sicherheitskräfte fassen.
Auch das vom Auswärtigen Amt geförderte IOM-Projekt „Community Policing“ ist im Distrikt Niniveh, darunter auch in Sinjar, an zahlreichen Standorten aktiv. Vertreter der Gemeinde und der Sicherheitsbehörden kommen mit deutscher Unterstützung zusammen, um über dringende Probleme zu beraten und Lösungen zu finden. Auf diese Weise sollen die Menschen Vertrauen in die Sicherheitskräfte fassen.
Eine Rückkehr in und der Wiederaufbau der Heimatgebiete ist vielerorts zudem erst möglich, wenn Sprengfallen und Minen geräumt wurden. Der IS hat schwer kontaminierte Städte hinterlassen und Minen bewusst eingesetzt, um die Rückkehr der geflohenen Zivilbevölkerung zu erschweren und die Sicherheitslage weiter zu gefährden. Die Räumung von Landminen fördert das Auswärtige Amt über UNMAS im gesamten Land, aber explizit auch in der Region Sinjar. Somit werden vom IS verlassene und verminte Gebäude wieder bewohnbar gemacht und den Irakerinnen und Irakern als sicheres Zuhause zur Verfügung gestellt. Damit sich die irakische Bevölkerung in Zukunft selbst helfen kann, wird in diesem Projekt auch die lokale Bevölkerung ausgebildet und in Minenräumteams eingesetzt. In Sinjar haben sich im Rahmen der Ausbildungsmodule geschlechtergemischte und Teams mit gemischter religiöser Zugehörigkeit zur Minenräumung zusammengefunden.
Nicht zuletzt durch dieses deutsche Engagement konnten seit 2014 fast fünf Millionen Binnenvertriebene in ihre Heimatregionen zurückkehren.
Wie mit den erlebten Traumata umgehen?
Die Aufarbeitung der erlebten Traumata der Binnenvertriebenen in Irak, darunter viele Jesidinnen und Jesiden, ist von besonderer Bedeutung. Das Auswärtige Amt fördert die psychosoziale Betreuung von Opfern, u.a. über die JIYAN Stiftung im Raum Dohuk. Zudem wurde an der dortigen Universität mit Unterstützung des Landes Baden-Württemberg der erste Studiengang zur Ausbildung von Trauma-Therapeuten in Irak ermöglicht. Der Gruppe von Kindern jesidischer Frauen, die durch Vergewaltigung in IS-Gefangenschaft gezeugt wurden, widmet die Bundesregierung besondere Aufmerksamkeit. Deutschland wirbt für eine Integration der Kinder in die jesidische Gemeinschaft und hilft den Betroffenen bei der Verarbeitung erlebter Traumata sowie durch Aufnahmeprogramme.
Die strafrechtliche Aufklärung der IS Verbrechen
Vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte sieht Deutschland eine besondere Verantwortung für die Aufarbeitung schwerster Menschheitsverbrechen und unterstützt zu diesem Zweck bei der Dokumentation und juristischen Aufarbeitung der durch IS begangenen Gräueltaten. Accountability ist eine Grundvoraussetzung für Gerechtigkeit und einen nachhaltigen Frieden in der Heimatregion der jesidischen Gemeinschaft in Nineveh und Sinjar. Das Auswärtige Amt fördert die Arbeit des VN-Sonderermittlungsteams UNITAD (United Nations Investigative Team to Promote Accountability for Crimes Committed by Da’esh/ISIL) und anderer internationaler Partnerorganisationen zur Beweissicherung und Exhumierung von Massengräbern und zur Unterstützung der Suche nach Vermissten.
Hilfe für Vertriebene und Aufnahmegemeinden
 Noch immer leben 1,2 Millionen Menschen in Irak als Binnenvertriebene unter ihnen viele Jesidinnen und Jesiden. Um diese Menschen und auch die irakischen Gastgemeinden, die Geflüchtete aufgenommen haben, zu unterstützen, leistet das Auswärtige Amt in Irak humanitäre Hilfe. Dabei arbeitet das Auswärtige Amt zusammen mit internationalen Organisationen (UNHCR, IOM) sowie der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung. Ein konkretes Beispiel ist humanitäre Hilfe in Form von Bargeld für Binnenvertriebene, Flüchtlinge und Rückkehrende, die das Deutsche Rote Kreuz im Auftrag des Auswärtigen Amts landesweitet leistet, auch in Niniveh und insbesondere in Sinjar. Entscheidendes Kriterium für die Hilfeleistung ist der humanitäre Bedarf.
Noch immer leben 1,2 Millionen Menschen in Irak als Binnenvertriebene unter ihnen viele Jesidinnen und Jesiden. Um diese Menschen und auch die irakischen Gastgemeinden, die Geflüchtete aufgenommen haben, zu unterstützen, leistet das Auswärtige Amt in Irak humanitäre Hilfe. Dabei arbeitet das Auswärtige Amt zusammen mit internationalen Organisationen (UNHCR, IOM) sowie der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung. Ein konkretes Beispiel ist humanitäre Hilfe in Form von Bargeld für Binnenvertriebene, Flüchtlinge und Rückkehrende, die das Deutsche Rote Kreuz im Auftrag des Auswärtigen Amts landesweitet leistet, auch in Niniveh und insbesondere in Sinjar. Entscheidendes Kriterium für die Hilfeleistung ist der humanitäre Bedarf.
Kilian Schönberger über Caspar David Friedrich: Kann Deutschland heute noch Romantik?
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Deutschlands berühmtester Maler der Romantik feiert bald 250. Geburtstag. Fotograf Kilian Schönberger hat sich auf die Suche nach Caspar-David-Friedrich-Momenten gemacht – und Parallelen zur Selfie-Kultur entdeckt...
Blockadeversuchen zum Trotz – mit vereinten Kräften für eine zukunftsfähige OSZE
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ist die weltweit größte regionale Sicherheitsorganisation. Deutschland ist der zweitgrößte Beitragszahler für die OSZE hinter den USA. Die OSZE verfolgt einen umfassenden Sicherheitsbegriff mit „drei Dimensionen“. Neben der politisch-militärischen, sowie der wirtschaftlich und ökologischen Dimension sieht sich die OSZE auch der menschlichen Dimension verpflichtet: Ein prominentes Beispiel für die Demokratiearbeit der Organisation sind ihre Wahlbeobachtungsmissionen.
Dazu sagte Außenministern Baerbock:
Von Los Angeles bis Almaty, von Spitzbergen bis Istanbul - die OSZE ist ein Anker für Sicherheit und Zusammenarbeit für 1,3 Milliarden Menschen in 57 Teilnehmerstaaten. Seit ihrer Gründung fest vertäut mit ihren Grundpfeilern - dem Dialog und dem gemeinsamen Engagement - ist die OSZE ein einzigartiges Forum: unterschiedlichste Staaten, ob groß oder klein, eng verbunden oder neutral, sitzen gemeinsam am Tisch.
Die Mitgliedsstaaten der OSZE treffen ihre Beschlüsse einstimmig. Seit mehr als 650 Tagen macht sich dies Russland zu Nutze und versucht, immer wieder die OSZE zu blockieren. Die Verlängerung der vier Schlüsselpositionen in der OSZE, darunter die Generalsekretärin, die deutsche Diplomatin Helga Schmid, konnte bislang nicht verabschiedet werden. Es fehlt zudem ein regulärer Haushalt, so dass der OSZE nicht ausreichend Finanzmittel zur Verfügung stehen.
Außenministerin Baerbock unterstrich dazu:
Wir haben gemeinsam die Köpfe zusammengesteckt und mit Pragmatismus viele Projekte retten können, die aufgrund des fehlenden regulären OSZE-Haushalts vor dem Aus gestanden hätten - dank Sonderbeiträgen gerade auch aus Deutschland und von Freunden wie Japan. Das alles geht nur mit unglaublicher Kraftanstrengung und Überzeugung. Ich bin froh, mit Helga Schmid eine so erfahrene Diplomatin und Strategin an der Spitze der OSZE zu wissen.
Trotz Russlands Blockade der OSZE stehen 55 Teilnehmerstaaten klar für den Erhalt der OSZE ein, auf der Seite des Rechts, auf der Seite von Frieden und Sicherheit. Das, was Russland an der Organisation stört, ist gerade das, was sie für viele andere Mitgliedsstaaten - darunter Deutschland - auszeichnet: sie ist ein Zusammenschluss von 57 Staaten von Nordamerika über Europa bis nach Russland und Zentralasien, der dafür geschaffen wurde, Konflikte zu lösen und ein friedliches Zusammenleben für über eine Milliarden Menschen möglich zu machen. Ziel der OSZE ist es, die Sicherheit in Europa durch Zusammenarbeit zwischen den europäischen sowie den östlichen und westlichen Nachbarstaaten zu stärken.
Auch gegen erheblichen Gegenwind ist es der OSZE unter dem Vorsitz Nordmazedoniens 2023 gelungen, vieles voranzubringen:
 Die OSZE erweiterte thematisch und regional ihren Fokus. So wurden beispielsweise die Zusammenarbeit mit und in den zentralasiatischen Staaten dank des Einsatzes der Generalsekretärin Helga Schmid intensiviert, sowie ein Fonds zur Förderung von Klima und Sicherheit eingerichtet – zwei Beispiele von vielen, die deutlich machen, wie die Arbeit der OSZE Vertrauen schafft und Sicherheit für die Zivilbevölkerungen der einzelnen Staaten bringt.
Die OSZE erweiterte thematisch und regional ihren Fokus. So wurden beispielsweise die Zusammenarbeit mit und in den zentralasiatischen Staaten dank des Einsatzes der Generalsekretärin Helga Schmid intensiviert, sowie ein Fonds zur Förderung von Klima und Sicherheit eingerichtet – zwei Beispiele von vielen, die deutlich machen, wie die Arbeit der OSZE Vertrauen schafft und Sicherheit für die Zivilbevölkerungen der einzelnen Staaten bringt.
In Skopje wird Außenministerin Baerbock dafür werben, neben dem Vorsitz Maltas für 2024 auch die vier Spitzenpositionen zu verlängern:
Wenn die OSZE den Kurs der Sicherheit für die Menschen nehmen soll, dann müssen wir ihr auch das Rüstzeug und die Lotsen dafür geben, damit sie halbwegs arbeitsfähig bleibt und weitermachen kann – auch im rauen Wind. Dafür habe ich mich in den letzten Wochen mit Hochdruck eingesetzt, dafür fahre ich auch nach Skopje. Ich bin überzeugt, dass sich jede Mühe lohnt, um die OSZE zu erhalten.
Was ist die OSZE? Mehr Informationen finden Sie hier.
Humanitäre Pause nutzen – Deutschland hat Hilfe für Menschen in Gaza aufgestockt
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Am 22. November stimmte die israelische Regierung einer Vereinbarung zu, die die Freilassung einiger von der Hamas verschleppten Personen sowie eine humanitäre Feuerpause vorsieht. Seit dem 24. November wird die Feuerpause eingehalten. Am 27. November wurde sie um weitere zwei Tage verlängert.
Im Netzwerk „X“ schrieb die Außenministerin dazu am 27.11.:
Die Verlängerung der Feuerpause ist wertvolle Zeit, auch um unsere Hilfe zu den Menschen in Gaza zu bekommen. Und sie ist ein Hoffnungsschimmer, um nicht au s den Augen zu verlieren, was sein könnte: konkrete Schritte hin in eine sichere Zukunft für alle Menschen in der Region.
Bereits seit Wochen ist die humanitäre Lage in Gaza katastrophal. Nach dem brutalen Angriff der Terrororganisation Hamas auf den Staat Israel und seine Menschen am 7. Oktober leidet auch die Zivilbevölkerung in Gaza unter den Folgen des Terrors der Hamas. Die Basisversorgung für die Zivilbevölkerung ist zusammengebrochen und es fehlt dort hunderttausenden Menschen, unter ihnen vielen Kindern, am Allernötigsten: Lebensmittel, Wasser und medizinische Versorgung. Deshalb ist es wichtig, dass humanitäre Hilfe schnell und ungehindert an die Zivilbevölkerung in Gaza verteilt werden kann. Auch darum ging es bei den drei Reisen von Außenministerin Baerbock in die Region seit dem 7. Oktober.
Außenministerin Baerbock hat angekündigt, dass Deutschland seine humanitäre Hilfe für die Menschen in den Palästinensischen Gebieten aufstocken wird.
Auf einer Pressekonferenz in Amman sagte die Außenministerin am 19.10.:
Wir verstärken unsere Unterstützung für die Palästinenserinnen und Palästinenser, die auch Opfer dieses terroristischen Angriffs der Hamas geworden sind. Wir haben als deutsche Bundesregierung beschlossen, dass wir unsere humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza jetzt sofort um 50 Millionen Euro erhöhen.
Mit dem Geld unterstützen wir internationale Organisationen wie das Welternährungsprogramm, UNICEF, und vor allen Dingen auch UNWRA, damit die Menschen in Gaza mit Nahrungsmitteln versorgt werden können. Unsere Botschaft ist klar: Wir lassen die unschuldigen palästinischen Mütter, Väter und Kinder nicht alleine.
Am 11. November gab Außenministerin Baerbock in Ramallah bekannt, dass die Hilfe noch ein weiteres Mal um 38 Millionen Euro aufgestockt wird. Insgesamt beträgt die deutsche humanitäre Hilfe für die Palästinensischen Gebiete im Jahr 2023 somit rund 161 Millionen Euro.
Lebensmittel, Wasser, Medikamente und Hygieneartikel
Die Vereinten Nationen und das Rote Kreuz können mit den Geldern Menschen in ihrer Notlage versorgen. Konkret geht es um Grundnahrungsmittel, medizinische Versorgung und Hygieneprodukte.
Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge UNRWA erhält zusätzliche 44 Millionen Euro für Lebensmittelhilfe in Gaza. Damit können vor allem Grundnahrungsmittel wie Hirse, Reis, Kichererbsen und Öl verteilt werden. Mit weiteren 28,7 Millionen Euro kann das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen Menschen in Gaza und im Westjordanland mit Lebensmitteln versorgen. Über das Kinderhilfswerk UNICEF werden Kinder und ihre Familien in Gaza, der Westbank und in Ostjerusalem mit 5 Millionen Euro mit Hilfsgütern unterstützt. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz erhält zusätzliche 5 Millionen Euro für Verbandsmaterial und medizinische Verbrauchsgüter wie Spritzen und Kanülen, denn die medizinische Versorgung ist völlig überlastet. Mit 2,3 Millionen Euro kann das Deutsche Rote Kreuz gemeinsam mit dem Roten Halbmond Basisgesundheitsversorgung und Krisenunterstützung leisten. Darüber hinaus zahlt die Bundesregierung weitere 2,97 Mio. Euro in den humanitären Länderfonds der Vereinten Nationen ein, der von UN-OCHA verwaltet wird. Damit die Hilfe die Menschen erreicht, müssen humanitäre Zugänge gewährt werden. Am Grenzübergang Rafah stehen Hunderte Tonnen an Hilfsgütern für eine rasche Verteilung bereit.
Ernennung der deutschen Sondergesandten für humanitäre Hilfe im Nahen und Mittleren Osten
Außenministerin Baerbock hat die erfahrene Karrierediplomatin Deike Potzel zur deutschen Sondergesandten für humanitäre Hilfe im Nahen und Mittleren Osten ernannt. Damit fungiert sie u.a. als Counterpart des US-Sondergesandten David Satterfield und ist zentrale deutsche Ansprechpartnerin für die Akteure in der Region. Das Engagement der Sondergesandten bettet sich ein in die internationalen Bemühungen, die humanitäre Notlage in Gaza abzumildern, unter der die Zivilbevölkerung Gazas in Folge der Terrorangriffe der Hamas leidet.
Die Sondergesandte ist im Rahmen von humanitärer Pendeldiplomatie in der Region Ansprechpartnerin für UN-Organisationen (OCHA, UNRWA, WFP, UNICEF), das IKRK sowie internationale und regionale Partner. Zudem hält sie engen Kontakt zu den Verantwortlichen für humanitäre Hilfe in der Region sowie den Hauptstädten unserer Partner. Ihre Arbeit baut auf dem langjährigen deutschen humanitären Engagement und Bemühungen für Frieden und Stabilität in der Region auf.
Herbsttreffen der NATO-Außenministerinnen und -Außenminister in Brüssel
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Im Jahr 2024 feiert die NATO ihr 75-jähriges Bestehen als gemeinsame Allianz für Frieden und Sicherheit. Schon jetzt werden die Weichen für den Gipfel in Washington im Juli gestellt. Zur Rolle der NATO sagte Außenministerin Baerbock heute in Brüssel:
Wir haben in den letzten zwei Jahren auf dramatische Art und Weise erlebt, dass Sicherheit und Frieden auch in Europa tagtäglich aufs Neue wieder verteidigt werden müssen. Deswegen ist es so zentral, dass wir gerade in diesen Zeiten als NATO-Sicherheitsbündnis unser Schutzschild gemeinsam verstärken für Frieden, für Freiheit und Sicherheit in ganz Europa.
Lastenteilung ist wichtig für die Sicherheit aller Verbündeten
Beim Gipfel im Juli in Wilna vereinbarten die Verbündeten, jährlich mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu investieren.
Dazu betonte Außenministerin Baerbock vor der ersten Arbeitssitzung:
Das bedeutet auch, dass Deutschland im nächsten Jahr seine Zwei-Prozent-Verpflichtungen erfüllen wird, sowie auch etliche andere Länder das bis Juli nächsten Jahres in die Wege leiten werden. Sicherheit bedeutet aber viel mehr als allein ein Prozentziel am BIP orientiert. Deswegen wird die Frage von zukünftigen Gefahren heute auch eine entscheidende Rolle spielen, denn wir erleben gerade nicht nur mit Blick auf den russischen Angriffskrieg, sondern auch auf die Krisen in dieser Welt, dass die Sicherheit eben nicht nur im analogen Raum gefährdet ist, sondern auch im Cyberraum.
EU und NATO gemeinsam engagiert für die Sicherheit im Westlichen Balkan
An einer zweiten Arbeitssitzung nahm auch der Hohe Repräsentant der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, teil. Das Thema war die Lage auf dem Westlichen Balkan. Außenministerin Baerbock sagte dazu:
Gerade im Westlichen Balkan versuchen Akteure, immer wieder zu destabilisieren. Das betrifft eben nicht nur die Situation an der Grenze Kosovo-Serbien, sondern das betrifft auch die Situation in Bosnien und Herzegowina. Nicht nur die NATO, sondern insbesondere auch die EU ist einer der Garanten, um für Sicherheit auf dem Westlichen Balkan zu sorgen. Die Europäische Union ist unsere Lebensversicherung. Die NATO sichert für uns die Sicherheit in diesem europäischen Raum. Darum sind der Austausch und die Zusammenarbeit so zentral. Das NATO- und das EU-Engagement gehen Hand in Hand: beispielsweise bei EUFOR Althea in Bosnien und Herzegowina und NATO KFOR in Kosovo. Deutschland wird im nächsten Jahr bis zu 150 Soldatinnen und Soldaten zusätzlich in KFOR bereitstellen.
NATO-Ukraine Partnerschaft im Zentrum des Treffens
 In Wilna brachte die Allianz ein mehrjähriges Unterstützungsprogramm für die Ukraine auf den Weg. Ziel ist es, die Zusammenarbeit mit NATO-Streitkräften einfacher zu machen. Expertinnen und Experten sprechen hier von Interoperabilität. Zudem hat das Bündnis die politischen Beziehungen zur Ukraine auf eine neue Ebene gehoben und den NATO-Ukraine-Rat gegründet. Bei den Treffen dieses Rats sitzen die Mitglieder der NATO und des Partners Ukraine gleichberechtigt am Tisch und definieren gemeinsam das Arbeitsprogramm und die Agenda. Beim Außenministertreffen in Brüssel trifft sich der NATO-Ukraine Rat (NUC) erstmals auf Ebene der Außenministerinnen und Außenminister. Außerdem werden die Außenministerinnen und Außenminister die Komitee-Struktur des NUC für das kommende Jahr verabschieden.
In Wilna brachte die Allianz ein mehrjähriges Unterstützungsprogramm für die Ukraine auf den Weg. Ziel ist es, die Zusammenarbeit mit NATO-Streitkräften einfacher zu machen. Expertinnen und Experten sprechen hier von Interoperabilität. Zudem hat das Bündnis die politischen Beziehungen zur Ukraine auf eine neue Ebene gehoben und den NATO-Ukraine-Rat gegründet. Bei den Treffen dieses Rats sitzen die Mitglieder der NATO und des Partners Ukraine gleichberechtigt am Tisch und definieren gemeinsam das Arbeitsprogramm und die Agenda. Beim Außenministertreffen in Brüssel trifft sich der NATO-Ukraine Rat (NUC) erstmals auf Ebene der Außenministerinnen und Außenminister. Außerdem werden die Außenministerinnen und Außenminister die Komitee-Struktur des NUC für das kommende Jahr verabschieden.
Beitritt Schwedens: Ratifikation in Ungarn und Türkei steht noch aus
Auch Schweden ist auf dem Weg in die NATO. Bei diesem Treffen der NATO – wie bei den vergangenen Treffen – wird Schweden wieder als Gast mit dabei sein. Am 5. Juli 2022 hatten die NATO-Staaten die Beitrittsprotokolle für Schweden und Finnland gezeichnet. In der Türkei und in Ungarn stehen die Ratifikationen noch aus.
Außenministerin Baerbock unterstrich dazu:
Und es ist klar und deutlich in Wilna gesagt worden, dass Schweden Mitglied unserer gemeinsamen Allianz werden wird. Und das ist mehr als überfällig und deswegen muss dieser Schritt kommen.
Herbstreffen der NATO-Außenministerinnen- und Außenminister in Brüssel
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Im Jahr 2024 feiert die NATO ihr 75-jähriges Bestehen als gemeinsame Allianz für Frieden und Sicherheit. Schon jetzt werden die Weichen für den Gipfel in Washington im Juli gestellt. Zur Rolle der NATO sagte Außenministerin Baerbock heute in Brüssel:
Wir haben in den letzten zwei Jahren auf dramatische Art und Weise erlebt, dass Sicherheit und Frieden auch in Europa tagtäglich aufs Neue wieder verteidigt werden müssen. Deswegen ist es so zentral, dass wir uns gerade in diesen Zeiten als NATO-Sicherheitsbündnis unser Schutzschild gemeinsam verstärken für Frieden, für Freiheit und Sicherheit in ganz Europa.
Lastenteilung wichtig für die Sicherheit aller Verbündeten
Beim Gipfel im Juli in Vilnius vereinbarten die Verbündeten, jährlich mindestens 2% des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu investieren.
Dazu betonte Außenministerin Baerbock vor der ersten Arbeitssitzung:
Das bedeutet auch, dass Deutschland im nächsten Jahr seine 2 % Verpflichtungen erfüllen wird, sowie auch etliche andere Länder das bis Juli nächsten Jahres in die Wege leiten werden. Sicherheit bedeutet aber viel mehr als allein ein Prozentziel am BIP orientiert. Deswegen wird die Frage von zukünftigen Gefahren heute auch eine entscheidende Rolle spielen, denn wir erleben gerade nicht nur mit Blick auf den russischen Angriffskrieg, sondern auch auf die Krisen in dieser Welt, dass die Sicherheit eben nicht nur im analogen Raum gefährdet ist, sondern auch im Cyberraum.
EU und NATO gemeinsam engagiert für die Sicherheit im Westlichen Balkan
An einer zweiten Arbeitssitzung nahm auch der Hohe Repräsentant der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, teil. Das Thema war die Lage auf dem westlichen Balkan. Außenministerin Baerbock sagte dazu:
Gerade im westlichen Balkan versuchen Akteure, immer wieder zu destabilisieren. Das betrifft eben nicht nur die Situation an der Grenze Kosovo-Serbien, sondern das betrifft auch die Situation in Bosnien und Herzegowina. Nicht nur die NATO, sondern insbesondere auch die EU ist einer der Garanten, um für Sicherheit auf dem westlichen Balkan. Die Europäische Union ist unsere Lebensversicherung. Die NATO sichert für uns die Sicherheit in diesem europäischen Raum. Darum ist der Austausch und die Zusammenarbeit so zentral. Das NATO- und das EU-Engagement gehen ganz Hand in Hand: Beispielsweise bei EUFOR Althea in Bosnien und Herzegowina und NATO KFOR in Kosovo. Deutschland wird im nächsten Jahr bis zu 150 Soldatinnen und Soldaten zusätzlich in KFOR bereitstellen.
NATO-Ukraine Partnerschaft im Zentrum des Gipfels
In Vilnius brachte die Allianz ein mehrjähriges Unterstützungsprogramm für die Ukraine auf den Weg. Ziel ist es, die Zusammenarbeit mit NATO-Streitkräften einfacher zu machen. Expertinnen und Experten sprechen hier von Interoperabilität. Zudem hat das Bündnis die politischen Beziehungen zur Ukraine auf eine neue Ebene gehoben und den NATO-Ukraine-Rat gegründet. Bei den Treffen dieses Rats sitzen die Mitglieder der NATO und der Partner Ukraine gleichberechtigt am Tisch und definieren gemeinsam das Arbeitsprogramm und die Agenda. Beim Außenministertreffen in Brüssel trifft sich der NATO-Ukraine Rat (NUC) erstmals auf Ebene der Außenministerinnen und Außenminister. Außerdem werden die Außenminister die Komitee-Struktur des NUC für das kommende Jahr verabschieden
Beitritt Schwedens: Ratifikation in Ungarn und Türkei steht noch aus
Auch Schweden ist auf dem Weg in die NATO. Bei diesem Treffen der NATO – wie bei den vergangenen Treffen – wird Schweden wieder als Gast mit dabei sein. Vor neun Monaten, am 5. Juli 2022, hatten die NATO-Staaten die Beitrittsprotokolle für Schweden und Finnland gezeichnet. In der Türkei und in Ungarn stehen die Ratifikationen noch aus.
Außenministerin Baerbock unterstrich dazu:
Und es ist klar und deutlich in Vilnius gesagt worden, dass Schweden Mitglied unserer gemeinsamen Allianz werden wird. Und das ist mehr als überfällig und deswegen muss dieser Schritt kommen.
Great Barrier Reef: Unterwegs mit den Korallenrettern von Australien
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Der Klimawandel sorgt für massives Korallensterben. Doch Forscher sagen, der Tod des australischen Great Barrier Reef sei zu früh prophezeit worden. Wie sie um das Weltnaturerbe kämpfen – und dabei Touristen einbinden...
21. Vertragsstaatentreffen der Ottawa-Konvention – für eine Welt ohne Antipersonenminen
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Ob in Kolumbien, Südsudan oder der Ukraine – an zu vielen Orten auf der Welt machen Minen den Weg zur Schule, zum Brunnen oder zum nächsten Krankenhaus zu einem lebensgefährlichen Unterfangen. Minen verhindern, dass Felder bestellt und Dörfer wiederaufgebaut werden können. Antipersonenminen treffen besonders oft Zivilpersonen und zerreißen so selbst Jahre nach dem Ende von Kriegen und bewaffneten Konflikten im wahrsten Sinne des Wortes Familien und Gemeinschaften. 2022 wurden über 9.000 Menschen durch Minen und explosive Kampfmittelrückstände verletzt oder getötet.
Dazu sagte Staatsministerin Keul in Genf:
Landminen zerstören Lebensgrundlagen und behindern die sichere Rückkehr von Binnenvertriebenen. Die meisten Opfer sind Frauen und Kinder. Deshalb ist die Aufgabe klar: Die Räumung von Minen und die Unterstützung der Opfer führt zu Sicherheit, nachhaltiger Entwicklung und Versöhnung - kurz: zu einem Leben in Würde.
Deutschland hat 2023 Präsidentschaft der Ottawa-Konvention inne
Deshalb hat Deutschland sich im Rahmen seiner Präsidentschaft der Ottawa-Konvention für eine Welt ohne Antipersonenminen eingesetzt, und deswegen ist Deutschland zweitgrößter bilateraler Geber weltweit für humanitäres Minen- und Kampfmittelräumen, 2023 mit 70 Millionen Euro. Gefördert werden die Untersuchung und Räumung kontaminierter Flächen, aber auch Gefahrenaufklärung für die Bevölkerungen, Unterstützung für Minenopfer, etwa mit Prothesen und Physiotherapie, und Kapazitätsaufbau für nationale Stellen in betroffenen Staaten.
Dazu sagte Staatsministerin Keul in Genf:
Die Bundesregierung bleibt dem Ziel des Ottawa-Übereinkommens fest verpflichtet, die Vertragsstaaten bei der Bewältigung der neuen Herausforderungen und die betroffenen Bevölkerungsgruppen bei der Bewältigung der schwerwiegenden humanitären Folgen der Minenkontamination zu unterstützen. Dies ist für uns in unserer derzeitigen Rolle als Präsidentschaft des Übereinkommens von größter Bedeutung, und wir sind bereit, in diesem Sinne weiterzumachen, wenn unsere Präsidentschaft zu Ende geht.
Ottawa-Konvention 25 Jahre alt, aber aktueller denn je
Die Ottawa-Konvention gibt es bereits 25 Jahre. Wie beispielsweise Russlands Verminung von landwirtschaftlichen Flächen und Städten in der Ukraine zeigt, bleiben ihre Ziele aktueller denn je. Minenbetroffene Staaten sehen sich heute mit neuen Herausforderungen, wie improvisierten Landminen, die vor allem von nicht-staatlichen bewaffneten Gruppen eingesetzt werden, konfrontiert. Extreme Wettereinflüsse, beispielsweise Fluten, machen Minenräumung zunehmend schwieriger.
Die deutsche Präsidentschaft der Ottawa-Konvention hat einen Schwerpunkt auf den Erfahrungsaustausch zu genau diesen neuen Herausforderungen gelegt. Staatsministerin Keul unterstrich dazu:
Die Überprüfungskonferenz 2024 wird uns die Gelegenheit geben, einen Schritt zurückzutreten und die Instrumente, die uns zur Verfügung stehen, zu betrachten. Wir stehen vor neuen Herausforderungen:
- Wie gehen wir mit improvisierten Antipersonenminen um?
- Wie können wir die Räumung unter extremen Wetterbedingungen wie Überschwemmungen fortsetzen?
- Wie können wir die begrenzten Ressourcen optimal nutzen, wenn neue und laufende Kriege und Konflikte ständig zu zusätzlicher Kontamination führen, während in anderen Ländern die Hinterlassenschaften vergangener Konflikte noch immer Menschenleben bedrohen?
- Wie können wir eine integrative und konfliktsensible Art der Hilfe gewährleisten?
Um Antworten auf diese Fragen zu finden, haben wir diese Themen zu Prioritäten unserer Präsidentschaft gemacht.
Das Übereinkommen zum Verbot von Antipersonenminen (unterzeichnet Ende 1997 in Ottawa) zeigt, dass wirksames Handeln auf internationaler Ebene möglich ist. Es ist eine der erfolgreichsten Konventionen der humanitären Rüstungskontrolle und hat das humanitäre Völkerrecht entscheidend weiterentwickelt.
Deutschland stockt humanitäre Hilfe für die Menschen in den Palästinensischen Gebieten auf
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Die humanitäre Lage in Gaza ist nach dem brutalen Angriff der Terrororganisation Hamas auf den Staat Israel und seine Menschen am 7. Oktober katastrophal. Die Basisversorgung für die Zivilbevölkerung ist zusammengebrochen und es fehlt dort hunderttausenden Menschen, unter ihnen vielen Kindern, am Allernötigsten: Lebensmittel, Wasser und medizinische Versorgung. Deshalb ist es wichtig, dass humanitäre Hilfe schnell und ungehindert an die Zivilbevölkerung in Gaza verteilt werden kann. Auch darum ging es bei den drei Reisen von Außenministerin Baerbock in die Region seit dem 7. Oktober.
Außenministerin Baerbock hat angekündigt, dass Deutschland seine humanitäre Hilfe für die Menschen in den Palästinensischen Gebieten um insgesamt 88 Millionen Euro aufstocken wird.
Auf einer Pressekonferenz in Amman sagte die Außenministerin am 19.10.:
Wir verstärken unsere Unterstützung für die Palästinenserinnen und Palästinenser, die auch Opfer dieses terroristischen Angriffs der Hamas geworden sind. Wir haben als deutsche Bundesregierung beschlossen, dass wir unsere humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza jetzt sofort um 50 Millionen Euro erhöhen.
Mit dem Geld unterstützen wir internationale Organisationen wie das Welternährungsprogramm, UNICEF, und vor allen Dingen auch UNWRA, damit die Menschen in Gaza mit Nahrungsmitteln versorgt werden können. Unsere Botschaft ist klar: Wir lassen die unschuldigen palästinischen Mütter, Väter und Kinder nicht alleine.
Am 11. November gab Außenministerin Baerbock in Ramallah bekannt, dass die Hilfe noch ein weiteres Mal um 38 Millionen Euro aufgestockt wird. Insgesamt beträgt die deutsche humanitäre Hilfe für die Palästinensischen Gebiete im Jahr 2023 somit rund 161 Millionen Euro.
Lebensmittel, Wasser, Medikamente und Hygieneartikel
Die Vereinten Nationen und das Rote Kreuz können mit den Geldern Menschen in ihrer Notlage versorgen. Konkret geht es um Grundnahrungsmittel, medizinische Versorgung und Hygieneprodukte.
Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge UNRWA erhält zusätzliche 44 Millionen Euro für Lebensmittelhilfe in Gaza. Damit können vor allem Grundnahrungsmittel wie Hirse, Reis, Kichererbsen und Öl verteilt werden. Mit weiteren 28,7 Millionen Euro kann das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen Menschen in Gaza und im Westjordanland mit Lebensmitteln versorgen. Über das Kinderhilfswerk UNICEF werden Kinder und ihre Familien in Gaza, der Westbank und in Ostjerusalem mit 5 Millionen Euro mit Hilfsgütern unterstützt. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz erhält zusätzliche 5 Millionen Euro für Verbandsmaterial und medizinische Verbrauchsgüter wie Spritzen und Kanülen, denn die medizinische Versorgung ist völlig überlastet. Mit 2,3 Millionen Euro kann das Deutsche Rote Kreuz gemeinsam mit dem Roten Halbmond Basisgesundheitsversorgung und Krisenunterstützung leisten. Darüber hinaus zahlt die Bundesregierung weitere 2,97 Mio. Euro in den humanitären Länderfonds der Vereinten Nationen ein, der von UN-OCHA verwaltet wird. Damit die Hilfe die Menschen erreicht, müssen humanitäre Zugänge gewährt werden. Am Grenzübergang Rafah stehen Hunderte Tonnen an Hilfsgütern für eine rasche Verteilung bereit.
Mit den zusätzlichen Geldern hat Deutschland in diesem Jahr insgesamt rund 161 Millionen Euro für humanitäre Hilfe in den Palästinensischen Gebieten zur Verfügung gestellt. Mit der sorgfältigen Auswahl unserer erfahrenen internationalen Partner wird sichergestellt, dass sie unschuldige Zivilistinnen und Zivilisten in Not erreicht - und nicht die Terrororganisation Hamas. Um unsere Hilfe in dieser akuten Notsituation zu koordinieren und zu den Menschen in Gaza zu bringen, hat Außenministerin Baerbock Botschafterin Deike Potzel zur Sondergesandten des Auswärtigen Amts für humanitäre Hilfe im Nahen und Mittleren Osten ernannt.
Die Mitarbeitenden der Hilfsorganisationen leisten diese Hilfe auch unter hohen persönlichen Risiken. Wir setzen uns dafür ein, dass sie ihrer lebensrettenden Arbeit ungehindert und sicher nachgehen können.
Ernennung der deutschen Sondergesandten für humanitäre Hilfe im Nahen und Mittleren Osten
Außenministerin Baerbock hat die erfahrene Karrierediplomatin Deike Potzel zur deutschen Sondergesandten für humanitäre Hilfe im Nahen und Mittleren Osten ernannt. Damit fungiert sie u.a. als Counterpart des US-Sondergesandten David Satterfield. Das Engagement der Sondergesandten bettet sich ein in die internationalen Bemühungen, die humanitäre Notlage in Gaza abzumildern, unter der die Zivilbevölkerung Gazas in Folge der Terrorangriffe der Hamas leidet.
Die Sondergesandte ist im Rahmen von humanitärer Pendeldiplomatie in der Region Ansprechpartnerin für UN-Organisationen (OCHA, UNRWA, WFP, UNICEF), das IKRK sowie internationale und regionale Partner. Zudem hält sie engen Kontakt zu den Verantwortlichen für humanitäre Hilfe in der Region sowie den Hauptstädten unserer Partner. Ihre Arbeit baut auf dem langjährigen deutschen humanitären Engagement und Bemühungen für Frieden und Stabilität in der Region auf.
Außenministerin Baerbock beim EU-Rat in Brüssel: Fokus auf die Lage im Nahen Osten, Ukraine und Westbalkan
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Die katastrophale humanitäre Lage der Menschen in Gaza beschäftigt weiter die europäische und internationale Diplomatie. Außenministerin Baerbock wird heute im EU-Kreis über die Gespräche und Ergebnisse ihrer Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Saudi-Arabien, in die Palästinensischen Gebiete (Westjordanland) und nach Israel berichten. Dabei wird es unter anderem um Wege gehen, wie humanitäre Hilfe die palästinensische Zivilbevölkerung in Gaza zuverlässig erreichen kann. Zudem wird es um Wege gehen, wie eine mittel- und langfristige Zukunft für die Zivilbevölkerung des Gazastreifens aussehen kann. Außenministerin Baerbock und der US-Außenminister Antony Blinken hatten dafür am Rande des G7-Treffens Orientierungspunkte vorgeschlagen. Die EU setzt sich weiter für einen dauerhaften und nachhaltigen Frieden auf der Grundlage der Zweistaatenlösung ein. Denn nur so haben Israelis und Palästinenserinnen und Palästinenser die Perspektive auf ein Leben Seite an Seite – in zwei Staaten und in Frieden, Sicherheit und Würde:
Nach dem G7-Treffen in Tokyo erklärte Außenministerin Baerbock (8. November):
Wenn wir über den Tag hinausdenken, um eine Perspektive für eine Zweistaatenlösung zu geben, eine Perspektive für Gaza zu geben, da braucht es dafür klare Orientierungspunkte: Das heißt erstens, dass von Gaza keine terroristische Gefahr für Israels Sicherheit in Zukunft ausgehen darf. Das heißt zweitens, die Palästinenserinnen und Palästinenser dürfen aus Gaza nicht vertrieben werden. Das heißt drittens, dass es keine Besetzung von Gaza geben darf, sondern idealerweise einen internationalen Schutz. Das heißt viertens, dass keine territoriale Reduzierung von Gaza angestrebt werden darf. Das heißt fünftens, dass es keine Lösung über die Köpfe der Palästinenserinnen und Palästinenser hinweg geben darf und das Ganze gedacht werden muss in dem Verständnis, dass in Zukunft die Menschen in Israel und die Menschen in Palästina alle das Recht darauf haben, endlich in Frieden und Sicherheit zu leben.
Weitere wichtige Themen für die EU: Ukraine, Westbalkan sowie der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan
Auf der Tagesordnung des EU-Außenrats steht auch die Lage in der Ukraine und die weitere Unterstützung der EU und ihrer Mitgliedstaaten für das Land angesichts des russischen Angriffskriegs. Mit Blick auf den Winter geht es nun unter anderem darum, kritische Energie- und Wärmeinfrastruktur zu schützen. Auf ihrem Kurs in Richtung EU-Mitgliedschaft hat die Ukraine wichtige Reformen auf den Weg gebracht, unter anderem bei der Medien- und Oligarchengesetzgebung.
Die Bundesregierung steht voll und ganz an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer auf ihrem Weg in die Europäische Union. Außenministerin Baerbock sagte anlässlich der Empfehlung der EU-Kommission, die Beitrittsgespräche mit der Ukraine zu beginnen: „Die Menschen in der Ukraine gehören zur europäischen Familie. Der Beginn der EU-Beitrittsgespräche ist der nächste Schritt, den wir gemeinsam gehen sollten. Denn eine stärkere, größere und geschlossene EU ist die geopolitische Antwort auf Russlands Angriffskrieg“ (8. November).
Am Nachmittag wird es in Brüssel zudem einen Austausch der EU-Außenministerinnen und Außenminister mit ihren Amtskolleginnen und Amtskollegen aus den sechs Staaten des Westlichen Balkans geben: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien. Alle sechs Staaten befinden sich auf dem Weg in die EU. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die schnelle Annäherung der Region an die EU zu einer geopolitischen Notwendigkeit gemacht. Fortschritte bei diesem Weg in die EU sind entscheidend – dafür braucht es Reformen in den Kandidatenländern, aber auch Geschlossenheit und Zusammenhalt innerhalb der EU. Auf eine Erweiterung auf eines Tages über 30 Mitgliedstaaten muss sich die EU zudem mit Reformen vorbereiten.
Auch der weiter schwelende Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan steht in Brüssel auf der Tagesordnung. Nach dem militärischen Vorgehen Aserbaidschans in der völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehörenden Region Bergkarabach vor einigen Wochen sind viele der Bewohnerinnen und Bewohner aus Bergkarabach nach Armenien geflohen – nach Angaben des VN-Flüchtlingskommissariats UNHCR über 100.000 Menschen. An der armenisch-aserbaidschanischen Grenze ist die EU mit einer zivilen Mission vertreten. Außenministerin Baerbock wird in Brüssel von ihrer Reise nach Armenien und Aserbaidschan berichten, bei der sie auch die EU-Beobachtungsmission besucht hatte. Diese hat die Lage vor Ort im Blick und trägt zur Stabilität in den Grenzgebieten Armeniens bei – eine wichtige Voraussetzung für den Einstieg in einen Friedensplan und eine Normalisierung der Beziehungen beider Länder.
»Iron Curtain Trail«: Abenteurerin Rebecca Maria Salentin über ihre Reise durch Osteuropa
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Knapp 10.000 Kilometer durch 20 Länder: Der Fahrradweg Iron Curtain Trail folgt dem Verlauf des Eisernen Vorhangs von der Barentssee bis zum Schwarzen Meer. Rebecca Maria Salentin ist ihn abgefahren...
Alle Gesprächskanäle nutzen: Außenministerin Baerbock bricht zu erneuter Nahost-Reise auf
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Einen Monat ist der bewaffnete Angriff der Terrororganisation Hamas auf den Staat Israel jetzt her. Ein Monat, der im Nahen Osten tiefe Wunden hinterlassen hat. Die Bilder der Menschen vor Ort lassen niemanden kalt: Die Verzweiflung der israelischen Familien, die noch immer um ihre von der Hamas verschleppten Kinder bangen. Der Schmerz der Angehörigen, die ihre Liebsten beim Angriff der Hamas verloren haben. Und zugleich: Die katastrophale humanitäre Lage in Gaza, die tausenden Toten und Verletzten, die von der Hamas mutwillig als menschliche Schutzschilde missbraucht werden.
Mit ihrem Terror will die Hamas einen Keil in die Weltgemeinschaft treiben, die vorsichtigen Annäherungsschritte Israels mit einigen arabischen Nachbarn zunichte machen. Daher ist es umso wichtiger, jetzt alle Gesprächskanäle zu nutzen, um einen drohenden Flächenbrand in der Region zu verhindern. Außenministerin Baerbock reist daher am 10. November erneut in die Region, u.a. um die Lage im Nahen Osten mit ihren Amtskollegen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Katar zu besprechen. Dabei wird es natürlich auch um unsere Bemühungen um eine Freilassung der deutschen Geiseln gehen.
Außenministerin Baerbock sagte vor ihrer Abreise am 10. November 2023:
Die historische Chance eines Friedens Israels mit seinen arabischen Nachbarn darf nicht kaputtgehen. Denn genau das ist das Ziel der Terroristen. Und auch bei unseren Bemühungen um die Freilassung der Geiseln, um humanitäre Zugänge nach Gaza oder der Verhinderung eines regionalen Übergreifens der Gewalt – wir haben nur Aussicht auf Erfolg, wenn wir zusammen mit den arabischen Golfstaaten an einem Strang ziehen.
 Nach den Gesprächen in den Golfstaaten wird Außenministerin Baerbock nach Israel weiterreisen. Für die Ministerin ist es bereits der dritte Besuch in Israel seit dem bewaffneten Angriff der Hamas am 7. Oktober. Es kommt somit zum Wiedersehen mit ihrem israelischen Amtskollegen Eli Cohen, dem Baerbock erneut die Solidarität Deutschlands versichern wird.
Nach den Gesprächen in den Golfstaaten wird Außenministerin Baerbock nach Israel weiterreisen. Für die Ministerin ist es bereits der dritte Besuch in Israel seit dem bewaffneten Angriff der Hamas am 7. Oktober. Es kommt somit zum Wiedersehen mit ihrem israelischen Amtskollegen Eli Cohen, dem Baerbock erneut die Solidarität Deutschlands versichern wird.
Dass Israel am 9. November angekündigt hat, humanitäre Feuerpausen für den Gaza-Streifen einzuführen, ist ein Hoffnungsschimmer. Zuvor hatte unter anderem der Kreis der G7-Staaten bei einem Treffen in Tokio ebensolche humanitäre Pausen gefordert. Sie bilden die Grundlage dafür, dass die Menschen im Gaza-Streifen mit dem Nötigsten versorgt und ihr Leid gelindert werden kann.
Dazu sagte Außenministerin Baerbock:
Israel kann bei der Verteidigung gegen den Terror der Hamas fest und unverbrüchlich auf Deutschland zählen. Als Demokratien stehen wir Schulter an Schulter. Selbstverständlich muss Israel alles in seiner Macht Stehende tun, um Zivilisten zu schützen. Dies gilt auch dann, wenn die Hamas sich weiter hinter Hunderttausenden von Zivilisten verschanzt und sich bewusst direkt unter Schulen und Krankenhäusern vergräbt.
Selbst wenn politische Lösungen gerade in unerreichbarer Ferne scheinen: Auch in der aktuellen Krisensituation ist es wichtig, eine nachhaltige Lösung nicht aus dem Blick zu verlieren. Für die Menschen im Nahen Osten braucht es einen tragfähigen Frieden; Israelis und Palästinenser müssen in Frieden, Sicherheit und Würde Seite an Seite leben können. Dazu bedarf es einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung; und diese gelingt nur unter der Beteiligung aller Staaten in der Region.
Seit dem bewaffneten Angriff der Hamas auf Israel ist Außenministerin Baerbock bereits zwei Mal in die Region gereist: Am 13. und 14. Oktober nach Israel und Ägypten, vom 19. bis 21. Oktober nach Jordanien, Israel und Libanon sowie zum “Cairo Summit for Peace” in Ägypten. Die Bundesregierung hat ihre humanitären Mittel für die Menschen in Gaza seitdem auf 123 Mio. EUR erhöht.
Kakadu-Nationalpak im Northern Territory: Schwimmen, wo Australiens Krokodile wohnen
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Tausende von Salzwasserkrokodilen sind im Kakadu-Nationalpark Attraktion und Gefahr zugleich. Wie Ranger die Wanderpfade zu Wasserfällen und Badeplätzen absichern – und warum ein Restrisiko bleibt...
Enge Partner in Krisenzeiten: Treffen der G7-Außenministerinnen und Außenminister in Tokyo
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Anfang des Jahres übernahm Japan den G7-Vorsitz von Deutschland. Gegen Ende der japanischen Präsidentschaft findet nun am 7. und 8. November 2023 in Tokyo ein erneutes Treffen der Außenministerinnen und Außenminister statt. Auf der Agenda stehen die aktuellen geopolitischen Themen und Krisen. Dazu gehört natürlich der Konflikt im Nahen Osten, aber auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die Zusammenarbeit im Indopazifik, wo die Spannungen zunehmen.
Außenministerin Annalena Baerbock dazu:
Die G7 haben sich zu einem dynamischen Arbeitsmotor entwickelt, der über Nordamerika, Europa und Asien hinweg gemeinsam Dinge vorantreibt: Wir sind dabei, 600 Milliarden Dollar in wichtige globale Infrastrukturinvestitionen zu lenken. Wir haben die Mittel für die Weltbank und den IWF nach oben geschraubt, um unseren Partnern Alternativen zu Chinas Finanzinstrumenten an die Hand zu geben. Aber es geht auch darum, dass wir an Vertrauen bei Ländern aus Südamerika, Afrika, Asien hinzugewinnen. Ich will, dass wir uns als G7 an die Spitze derjenigen setzen, die die internationale Ordnung gerechter und nachhaltiger gestalten und in diesem Sinne weiterentwickeln. Dafür ist vor allem wichtig, dass wir genau zuhören, was die Anliegen unserer globalen Partner sind.
Auftakt-Thema des Treffens wird die aktuelle Lage im Nahen Osten sein.
Außenministerin Annalena Baerbock dazu:
Als G7 haben wir den abscheulichen Hamas-Terror verurteilt und unterstreichen das Recht Israels, sich im Rahmen des Völkerrechts zu verteidigen. Wir schauen zutiefst besorgt auf die katastrophale Notlage der Männer, Frauen und Kinder im Gazastreifen. Als G7 stellen wir rund zwei Drittel der Finanzierung des Palästinenser-Hilfswerks UNRWA sicher. Wir sind damit die entscheidenden Geber für humanitäre Hilfe für die Palästinenser und das schon seit Jahren.
Die Außenministerin wirbt dafür, dass sich auch andere finanzkräftige Geber stärker bei UNRWA engagieren. Thema in Tokyo werden auch die nächsten Schritte sein:
Wir werden darüber sprechen, wie wir jetzt mit vereinten Kräften humanitäre Pausen erreichen können, um die Not der Menschen in Gaza zu lindern. Für mich ist dabei klar: Die Terroristen der Hamas haben mit den grauenhaften Anschlägen vom 07. Oktober unendliches Leid über Israel und die palästinensische Zivilbevölkerung in Gaza gebracht. Die Hamas darf nicht weiter das Schicksal der Menschen im Gaza-Streifen bestimmen.
Auch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine bleibt ganz oben auf der G7-Agenda. Denn dort steht für Europa und die ganze Welt viel auf dem Spiel. Jetzt geht es darum, nicht nachzulassen bei der Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf.
Weiten Raum in den Arbeitssitzungen werden auch die zunehmenden Spannungen im Indopazifik einnehmen und der Umgang mit China.
Außenministerin Annalena Baerbock dazu:
Im Indopazifik weht der Wind spürbar rauer. Gleichzeitig wird die Region wirtschaftlich und politisch immer einflussreicher. Dort laufen mittlerweile starke wirtschaftliche und politische Kraftlinien zusammen. Japan hat dieses Thema zurecht zum Schwerpunkt seiner Präsidentschaft gemacht. Wir haben seit dem 24. Februar 2022 schmerzvoll gelernt, wie aus aggressiver Rhetorik oder Phantasielandkarten gefährliche Realität werden kann. Wir müssen heute gemeinsam dafür arbeiten, dass keine neuen Kriegsschauplätze entstehen, deren Schockwellen uns alle erschüttern würden.
Der informelle Charakter des G7-Treffens erlaubt den Ministerinnen und Ministern einen sehr engen und vertrauensvollen Austausch. Am Rande der Konferenz sind zudem bilaterale Gespräche von Außenministerin Baerbock mit Amtskolleginnen und -kollegen geplant, darunter mit der japanischen Außenministerin und Gastgeberin Yoko Kamikawa.
Zum Jahreswechsel übernimmt dann Italien von Japan den G7-Vorsitz.
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die Vereinigten Staaten arbeiten seit Mitte der 1970er Jahre in der Gruppe der Sieben (G7) zusammen. Außerdem nimmt die EU an den Treffen der Gruppe teil. Themen sind Weltwirtschaft, Außen- und Sicherheitspolitik, Entwicklung und Klima. Die G7 bieten dabei ein Forum zum informellen - und damit sehr offenen - Austausch zu aktuellen Herausforderungen. Die gemeinsamen Werte verbinden die teilnehmenden wirtschaftsstarken Demokratien hierbei und ermöglichen vielfach eine gemeinsame und klare Positionierung, z.B. zu akuten Krisen in der Außen- und Sicherheitspolitik. Die G7 sind keine internationale Organisation und verfügen über keine festen Strukturen wie ein Sekretariat. Stattdessen bereitet der Vorsitz die verschiedenen Treffen vor. Die jährlichen Gipfeltreffen, zu denen die Präsidentschaft die Staats- und Regierungschefs üblicherweise zur Jahresmitte einlädt, sind die sichtbarsten Zusammenkünfte. Darüber hinaus sind zwei physische Treffen der Außenministerinnen und -minister im Jahr üblich.
Europakonferenz in Berlin: Für ein größeres, stärkeres Europa
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Wie kann ein größeres, stärkeres Europa aussehen? Wie sollte sich die EU in Zeiten tiefgreifender geopolitischer Veränderungen strategisch aufstellen? Wie können die Beitrittsaspiranten auf ihrem Weg in die EU unterstützt werden? Diese Themen stehen im Mittelpunkt der Konferenz, zu der Außenministerin Annalena Baerbock heute (02.11.) unter dem Motto „A larger, stronger Union – making the European Union fit for enlargement and future members fit for accession“ einlädt. Erwartet werden hochrangige Gäste aus den EU-Mitgliedstaaten, aus Staaten im Beitrittsprozess, aus den EU-Institutionen sowie aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft.
Geopolitische Herausforderungen nehmen zu
Die Europakonferenz findet zu einem entscheidenden Moment statt: Die Außenministerinnen und Außenminister treffen sich vor dem Hintergrund enormer außen- und sicherheitspolitischer Herausforderungen.
 Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist eine neue geopolitische Lage entstanden, auf die Europa mit bis dato kaum bekannter Geschlossenheit reagiert hat. Die Ukraine, Georgien und die Republik Moldau erhielten in der Folge die EU-Perspektive und traten damit zur Gruppe der sechs Westbalkanstaaten und der Türkei hinzu. Zugleich machen die brutalen Terrorangriffe der Hamas auf Israel seit dem 7. Oktober einmal mehr die Notwendigkeit deutlich, dass die EU als internationaler Akteur geschlossen auftritt und handlungsfähig bleibt.
Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist eine neue geopolitische Lage entstanden, auf die Europa mit bis dato kaum bekannter Geschlossenheit reagiert hat. Die Ukraine, Georgien und die Republik Moldau erhielten in der Folge die EU-Perspektive und traten damit zur Gruppe der sechs Westbalkanstaaten und der Türkei hinzu. Zugleich machen die brutalen Terrorangriffe der Hamas auf Israel seit dem 7. Oktober einmal mehr die Notwendigkeit deutlich, dass die EU als internationaler Akteur geschlossen auftritt und handlungsfähig bleibt.
Reformen und Erweiterung gehen Hand in Hand
Die künftige Rolle der Europäischen Union als starke Stimme in der Welt wird maßgeblich davon abhängen, wie erfolgreich die EU sich reformiert und auf künftige Erweiterungsrunden vorbereitet.
Die Frage ist inzwischen nicht mehr, ob eine EU-Erweiterung stattfinden wird, sondern „wie“ und „wann“ dies geschieht.
Ganz im Geiste einer „Arbeitskonferenz“ diskutieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über interne Reformen, die die Handlungsfähigkeit der EU stärken, genauso wie über notwendige Reformanstrengungen in Staaten, die den EU-Beitritt anstreben. Eine Erweiterung kann nur dann erfolgreich sein, wenn die vergrößerte EU auch gestärkt aus ihr hervorgeht.
Enge Zusammenarbeit mit spanischer EU-Ratspräsidentschaft
 Das heutige Treffen gliedert sich in mehrere Abschnitte. Außenministerin Baerbock eröffnet die Konferenz mit einer Rede zu Europa. Darauf folgen ein Expertenvortrag und eine Podiumsdiskussion auf Außenministerebene. Während sich im Anschluss die Außenministerinnen und Außenminister in nicht öffentlichen Arbeitsgruppen zu vertieften Beratungen zurückziehen, diskutiert die Staatsministerin für Europa und Klima, Anna Lührmann, in einem Panel zu konkreten EU-Reformthemen.
Das heutige Treffen gliedert sich in mehrere Abschnitte. Außenministerin Baerbock eröffnet die Konferenz mit einer Rede zu Europa. Darauf folgen ein Expertenvortrag und eine Podiumsdiskussion auf Außenministerebene. Während sich im Anschluss die Außenministerinnen und Außenminister in nicht öffentlichen Arbeitsgruppen zu vertieften Beratungen zurückziehen, diskutiert die Staatsministerin für Europa und Klima, Anna Lührmann, in einem Panel zu konkreten EU-Reformthemen.
Die Europakonferenz im Auswärtigen Amt wird in enger Abstimmung mit der spanischen EU-Ratspräsidentschaft organisiert. Sie findet kurz vor der Veröffentlichung des nächsten Erweiterungsberichts durch die EU-Kommission statt. Die Konferenz spannt einen Bogen von den aktuellen Diskussionen zu EU-Erweiterung und –Reformen bis zum Europäischen Rat Ende des Jahres, bei dem die Staats- und Regierungschefs der EU über die nächsten Schritte entscheiden wollen.
Lage im Nahen Osten im Fokus der Diplomatie: Außenministerin Baerbock reist zum EU-Außenrat und nach New York
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Das Konfliktpotential im Nahen Osten und die humanitäre Lage der Menschen in Gaza beschäftigt weiter die internationale Krisendiplomatie. Außenministerin Baerbock wird heute im EU-Kreis über die Lage sprechen, dabei für eine einheitliche Linie werben und weitere Schritte koordinieren. Dabei wird es unter anderem um die humanitäre Hilfe für die palästinensische Zivilbevölkerung in Gaza gehen. Dass am Samstag erste Hilfslieferungen über Rafah in den Gaza-Streifen gelangten, war „ein Zeichen der Hoffnung in diesen schwierigen Stunden“, so Außenministerin Baerbock.
Deutschland, als weltweit zweitgrößtes Geberland humanitärer Hilfe, hat seine Soforthilfe für die Palästinenserinnen und Palästinenser angesichts der Lage um weitere 50 Mio. Euro erhöht. Auch die EU hat angekündigt, ihre humanitäre Hilfe für die notleidende palästinensische Zivilbevölkerung in Gaza um 50 Mio. Euro auf 75 Mio. Euro zu erhöhen und damit zu verdreifachen.
Zudem wird es um Wege gehen, wie eine regionale Eskalation vermieden werden kann. Außenministerin Baerbock wird von ihren Eindrücken und Gesprächen ihrer jüngsten Nahost-Reise nach Jordanien, Israel, Libanon und Ägypten berichten. Die 27 EU-Mitgliedstaaten haben auf höchster Ebene die brutalen und willkürlichen Hamas-Angriffe auf Israel auf das Schärfste verurteilt. Die EU setzt sich weiter für einen dauerhaften und nachhaltigen Frieden auf der Grundlage der Zweistaatenlösung ein.
Aktuelle Themen für die EU-Außenpolitik – Ukraine sowie der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan
Auf der Tagesordnung des EU-Außenrats steht auch die Lage in der Ukraine und die weitere Unterstützung der EU und ihrer Mitgliedstaaten für das Land angesichts des russischen Angriffskriegs. Mit Blick auf den Winter geht es nun unter anderem darum, kritische Energie- und Wärmeinfrastruktur so aufzustellen, dass sie auch trotz gezielter russischer Angriffe weiter funktionieren kann – durch Ersatzteile und Reparaturmöglichkeiten. Vor drei Wochen war Außenministerin Baerbock zu einem historischen EU-Treffen der Außenministerinnen und Außenminister in Kiew – ein Beweis der starken Solidarität der EU mit den Ukrainerinnen und Ukrainern. Deutschland und die EU stehen an der Seite der Menschen in der Ukraine, die sich gegen Russlands völkerrechtswidrigen Angriffskrieg verteidigen.
Auch der weiter schwelende Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan steht in Luxemburg auf der Tagesordnung. Nach dem militärischen Angriff Aserbaidschans auf die Region Bergkarabach vor einigen Wochen sind inzwischen viele der Bewohnerinnen und Bewohner aus Bergkarabach nach Armenien geflohen – nach Angaben des UN-Flüchtlingskommissariats UNHCR über 100.000 Menschen. Die EU ist vor Ort unter anderem mit einer zivilen Mission vertreten, die die Lage an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze im Blick behält. Die Bundesregierung setzt sich für eine Verstärkung der EU-Unterstützung vor Ort ein.
Außenministerin Baerbock bei den Vereinten Nationen - die Welt schaut auf den Nahen Osten

Nach dem EU-Außenministertreffen wird Außenministerin Baerbock aus Luxemburg nach New York weiterreisen. Dort wird sie am Dienstag im Sicherheitsrat zur Lage im Nahen Osten sprechen. Im Sicherheitsrat steht eine offene Debatte zur Lage im Nahen Osten auf der Tagesordnung. Der derzeitige brasilianische Vorsitz des Sicherheitsrats hat dazu eingeladen. Der UN-Sicherheitsrat trägt im System der Vereinten Nationen die Hauptverantwortung für internationalen Frieden und Sicherheit. Der Schwerpunkt wird in New York darauf liegen, zu verhindern, dass das Kalkül der Hamas-Terroristen aufgeht, die einen Keil in die Weltgemeinschaft treiben wollen.
Eines der Kernthemen der Gespräche in New York wird erneut die humanitäre Hilfe für die palästinensische Zivilbevölkerung sein. Die Vereinten Nationen nehmen u.a. mit ihrer Unterorganisation UNRWA eine zentrale Rolle bei der lebenswichtigen Versorgung ein. Denn UNRWA ist als Hilfswerk und humanitäre Organisation damit beauftragt, palästinensischen Flüchtlingen Hilfe und Schutz zu gewähren. In New York wird Außenministerin Baerbock am Rande der Sicherheitsratssitzung zudem die Gelegenheit für bilaterale Gespräche nutzen.
Der Dienstag ist im Übrigen für die Vereinten Nationen auch aus einem historischen Grund ein besonderer Tag: Der 24. Oktober ist der „Tag der Vereinten Nationen“. Der „UN Day“ erinnert an das Inkrafttreten der Charta der Vereinten Nationen am 24. Oktober 1945.
Außenministerin Baerbock reist erneut in den Nahen Osten
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Nach ihrem Solidaritätsbesuch in Israel nach dem schrecklichen Terroranschlag der Hamas und Gesprächen in Ägypten am 13. und 14. Oktober reist Außenministerin Annalena Baerbock vom 19. bis 21. Oktober erneut in den Nahen Osten. Ihre Reise führt nach Jordanien, Israel und Libanon. Anschließend nimmt sie in Ägypten am „Cairo Summit for Peace“ teil.
Die Lage ist immer noch hoch dramatisch: Vor rund zehn Tagen haben Anhänger der Hamas unvorstellbar brutalen Terror über Israel gebracht. Mehr als 1.300 Menschen sind diesen Terroranschlägen zum Opfer gefallen. Seitdem beschießen die Hamas und mit ihr verbündete Terrorgruppen Israel täglich mit Raketen. Das trifft israelische Familien, die immer noch um Angehörige bangen und gleichzeitig alle 30 Minuten in den Schutzraum laufen müssen.
In diesem Zusammenhang sagte Außenministerin Baerbock vor ihrer Reise:
Unsere unverbrüchliche Solidarität gilt Israel im Kampf gegen die Hamas. Israel hat das Recht, sich gegen den Hamas-Terror zu verteidigen – in dem Rahmen, den das Völkerrecht für solche Ausnahmesituationen vorgibt. Eine enorm schwierige Herausforderung angesichts eines grausamen Gegners, der Menschen als Schutzschilde missbraucht. Es ist das perfide Kalkül der Hamas, die palästinensische Zivilbevölkerung Tod, Not und Leid auszusetzen, um den Nährboden für weiteren Terrorismus zu schaffen. Und zugleich zielt der Terror darauf, die bisher erreichten Annäherungsschritte zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn in Gefahr zu bringen und die arabischen Länder vom globalen Norden zu trennen. Dieses terroristische Kalkül darf nicht aufgehen.
Auf ihrer Reise wird Außenministerin Baerbock ihren engen Austausch mit ihrem jordanischen Amtskollegen über die Lage im Nahen Osten fortsetzen. Die Minister sprachen erst letzte Woche in Berlin miteinander. Und auch in Tel Aviv wird Außenministerin Baerbock erneut politische Gespräche führen. Denn klar ist, der Kampf muss der Hamas gelten und nicht der palästinensischen Zivilbevölkerung.
Krisendiplomatie im Angesicht des Terrors der Hamas hat dabei die Kernthemen:
Außenministerin Baerbock wird auf ihrer Reise alle Gelegenheiten nutzen, um mit all denen, die über Kanäle zur Hamas verfügen, darüber zu sprechen, wie die von der Hamas aus Israel nach Gaza verschleppten Geiseln freigelassen werden können.
Gleichzeitig wird es bei der Reise auch um die humanitäre Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung gehen, die aufgrund des Terrors der Hamas aktuell am Rande einer humanitären Katastrophe steht. Palästinensische Mütter fragen sich angesichts der katastrophalen Lage in Gaza, wie sie ihre kleinen Kinder noch versorgt bekommen. Außenministerin Baerbock wird darüber unter anderem mit Vertreterinnen und Vertretern von UNRWA sprechen. Die Helferinnen und Helfer der Organisation sind immer noch vor Ort tätig und können von ihren Erfahrungen und Einschätzungen berichten.
UNRWA steht für „United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East“ und wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen als ein ihr untergeordnetes Organ gegründet. UNRWA ist als Hilfswerk und humanitäre Organisation damit beauftragt, palästinensischen Flüchtlingen Hilfe und Schutz zu gewähren.
Außenministerin Baerbock unterstrich:
Die humanitäre Lage für hunderttausende unschuldiger Menschen in Gaza ist katastrophal. Es fehlt dort an allem. Dass internationale Hilfe, Lebensmittel, Wasser und medizinische Versorgung rasch und ungehindert bei den Menschen in Gaza ankommen, ist von zentraler Bedeutung.
Zudem sind viele deutsche Staatsangehörige weiterhin in Gaza. Es wird bei der Reise daher auch darum gehen, dass die deutschen Bürgerinnen und Bürger so rasch wie möglich aus Gaza ausreisen können.
Insbesondere in den Gesprächen in den Nachbarländern Israels Libanon und Jordanien wird es um das dritte Thema der Reise gehen, nämlich wie ein Ausbreiten des Hamas-Terrors zu einem regionalen Flächenbrand verhindert werden kann.
Deutschland steht weiter an der Seite der Republik Moldau
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Die Krisendiplomatie dieser Tage verlangt großen Einsatz. Dabei führt die Lage im Nahen Osten vor Augen, welch große Errungenschaft der Europäischen Union es ist, hier in Europa in Frieden und Freiheit zusammenleben zu können.
So sehr uns die Krisendiplomatie dieser Tage fordert, wir weichen keinen Zentimeter in unserer Unterstützung für die Ukraine und unserer Partner in Europas Osten wie Moldau.
- Außenministerin Annalena Baerbock vor ihrem Besuch in Moldau
Die Moldau-Unterstützungsplattform
Die Moldau-Unterstützungsplattform wurde nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im April 2022 durch Außenministerin Annalena Baerbock, zusammen mit ihren Kolleginnen aus Frankreich und Rumänien sowie dem Außenminister von Moldau, ins Leben gerufen. Als kleinstes Nachbarland der Ukraine bekam Moldau die Konsequenzen des Angriffs besonders zu spüren. Es nahm Hunderttausende von Flüchtlinge auf, stand insbesondere bei Fragen der Energieversorgung vor großen Herausforderungen und sieht sich immer wieder russischen Destabilisierungsversuchen ausgesetzt.
Außenministerin Baerbock unterstrich dazu:
Als Russland im Frühjahr 2022 die Ukraine angriff, war die Lage der Republik Moldau dramatisch: Russlands Krieg direkt vor der Haustür, mit russischen Soldaten in Transnistrien, die sich Moldau nur zu leicht zur Beute hätten machen können, Energiekosten, die in den Himmel schossen, und pro Kopf so viele ukrainische Geflüchtete wie in keinem anderen Land. Gemeinsam mit Rumänien und Frankreich standen und stehen wir Schulter an Schulter mit Moldau, zum Beispiel mit Energiehilfen, die dazu beitrugen, den Menschen dort einen Kältewinter zu ersparen und Moldau Schritt für Schritt aus der russischen Energieabhängigkeit loszueisen.
Mit der Plattform wurde ein Mechanismus für konkrete Solidarität mit Moldau geschaffen, mit dem die europäischen Partner Moldau im Umgang mit diesen Herausforderungen unterstützen. In diesem Rahmen erfolgten Konferenzen in Berlin (April 2022), Bukarest (Juli 2022) und Paris (im November 2022). Auf der vierten Konferenz in Chisinau wird das zentrale Thema sein, die Moldau-Unterstützungsplattform weiterzuentwickeln, gerade auch mit Blick auf den Weg des Landes in die Europäische Union.
EU-Perspektive für Moldau
Am 3. März 2022, also kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine entschied sich Moldau dazu, einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union zu stellen. Seit dem 24. Juni 2022 ist die Republik Moldau offiziell Beitrittskandidat.
Seitdem hat Moldau für seinen Weg in die EU eine ambitionierte Reformagenda aufgesetzt. Bis Jahresende steht die Entscheidung über die Eröffnung von Verhandlungen an. Die Herausforderungen, auch mit Blick auf die wirtschaftliche Lage und die Perspektiven für die junge Bevölkerung Moldaus, bleiben groß. Moldau trotzt russischen Destabilisierungsversuchen, die mit Fake News in sozialen Medien und bezahlten Demonstranten einhergehen.
Außenministerin Baerbock hob hervor:
Wir werden bei unserem Treffen in Chisinau daher besprechen, wie wir unsere Unterstützung für Moldau auf eine neue Stufe heben und dafür die strukturelle Hilfe, die wir leisten, mit der politischen Unterstützung für den Weg Moldaus in die EU verschränken.
Solidaritätsbesuch in Zeiten der Krisendiplomatie – Außenministerin Baerbock reist nach Israel
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Hunderte junge Frauen und Männer auf einem Musikfestival, die durch die Wüste gejagt und getötet wurden. Alte Menschen und Familien, die in ihrem Wohnzimmer den Sabbat begangen haben und überfallen wurden. Mütter mit kleinen Kindern gedemütigt und als Geiseln verschleppt. Die Hamas hat unvorstellbaren Terror über Israel gebracht. Kaum jemand kann sich vorstellen, was die Familien der Opfer derzeit durchmachen.
Solidarität mit Israel
Deutschland steht fest und unverbrüchlich an der Seite der israelischen Freunde. Um die Solidarität der Bundesregierung zu unterstreichen, reist Außenministerin Annalena Baerbock am 13. Oktober zu einem eintägigen Besuch nach Israel. Dort wird sie von ihrem Amtskollegen Eli Cohen empfangen.
Außenministerin Baerbock:
Die Terrorangriffe waren eine brutale Zäsur. Für die Menschen in Israel hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Es gilt, hinzusehen, und diesen Terror beim Namen zu nennen.
Die Reise der Außenministerin stand auch im Zeichen der Krisendiplomatie. Der Terror der Hamas birgt die Gefahr, eine ganze Region zu destabilisieren. Terroristen wie die Hamas wollen auch andere Akteure dazu bringen, immer weiter Öl ins Feuer zu gießen, bis sich ein großer Flächenbrand entwickelt. Dies gilt es nun zu verhindern.
Leider ist absehbar, dass sich die Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen eher noch verschärfen wird. Denn die Terroristen der Hamas ziehen die Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza in den Konflikt hinein und nutzen sie als menschliche Schutzschilde.
Außenministerin Baerbock:
Das Drehbuch des Terrors darf nicht greifen. Zivilistinnen und Zivilisten brauchen sichere Räume, in denen sie Schutz finden und mit dem Notwendigsten versorgt werden können.
Für Außenministerin Baerbock ist es die zweite Reise nach Israel. Sie hat das Land im Februar 2022 besucht und dabei unter anderem in der Gedenkstätte Yad Vashem einen Kranz niedergelegt, um der Ermordung von sechs Millionen Jüdinnen und Juden durch die Nationalsozialisten zu gedenken.
Krisendiplomatie in Ägypten
Von Tel Aviv flog Außenministerin Annalena Baerbock dann kurzfristig weiter nach Kairo in Ägypten. Dort führte sie Gespräche mit dem türkischen und ägyptischen Außenminister sowie der Arabischen Liga. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Freilassung der von Hamas nach Gaza verschleppten Deutschen, die Ausreise von Deutschen aus Gaza und die aktuelle humanitäre Situation in Gaza.
Außenministerin Annalena Baerbock:
Den Menschen dort fehlt es gerade an allem. Die Wasservorräte gehen zu Ende, Nahrungsmittel werden knapp, die Stromversorgung ist unterbrochen. Auch deshalb ist es mir so wichtig, mit den Vereinten Nationen und unseren anderen Partnern darüber zu sprechen, wie humanitäre Güter nach Gaza kommen und wir Schutzorte in Gaza schaffen.
Annäherung im Angesicht neuer Spannungen - Außenministerin Baerbock reist zur Westbalkankonferenz nach Tirana
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Bereits 2014 hat die Bundesregierung den sogenannten Berliner Prozess als informelles Format für die regionale Kooperation auf dem westlichen Balkan und zur Unterstützung der EU-Annäherung ins Leben gerufen. Neben den Westbalkanländern Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien nehmen Deutschland, Österreich, Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Kroatien, Italien, Slowenien, Polen und die EU teil.
Dieses Jahr haben der Gipfel und die begleitenden Treffen der Ministerinnen und Minister mit Tirana erstmals einen Gipfelort, der in der Westbalkanregion liegt. Für Außenministerin Baerbock ist es ihre erste Reise nach Albanien. Sie wird die Teilnahme an der Konferenz daher auch für Gespräche mit ihrem albanischen Amtskollegen sowie dem albanischen Ministerpräsidenten nutzen.
Die sechs teilnehmenden Länder des westlichen Balkans eint ihre Absicht, der EU beizutreten. Sie alle haben EU-Beitrittsanträge eingereicht oder sind bereits seit längerem Beitrittskandidaten – Nordmazedonien beispielsweise hat seinen Kandidatenstatus bereits seit 2005. Außenministerin Baerbock sagte dazu:
Die Länder des westlichen Balkans warten bereits zu lange auf ihren Platz am Tisch der Europäischen Union. Gerade für die jungen Menschen in der Region ist vollkommen klar, dass ihre Zukunft in der EU liegt. Und wenn Europa nicht zu ihnen kommt, werden sie einen Weg nach Europa finden - mit fatalen demografischen Folgen für ihre Länder. Damit der EU-Beitritt gelingt, müssen jetzt alle gemeinsam die Ärmel hochkrempeln. Die EU muss Wort halten bei den gegebenen Versprechen, und die Länder des westlichen Balkans müssen die notwendigen Reformen auf den Weg bringen.
Spannungen statt Annäherung?
Doch auch wenn die Marschrichtung des Berliner Prozesses klar in Richtung Versöhnung der Länder des westlichen Balkans untereinander und Annäherung an die EU geht, findet das diesjährige Treffen im Angesicht neuer Gräben und Spannungen statt. In den multilateralen Gesprächen wird es den Außenministerinnen und Außenministern daher auch darum gehen, über eine diplomatische Lösung der Spannungen zwischen Kosovo und Serbien zu reden. Außenministerin Baerbock nutzt die Konferenz vor diesem Hintergrund auch zu bilateralen Gesprächen mit ihrer kosovarischen Amtskollegin und ihrem serbischen Amtskollegen. Mit Blick auf die neuerlichen Spannungen und Gräben auf dem Westbalkan sagte sie vor ihrer Abreise:
Viele Länder haben bereits wichtige Fortschritte erzielt. Doch immer wieder erleben wir auch Rückschritte, werden neue Gräben aufgerissen, die auf dem Weg Richtung EU überwunden werden müssen: Ein skrupelloser Angriff auf die kosovarische Polizei, zeitweise Truppenaufmärsche Serbiens an der Grenze zu Kosovo und die Politik der Abspaltung von Herrn Dodik, die ganz Bosnien und Herzegowina lähmt. Diese Spannungen halten die gesamte Region in Geiselhaft. Sie behindern wichtige Schritte in Richtung Versöhnung. Sie sind Gift für Investitionen. Und sie stören das Vorankommen der Region auf dem Weg zum EU-Beitritt. In dieser schwierigen Gemengelage leistet der Berlin-Prozess einen wichtigen Beitrag, um konkrete Verbesserungen für die Menschen in der Region zu erreichen.
Bessere regionale Zusammenarbeit und Annäherung an die EU
Der 2014 ins Leben gerufene Berliner Prozess hat sich zum Ziel gesetzt, die regionale Integration im und mit dem westlichen Balkan zu stärken und zu vertiefen. Eine bessere regionale Zusammenarbeit bleibt der Schlüssel zu Wirtschaftswachstum und zu Frieden in der Region. Der Berliner Prozess soll auch die Heranführung der gesamten Region an die EU beschleunigen. Dabei konzentriert er sich auf Felder wie Infrastrukturentwicklung, Wirtschaft, regionale Jugendaustausch, Versöhnung und Wissenschaft. Bisherige Erfolge des Berliner Prozesses sind u.a. die Schaffung des Regionalen Jugendwerks RYCO (Regional Youth Cooperation Office), das regionale Roaming-Abkommen und die Einrichtung sog. Green Lanes, die eine beschleunigte Abfertigung von wichtigen Gütern in Zeiten der Corona-Pandemie an den Grenzen erlaubten.
Deutsche Bahn: Suchfunktion »Schnellste Verbindungen anzeigen« ist laut Gerichtsurteil irreführend
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Fast jeder Bahnreisende kennt die Suchfunktion »Schnellste Verbindungen anzeigen«, aber das Unternehmen hat juristischen Ärger mit diesem Onlineangebot. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat die Funktion untersagt – wegen Irreführung...
Von wegen Geheimdiplomatie: unsere themenspezifischen Kanäle in den sozialen Medien
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt
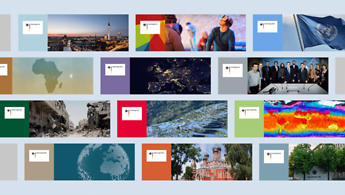 Außenpolitik bewegt Gemüter
Außenpolitik bewegt Gemüter
Von der Klimaaußenpolitik über die Osteuropa-Politik bis zur Reaktion auf akute Krisenlagen: Außenpolitik bewegt die Gemüter, auch in den sozialen Medien. Fast eine Million Menschen folgen dem Auswärtigen Amt auf Twitter, knapp 300.000 auf Facebook und mehr als 350.000 auf Instagram. Kontroverse Themen animieren dabei zu hunderten, manchmal über 1.000 Nutzerkommentaren pro Tag.
Nicht nur senden, sondern einen direkten Dialog führen: Das ist der Grundgedanke der Präsenz des Auswärtigen Amts in den sozialen Medien. Um Außenpolitik noch transparenter zu machen, kommunizieren zudem über 20 Führungskräfte und Arbeitseinheiten auf Twitter, Instagram und LinkedIn.
Eigene Kanäle für Spitzendiplomatinnen und -diplomaten
Einige der Kanäle sind regional fokussiert, etwa auf Asien-, Afrika-, Europa- oder Ostpolitik. Andere setzen thematische Schwerpunkte wie Stabilisierung und humanitäre Hilfe, Vereinte Nationen, Ausbildung im Auswärtigen Amt oder Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Das Krisenreaktionszentrum stellt der bereits vorhandenen App „Sicher Reisen“ einen gleichnamigen Twitterkanal zur Seite. Auch der Planungsstab gibt mit einem eigenen Auftritt Einblicke in seine Arbeit.
Gleichzeitig bauen die deutschen Auslandsvertretungen ihre Präsenz in den sozialen Medien aus. Die Auslandsvertretungen informieren über mehr als 400 Kanälen in den sozialen Medien über deutsche Außenpolitik. Wer noch nicht dazugehört, ist herzlich willkommen: Wir freuen uns auf den Dialog!
Links zu den Kanälen
Twitter
@AAdigitalisiert: Digitalisierung und Datenstrategie im Auswärtigen Amt
@AA_Kultur: Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik
@AA_SicherReisen: Reise- und Sicherheitshinweise unseres Krisenreaktionszentrums
@AA_stabilisiert: Krisenprävention, Stabilisierung, Konfliktnachsorge und Humanitäre Hilfe
@AlemConAmLatina: Deutsche Politik in Lateinamerika und der Karibik
@GERonEurope: Deutsche Sicht auf Europa und EU (engl.)
@GermanyUN: Internationale Ordnung, Vereinte Nationen und Rüstungskontrolle (engl.)
@GERonEconomy: Außenwirtschaftspolitik und nachhaltige Entwicklung (engl.)
@GERonAfrica: Deutsche Afrikapolitik (engl.)
@GERonAsia: Deutsche Asienpolitik (engl.)
@GERonOstpolitik: Deutsche Osteuropa-, Kaukasus- und Zentralasienpolitik (engl.)
@GERonSouthAsia: Deutsche Südasienpolitik
@Planungsstab: Die Arbeit des Planungsstabs im Auswärtigen Amt (engl.)
@Ptassek: Strategische Kommunikation im Auswärtigen Amt (engl.)
@GermanyOnMena: Deutsche Politik im Nahen und Mittleren Osten und Nordafrika
@GermanyOnIntLaw: Deutsches Engagement in völkerrechtlichen Fragen
@GerOnCyber: Cyberaußenpolitik
@GERonSyria: Sonderbeauftragter für Syrien im Auswärtigen Amt (engl.)
Instagram
@auswaertigesamt_karriere: Ausbildung und Karriere im Auswärtigen Amt
Deutschland und der Indo-Pazifik – drei Jahre verstärktes Engagement in einer weltpolitischen Schlüsselregion
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Zwischen Indischem Ozean und Pazifik liegen die am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Die Region macht ein Drittel des außereuropäischen Handels aus. Über 60 % der Weltbevölkerung leben in der Indo-Pazifik-Region und über 60 % des globalen Bruttoinlandsproduktes werden dort erwirtschaftet. Dabei ist die Region nicht frei von Spannungen.
Vor 3 Jahren hat die damalige Bundesregierung mit den Leitlinien Indo-Pazifik einen Wegweiser für das deutsche Engagement in dieser weltpolitischen Schlüsselregion vorgelegt. Heute wurde der dritte Fortschrittsbericht veröffentlicht, in dem das Engagement des vergangenen Jahres in seiner ganzen Bandbreite illustriert wird. Wie wichtig die Region ist, zeigen auch die zahlreichen hochrangigen politischen Besuche in die Region - Bundespräsident, Bundeskanzler und Außenministerin reisten seit ihrem Amtsantritt jeweils gleich mehrfach dorthin. Und vor kurzem hat Deutschland seine erste Botschaft in den kleinen pazifischen Inselstaaten eröffnet: auf Fidschi.
Klimakooperation im Fokus
Mehr als die Hälfte der globalen CO2-Emissionen werden im Indo-Pazifik ausgestoßen, 20 von 33 Mega-Städten weltweit befinden sich hier. Im vergangenen Jahr hat Deutschland daher auch seine Zusammenarbeit in Klimafragen mit der Region deutlich ausgebaut: Mit Indonesien und Vietnam wurden im Rahmen der G7 sogenannte Just Energy Transition Partnerships (JETP) vereinbart, mit denen diese Länder auf ihrem eigenen Weg zum Ausstieg aus Kohle und zum Übergang zu erneuerbaren Energien unterstützt werden. Australien, Indonesien, Südkorea und Singapur traten dem von der Bundesregierung initiierten Klimaclub neu bei, in dem sich Länder mit ambitionierten Klimazielen eng absprechen und voranschreiten wollen. Auch in der Partnerschaft mit der Regionalorganisation ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) bildet Klimaschutz nunmehr einen neuen besonderen Schwerpunkt.
Bedrohung durch steigende Meeresspiegel
Kaum einer weiß besser, welche existentielle Bedrohung der Klimawandel ist, als die pazifischen Inselstaaten. Im August 2023 eröffnete Deutschland eine Botschaft in Suva, der Hauptstadt des südpazifischen Inselstaats Fidschi. Das ist nicht irgendeine neue Auslandsvertretung, sondern damit bekennt sich Deutschland langfristig zur Zusammenarbeit mit den Inselstaaten des Pazifiks gerade auch im Kampf gegen den Klimawandel.
Die Bundesregierung trat dafür auch wichtigen internationalen Initiativen bei, wie der neu gegründeten Initiative Partners in the Blue Pacific. Diese dient dazu, das Engagement in den pazifischen Inselstaaten zu koordinieren. Weitere Mitglieder sind Australien, Großbritannien, Japan, Kanada, Neuseeland, Südkorea und die USA. Mit der Rising Nations Initiative trägt Deutschland angesichts der existentiellen Bedrohung durch steigende Meeresspiegel dazu bei, die pazifischen Inselstaaten physisch wie kulturell zu erhalten.
Frieden, Sicherheit und Stabilität stärken
Deutschland hat als international stark vernetzte Handelsnation ein großes Interesse an freien Schifffahrtswegen und an der Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in der Region. Deshalb engagieren wir uns auch sicherheitspolitisch stärker als zuvor. Seit 2023 ist der Indo-Pazifik neue Partnerregion der sogenannten Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung, mit der wir unsere Partner so unterstützen wollen, dass sie eigene Krisenprävention und Krisenbewältigung betreiben können, zum Beispiel durch bestimmte Beratungen oder Ausstattung mit geeigneter Ausrüstung. Mit Transportflugzeugen und Eurofightern der Luftwaffe nahm Deutschland in diesem Jahr auch an multilateralen Militärübungen in Australien teil. Grundlage der internationalen Ordnung ist das Völkerrecht. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns dafür ein, dass Differenzen friedlich und auf Grundlage des Rechts – zum Beispiel dem internationalen Seerechtsabkommen (UNCLOS) – beigelegt werden.
Europäische Leuchtturmprojekte in der Region
Unsere Wirtschaftsbeziehungen weiter zu diversifizieren und globalen Partnern attraktive Angebote zu machen, ist ein zentrales Element der deutschen Indo-Pazifik-Politik. Besonders wichtig sind hierbei auch die Bemühungen der Europäischen Union für neue, nachhaltige Freihandelsabkommen mit Partnern in der Region sowie die EU-Konnektivitätsstrategie Global Gateway, die Investitionen in hochwertige Infrastruktur vorsieht. Davon sind zahlreiche auch in der Region vorgesehen, wie zum Beispiel der Ausbau des sogenannten ASEAN Highway No. 13, der die Menschen in Laos, Vietnam und Thailand in Zukunft besser miteinander verbinden soll.
Fit für die Zukunft? Deutsch-französische Gruppe stellt Ideen für EU-Reformen vor
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Wie bleibt die EU handlungsfähig, auch wenn sie perspektivisch über 30 Mitglieder haben wird? Das ist die große Frage, die sich eine deutsch-französische Gruppe von Expertinnen und Experten in den letzten Monaten gestellt hat. Unter dem Titel „Sailing on High Seas – Reforming and Enlarging the EU for the 21st Century“ formuliert der heute vorgestellte Bericht Vorschläge zur Reform der EU, einschließlich der Instrumente zur Sicherung der Rechtsstaatlichkeit und zum EU-Erweiterungsprozess. Er bietet wichtige Impulse für die aktuelle europäische Debatte, wie die EU fit für die Erweiterung gemacht werden kann.
Staatsministerin Anna Lührmann erklärte anlässlich der Übergabe des Berichts heute (19.09.2023):
Die Europäische Union muss sich auf die Erweiterung vorbereiten. In der nächsten Legislaturperiode müssen wir die notwendigen internen Reformen der EU umsetzen. Die EU muss ihre Handlungsfähigkeit verbessern, vor allem mit Blick auf den Beitritt neuer Mitglieder. Dafür bietet der Bericht wertvolle Impulse. Er enthält ambitionierte sowie pragmatische Reformvorschläge. Einige davon können wir ohne Vertragsänderungen umsetzen, etwa die Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen in der Außenpolitik. Der Bericht betont richtigerweise die Notwendigkeit, dass wir auch die Rechtsstaatlichkeit stärker schützen müssen. EU-Erweiterung und EU-Reformen müssen Hand in Hand gehen.
Der Bericht der Arbeitsgruppe
Im Januar hat Europastaatsministerin Anna Lührmann gemeinsam mit ihrer französischen Amtskollegin Laurence Boone zwölf Expertinnen und Experten beauftragt. Dabei ging es explizit nicht um die Erstellung einer offiziellen Regierungsposition, sondern darum, Ideen für die Debatte zu liefern und Impulse zu setzen. Herausgekommen ist der unabhängige Bericht einer Arbeitsgruppe, die in ihrer Zusammensetzung deutsch-französisch war, aber Input aus verschiedenen Mitgliedstaaten und Kandidatenländern einbezogen hat.
Der weitere Reformprozess
Der Bericht und die weitere Diskussion im Kreis der Mitgliedstaaten ist eine der vielen Wegmarken auf dem Reformweg der EU. Der Bericht hilft, die Überlegungen zu konkretisieren und diese voranzubringen, z.B. wie Mehrheitsentscheidungen in der EU ausgeweitet werden können. Auch die Rechtsstaatlichkeit in der EU zu stärken, ist ein Anliegen der Bundesregierung, das auch im Bericht der Gruppe eine wichtige Rolle spielt. Die Reformdebatte in der EU hat begonnen. Weitere Wegmarken sind die geplanten Befassungen des Europäischen Rates zu Reform und Erweiterung – auch im Lichte der jährlichen Fortschrittsberichte der Europäischen Kommission zur Erweiterung, die im Herbst erwartet werden.
Der Rat für Allgemeine Angelegenheiten stellt die Kohärenz der Arbeiten aller Ratsformationen sicher. Er ist außerdem für verschiedene übergreifende Themen zuständig, darunter EU-Erweiterung und Fragen des institutionellen Aufbaus der EU. Für die Bundesregierung nimmt die Staatsministerin für Europa und Klima, Anna Lührmann, teil.
Die zwölf Mitglieder der Arbeitsgruppe sind: Daniela Schwarzer (Bertelsmann Stiftung) und Olivier Costa (CNRS CEVIPOF) als Berichterstatter sowie Pervenche Berès (Fondation Jean Jaurès), , Gilles Gressani (Group of Geopolitical Studies/GEG), Gaëlle Marti (Université de Lyon III), Franz Mayer (Universität Bielefeld), Thu Nguyen (Jacques Delors Centre), Nicolai von Ondarza (Stiftung Wissenschaft und Politik), Sophia Russack (Centre for European Policy Studies/CEPS), Funda Tekin (Institut für Europäische Politik/IEP), Shahin Vallée (DGAP) und Christine Verger (Institut Jacques Delors).
Die Welt trifft sich am East River – Außenministerin Annalena Baerbock reist zur 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Eine besondere Generalversammlung für Deutschland
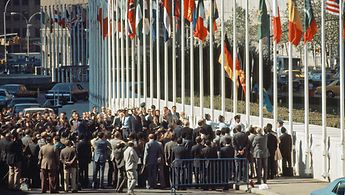 Zum 78. Mal treffen sich ab morgen Staats- und Regierungschefs, Ministerinnen und Minister aus aller Welt zur Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. Für Deutschland wird es dieses Jahr eine ganz besondere, denn vor 50 Jahren, am 18. September 1973, traten die Deutsche Demokratische Republik und die Bundesrepublik Deutschland gemeinsam den Vereinten Nationen bei. Aus den ehemaligen „Feindstaaten“ von 1945 wurden damit wieder vollwertige Mitglieder der internationalen Gemeinschaft. In den letzten 50 Jahren sind die Vereinten Nationen zu einem Fixpunkt der deutschen Außenpolitik geworden.
Zum 78. Mal treffen sich ab morgen Staats- und Regierungschefs, Ministerinnen und Minister aus aller Welt zur Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. Für Deutschland wird es dieses Jahr eine ganz besondere, denn vor 50 Jahren, am 18. September 1973, traten die Deutsche Demokratische Republik und die Bundesrepublik Deutschland gemeinsam den Vereinten Nationen bei. Aus den ehemaligen „Feindstaaten“ von 1945 wurden damit wieder vollwertige Mitglieder der internationalen Gemeinschaft. In den letzten 50 Jahren sind die Vereinten Nationen zu einem Fixpunkt der deutschen Außenpolitik geworden.
Kommende Woche richtet sich der Blick für Team Deutschland jedoch vor allem nach vorne, denn ein halbes Jahrhundert nach dem deutschen Beitritt sind die Herausforderungen, vor denen die Welt steht, nicht geringer geworden.
Außenministerin Baerbock sagte vor Beginn der Generalversammlungswoche:
Die Vereinten Nationen sind nicht perfekt, als Weltgemeinschaft haben wir aber schlicht kein besseres Forum. Um in einer Welt im Wandel gemeinsam bestehen zu können, müssen wir die Vereinten Nationen erneuern. Dazu gehört, dass wir die nachhaltigen Entwicklungsziele ins Zentrum der Vereinten Nationen rücken. Dazu gehört mehr Ehrgeiz bei der Eindämmung der Klimakrise, der größten Bedrohung unserer Zeit. Dazu gehört, dass wir die Vereinten Nationen, die internationalen Finanzinstitutionen und Gesundheitsgremien endlich so aufstellen, dass unsere Partner in Afrika, Lateinamerika und Asien dort die ihnen gebührende Stimme erhalten.
Die gesamte Pressemitteilung finden Sie hier.
Unsere Welt von morgen - Nachhaltige Entwicklungsziele, Klima und globale Gesundheit
Das Motto der diesjährigen Generalversammlungsdebatte ist so komplex, wie die Herausforderungen, vor denen die Welt steht: “Rebuilding trust and reigniting global solidarity: Accelerating action on the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals towards peace, prosperity, progress and sustainability for all.”
 Worum es im Kern geht? Sicherzustellen, dass die Welt auch in Zukunft für alle Menschen eine lebenswerte Existenzgrundlage bilden kann. Auf diese simple Frage gibt es keine einfachen Antworten – ihnen allen gemein ist aber, dass sie sich nur global lösen lassen. Dazu rückt die diesjährige Generalversammlung unter anderem das Erreichen der 2030er Nachhaltigkeitsziele mit dem sogenannten SDG Gipfel in den Fokus. Weil oft gerade diejenigen Staaten, die am wenigsten zur globalen Erwärmung beigetragen haben, ihre Auswirkungen bereits am härtesten spüren, baut Deutschland seine Unterstützung für SIDS – die 57 „Small Island Developing States“ aus. Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock werden dazu mit ihnen beraten, wie sie sich besser für die kommenden Veränderungen wappnen können.
Worum es im Kern geht? Sicherzustellen, dass die Welt auch in Zukunft für alle Menschen eine lebenswerte Existenzgrundlage bilden kann. Auf diese simple Frage gibt es keine einfachen Antworten – ihnen allen gemein ist aber, dass sie sich nur global lösen lassen. Dazu rückt die diesjährige Generalversammlung unter anderem das Erreichen der 2030er Nachhaltigkeitsziele mit dem sogenannten SDG Gipfel in den Fokus. Weil oft gerade diejenigen Staaten, die am wenigsten zur globalen Erwärmung beigetragen haben, ihre Auswirkungen bereits am härtesten spüren, baut Deutschland seine Unterstützung für SIDS – die 57 „Small Island Developing States“ aus. Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock werden dazu mit ihnen beraten, wie sie sich besser für die kommenden Veränderungen wappnen können.
Spätestens seit Covid-19 wissen wir zudem alle, dass die Welt besser werden muss in der Reaktion auf Pandemien und globale Gesundheitskrisen. Außenministerin Baerbock wird dazu Deutschland in einem High-Level Meeting zu Pandemieprävention vertreten – Ziel ist der erfolgreiche Abschluss eines weltweiten Abkommens zur Pandemieprävention.
Völkerrechtsverstöße nicht ungestraft lassen – Reform des römischen Statuts und Ukraine Tribunal
Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat gezeigt, wie verletzlich unsere internationale Friedensordnung ist. Deutschland wird in New York einmal mehr unterstreichen: wir stehen felsenfest an der Seite der Menschen in der Ukraine in ihrem Kampf für ihre Freiheit. Gleichzeitig setzen wir uns dafür ein, dass das Völkerstrafrecht auf ein solches Aggressionsverbrechen schärfer und effektiver reagieren kann: mittelfristig durch eine Reform des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofes und kurzfristig, indem durch ein sogenanntes internationalisiertes Tribunal die Möglichkeit geschaffen wird, das russische Aggressionsverbrechen, das millionenfaches Leid verursacht hat, zur Anklage zu bringen.
Die Rechte aller stärken – Frauenrechte in Afghanistan und feministische Außenpolitik im Fokus
 763 Tage nach Machtübernahme der Taliban in Afghanistan treten diese weiter Tag für Tag systematisch die Menschenrechte mit Füßen, vor allem die von Frauen und Mädchen. Deutschland setzt ihr Schicksal gemeinsam mit Luxemburg, Albanien, Belgien, Costa Rica und Kroatien auf die Agenda, um zu beraten, wie sie unterstützt werden können. Deutschland hat im März 2023 seine Leitlinien für eine feministische Außenpolitik verabschiedet – gemeinsam mit einer Reihe anderer Partner wird Deutschland zu einer Diskussion über die Umsetzung feministischer Außenpolitik laden.
763 Tage nach Machtübernahme der Taliban in Afghanistan treten diese weiter Tag für Tag systematisch die Menschenrechte mit Füßen, vor allem die von Frauen und Mädchen. Deutschland setzt ihr Schicksal gemeinsam mit Luxemburg, Albanien, Belgien, Costa Rica und Kroatien auf die Agenda, um zu beraten, wie sie unterstützt werden können. Deutschland hat im März 2023 seine Leitlinien für eine feministische Außenpolitik verabschiedet – gemeinsam mit einer Reihe anderer Partner wird Deutschland zu einer Diskussion über die Umsetzung feministischer Außenpolitik laden.
Breite Diskussionen
Darüber hinaus stehen viele weitere Themen auf der Agenda. Die Generalversammlungswoche bietet die einzigartige Chance, Amtskolleginnen und Amtskollegen unkompliziert zum persönlichen Gespräch in ganz unterschiedlichen Formaten und Runden zu treffen. So sind unter anderem informelle Treffen der anwesenden EU-Außenministerinnen und Außenminister sowie der G7 geplant, ebenso wie zahlreiche bilaterale Gespräche.
Out of many, one – Außenministerin Annalena Baerbock reist in die USA
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Vom 12. bis zum 15. September reist Außenministerin Annalena Baerbock nach Texas und Washington, D.C. Anschließend wird sie in New York an der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilnehmen.
Das deutsch-amerikanische Band über den Atlantik verbindet Millionen. Ich möchte dieses Netzwerk mit der gesamten Breite der amerikanischen Gesellschaft noch enger knüpfen.
- Außenministerin Annalena Baerbock
Die Beziehung unserer beiden Länder ist dabei weit mehr als die Standleitungen zwischen Berlin und Washington. Gerade der Lone Star State Texas ist einer der Gradmesser für das Amerika der Zukunft. Als zweitbevölkerungsreichster Bundesstaat der USA ist Texas ein wahres wirtschaftliches Powerhouse, das einerseits mit der intensiven Nutzung seiner Öl- und Gasvorkommen noch mit einem Fuß in der fossilen Vergangenheit steht, aber sich zeitgleich aufmacht in das Zeitalter erneuerbarer Energien. Auch die gesellschaftliche Vielfalt des Bundesstaates spiegelt das Amerika von morgen wieder. So stellt die „Latinx-Community“ inzwischen mehr als 40 Prozent der texanischen Bevölkerung und ist damit seit letztem Jahr die größte Bevölkerungsgruppe des Bundesstaates. Annalena Baerbock wird sich in Austin und Houston sowohl mit politischen Akteuren austauschen – darunter dem Gouverneur von Texas, Greg Abbott – als auch Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der Latinx-Community führen. Sie hat sich in verschiedenen Organisationen zusammengefunden, um das alltägliche wie auch das politische Leben mitzugestalten: von der Unterstützung von einkommensschwachen Familien mit Jobtraining, Zugang zur Staatsbürgerschaft, der Mobilisierung zur Wahlbeteiligung bis zur Förderung der nächsten Generation von Latinx für Führungspositionen in der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Dienst.
 Beim Besuch der Unternehmen Advario und Mobileye wird sich Annalena Baerbock über die Regulierung kritischer Technologien und Nutzung grüner Energien informieren. Advario baut weltweit Lieferketten für grünes Ammoniak, einen klimafreundlichen Energieträger aus Wasserstoff. Der deutsche Autohersteller Volkswagen startete kürzlich mit dem Technologieunternehmen Mobileye das erste voll-elektrische „autonomous driving“-Projekt in den USA. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Wichita Falls, Texas, wird sich Annalena Baerbock außerdem über die gemeinsame Ausbildung amerikanischer und deutscher Jetpilotinnen und -piloten informieren und Gespräche mit den Soldatinnen und Soldaten führen.
Beim Besuch der Unternehmen Advario und Mobileye wird sich Annalena Baerbock über die Regulierung kritischer Technologien und Nutzung grüner Energien informieren. Advario baut weltweit Lieferketten für grünes Ammoniak, einen klimafreundlichen Energieträger aus Wasserstoff. Der deutsche Autohersteller Volkswagen startete kürzlich mit dem Technologieunternehmen Mobileye das erste voll-elektrische „autonomous driving“-Projekt in den USA. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Wichita Falls, Texas, wird sich Annalena Baerbock außerdem über die gemeinsame Ausbildung amerikanischer und deutscher Jetpilotinnen und -piloten informieren und Gespräche mit den Soldatinnen und Soldaten führen.
Starke Bürgerrechte für starke Demokratien
Begleitet wird Annalena Baerbock auf ihrer Reise nach Texas vom Bürgermeister sowie vier Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Leipzig. Die Städte Leipzig und Houston feiern dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum ihrer Städtepartnerschaft. Gerade in Zeiten, in denen unsere Demokratien herausgefordert werden, braucht es nicht nur widerstandsfähige Institutionen, sondern auch das Engagement jeder und jedes Einzelnen von uns. Deshalb wird es in einem transatlantischen Bürgergespräch um die Stärkung von Bürgerrechten und demokratischen Strukturen gehen.
An einem Strang ziehen, wenn es darauf ankommt: gemeinsame Werte als politisches Fundament
 Von Texas wird Außenministerin Baerbock nach Washington, D.C. reisen, unter anderem für den Austausch mit Studierenden der Howard-University, Gespräche mit Abgeordneten des US-Kongresses und natürlich ihrem Amtskollegen, Antony Blinken. Denn welchen Stellenwert unsere transatlantische Partnerschaft hat, haben uns in Europa besonders die letzten gut eineinhalb Jahre des russischen Angriffskrieges vor Augen geführt. Unsere Partnerschaft misst sich daran, wie wir an einem Strang ziehen, wenn es darauf ankommt: dann, wenn wir für unsere gemeinsamen Werte einstehen müssen.
Von Texas wird Außenministerin Baerbock nach Washington, D.C. reisen, unter anderem für den Austausch mit Studierenden der Howard-University, Gespräche mit Abgeordneten des US-Kongresses und natürlich ihrem Amtskollegen, Antony Blinken. Denn welchen Stellenwert unsere transatlantische Partnerschaft hat, haben uns in Europa besonders die letzten gut eineinhalb Jahre des russischen Angriffskrieges vor Augen geführt. Unsere Partnerschaft misst sich daran, wie wir an einem Strang ziehen, wenn es darauf ankommt: dann, wenn wir für unsere gemeinsamen Werte einstehen müssen.
Während Europa in den Abgrund des russischen Angriffskrieges im Herzen unseres Kontinents schaute, war auf eines jederzeit Verlass: Die USA und Europa stehen Seite an Seite mit den Menschen in der Ukraine. Amerika steht Seite an Seite mit seinen Verbündeten.
- Außenministerin Annalena Baerbock
Globale Partnerschaften stärken: Konferenz der Leiterinnen und Leiter deutscher Auslandsvertretungen
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Aus der Welt in Berlin: vom 4.-7. September 2023 tauschen sich die Leiterinnen und Leiter der über 220 Botschaften, Generalkonsulate und ständigen Vertretungen bei internationalen Organisationen gemeinsam zu globalen Entwicklungen und der deutschen Außenpolitik im Auswärtigen Amt aus. Außenministerin Baerbock eröffnet die Konferenz am Montagmorgen und hat dazu als Ehrengast die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation WTO, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, eingeladen. Schwerpunktthema ist in diesem Jahr die Stärkung globaler Partnerschaften. Die Eröffnung können Sie am 4. September 2023 live auf X-Kanal verfolgen.
Das ursprünglich „Botschafterkonferenz“ – oder kurz „BoKo“ – genannte Treffen findet wie jedes Jahr traditionell im Spätsommer in Berlin statt. Es bringt Gäste aus Wirtschaft, Diplomatie, Politik, Wirtschaft, Kultur sowie Zivilgesellschaft mit den deutschen Botschafterinnen und Botschaftern, Generalkonsulinnen und Generalkonsuln sowie Ständigen Vertreterinnen und Vertretern Deutschlands bei internationalen Organisationen und der Europäischen Union zu intensivem Austausch zusammen.
Die deutschen Vertretungen in aller Welt sind Dreh- und Angelpunkt der deutschen Außenpolitik. Sie sind tagtäglich Gesicht und Stimme deutscher und europäischer Interessen vor Ort – von der Umsetzung von Klimaprojekten über die Unterstützung deutscher Auslandsschulen, als Anlaufpunkt für Unternehmen bis hin zum aktiven Werben für bestimmte Positionen gegenüber der Regierung im Gastland. Daher ist es wichtig, dass die Leiterinnen und Leiter mindestens einmal im Jahr nach Berlin kommen, um sich mit der Ministerin, mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen des Auswärtigen Amts, mit externen Gästen und Expertinnen und Experten über aktuelle Entwicklungen und Strategien persönlich auszutauschen.
In Zeiten globaler Machtverschiebungen ersetzt nichts diese direkte Vernetzung – und wichtige Themen gibt es genug: In zahlreichen Panels, Praxiswerkstätten und Regionalgesprächen werden unter anderem humanitäre Fragen, Fragen der Entwicklungszusammenarbeit, der Kampf gegen die Klimakrise oder europäische Wettbewerbsfähigkeit diskutiert. Auch geht es um die konkrete Umsetzung der Feministischen Außenpolitik, die EU-Erweiterung und eine strategischere Kommunikation in einer sich rapide ändernden Welt. Im Fokus steht dieses Jahr die Stärkung globaler Partnerschaften mit strategisch wichtigen Ländern.
WTO
Die Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO) mit Sitz in Genf befasst sich als eine der zentralen internationalen Institutionen der Weltwirtschaftsordnung mit der Regelung internationaler Handels- und Wirtschaftsbeziehungen. Ziele sind eine größtmögliche Transparenz der Handelspolitiken ihrer Mitglieder, die Einhaltung und Überwachung der gemeinsamen multilateralen Handelsregeln sowie der Abbau von Handelsschranken. Der WTO gehören derzeit 164 Länder an, Deutschland war 1995 ein Gründungsmitglied. Die nigerianische Politikerin und Ökonomin Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ist seit 2021 Generaldirektorin der WTO. Mit ihr leitet erstmals eine Frau und eine Vertreterin aus Afrika die WTO.
Wirtschaftstag
 Beim sogenannten Wirtschaftstag am 5. September 2023 geht es um Kernfragen der Außenwirtschaft –wie Klimaaußenpolitik, Sorgfaltspflichten in den Lieferketten, die deutsche und internationale Energiewende oder die Fachkräfteeinwanderung. Die deutschen Vertretungen sind Wegbereiter für deutsche Investitionen in den Gastländern ebenso wie für Investitionen ausländischer Unternehmen in Deutschland. Sie sind Ansprechpartner für internationale Unternehmen und Unternehmen des Gastlandes für deutsche Wirtschaftspolitik und aktuelle Entwicklungen in Deutschland.
Beim sogenannten Wirtschaftstag am 5. September 2023 geht es um Kernfragen der Außenwirtschaft –wie Klimaaußenpolitik, Sorgfaltspflichten in den Lieferketten, die deutsche und internationale Energiewende oder die Fachkräfteeinwanderung. Die deutschen Vertretungen sind Wegbereiter für deutsche Investitionen in den Gastländern ebenso wie für Investitionen ausländischer Unternehmen in Deutschland. Sie sind Ansprechpartner für internationale Unternehmen und Unternehmen des Gastlandes für deutsche Wirtschaftspolitik und aktuelle Entwicklungen in Deutschland.
Die Reden von Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck können Sie am 4. September 2023 live auf X-Kanal verfolgen.
Lage in der Sahel-Region und Unterstützung für die Ukraine – „Gymnich“-Treffen in Toledo
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Spanien hat seit 1. Juli 2023 den Vorsitz im Rat der EU-Mitgliedstaaten. Traditionell richtet die jeweilige Ratspräsidentschaft, aktuell Spanien, informelle Ratstreffen der jeweiligen Fachministerinnen und Fachminister in ihrem Land aus. Das sogenannte „Gymnich“-Treffen ist das erste Treffen der EU-Außenministerinnen und Außenminister nach der Sommerpause. In Toledo, im Herzen Spaniens und eine Stunde südlich von Madrid, wird es um das EU-Engagement in der Sahel-Region sowie die Unterstützung für die Ukraine mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gehen. Wie immer steht bei diesen „informellen“ Treffen ein offener und tiefgründiger Austausch der Außenministerinnen und Außenminister im Vordergrund, der auch mittel- und langfristige Aspekte in den Blick nimmt. Zum Auftakt des Treffens wird es heute Abend ein Arbeitsabendessen geben, bevor morgen in den Arbeitssitzungen die Themen des Treffens weiter vertieft werden.
EU-Unterstützung für den Kampf der Ukraine für Frieden, Freiheit und Sicherheit
Die EU-Außenministerinnen und Außenminister werden am Vormittag über Russlands Angriff auf die Ukraine und die weitere EU-Unterstützung für die Menschen in der Ukraine sprechen. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba wird bei einem gemeinsamen Arbeitsfrühstück zu Gast sein und unter anderem über die aktuelle Lage in der Ukraine berichten. Dabei wird es auch um die Vorbereitung der hochrangigen Generalversammlungs-Woche der Vereinten Nationen Mitte September in New York gehen. Anschließend werden die EU-Außenministerinnen und Außenminister über die langfristige Unterstützung der Ukraine sprechen – im humanitären, finanziellen und militärischen Bereich, aber auch bei Fragen des Wiederaufbaus des Landes.
EU-Sahel-Beziehungen nach dem Militärputsch in Niger
Der zweite Schwerpunkt des informellen Treffens wird die sich verschlechternde humanitäre und Sicherheitssituation in der Sahel-Region, d.h. in Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger und Tschad, sein. Dabei geht es um zwei Dinge: eine ehrliche und tiefgründige Bestandsaufnahme der Lage in der Region. Und die Möglichkeiten der EU, eine Zusammenarbeit zu gestalten, die unter anderem Stabilität, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit fördert. Durch den Militärputsch in Niger stellen sich für die EU hier neue Herausforderungen. Die Lage im Sahel hat gewichtigen Einfluss auf die Stabilität im Norden und im Zentrum Afrikas sowie am Golf von Guinea und damit auch mittelbar auf die europäische Sicherheit.
Ziel bleibt eine Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung in Niger. Bei dem morgigen Austausch in Toledo werden der nigrische Außenminister, Hassoumi Massoudou, und Omar Touray, der Präsident der Kommission von ECOWAS zu Gast sein. Derzeit bemühen sich die Regionalorganisation der westafrikanischen Staaten (ECOWAS), sowie die Afrikanische Union (AU) um eine Vermittlung. Deutschland und die EU unterstützen ECOWAS und die AU bei diesen diplomatischen Bemühungen. Außenministerin Baerbock hat sich in der vergangenen Woche mit der Außenministerin Senegals, Aïssata Tall Sall, in Berlin unter anderem über Wege zur Wiederherstellung der demokratischen und verfassungsmäßigen Ordnung in Niger ausgetauscht. Außerdem ging es um die Zusammenarbeit beim Abzug der MINUSMA-Truppen aus Mali.
Alle sechs Monate richtet der EU-Mitgliedstaat, der derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, ein informelles, sogenanntes „Gymnich“-Treffen aus. Der Name geht auf das Schloss Gymnich im Rheinland zurück, wo sich die Außenministerinnen und Außenminister der EU auf Einladung Deutschlands 1974 zum ersten Mal im informellen Rahmen getroffen hatten. Dieser informelle Charakter soll einen vertieften Austausch ermöglichen, ohne dass konkrete Beschlüsse gefasst werden. Die Themen gehen dabei oft auch über tagesaktuelle Ereignisse hinaus.
Caravan Salon 2023: Wohnmobile und Camper – das sind die Trends und Highlights
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
750 Aussteller, Hunderttausende Besucher: Am Wochenende startet die Campingmesse »Caravan Salon« in Düsseldorf. Ein Blick auf die Reiseriesen der kommenden Saison – die auch mal schlappe zwei Millionen Euro kosten...
Nach den Erdbeben: Deutschland hilft den Menschen in der Türkei und Syrien
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Die Situation in den Erdbebengebieten: Wie ist die aktuelle Lage?
Sechs Monate nach der Erdbebenkatastrophe leben hunderttausende Menschen weiter in Notunterkünften, zum Beispiel in Zelten oder Containerbauten. Nahrung und medizinische Versorgung sind in vielen Regionen knapp. Die Versorgung mit sauberem Wasser ist nach wie vor eine große Herausforderung, viele zerstörte Wasserleitungen und Abwasser-Systeme müssen noch repariert werden. Besonders Kinder und Jugendliche kämpfen mit den Folgen der Erdbeben, sie sind von den katastrophalen Erlebnissen traumatisiert. Viele Schulen haben seit Monaten geschlossen, ein geregelter Alltag ist für sie weit entfernt.
Unterstützung für die Menschen in Syrien und der Türkei
 Die Bundesregierung hat für die Menschen in der Türkei und in Syrien dieses Jahr fast 240 Millionen Euro Hilfe zugesagt. Damit ist Deutschland unter den Top Drei der wichtigsten Geberländer für die vielen Menschen in Not. Die Hilfe umfasst die Kosten für Such- und Bergungsteams, die unmittelbar nach der Katastrophe zum Einsatz kamen, für humanitäre Hilfe, zum Beispiel der Verteilung von dringend benötigten Nahrungsmitteln, Trinkwasser und Medikamenten und für längerfristige zielgerichtete Unterstützung für die Menschen in Not. Mit dem Geld möchten wir den betroffenen Menschen ein Überleben in Würde und Sicherheit ermöglichen. Dabei haben wir die besonderen Bedarfe von Frauen und Mädchen gemeinsam mit UN WOMEN im Blick. Denn Krisen haben unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer. In Krisenzeiten verschärfen sich bestehende Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern häufig. Frauen und Mädchen brauchen zum Beispiel besonderen Schutz, wenn es an Privatsphäre und Sicherheit in Gemeinschaftsräumen mangelt.
Die Bundesregierung hat für die Menschen in der Türkei und in Syrien dieses Jahr fast 240 Millionen Euro Hilfe zugesagt. Damit ist Deutschland unter den Top Drei der wichtigsten Geberländer für die vielen Menschen in Not. Die Hilfe umfasst die Kosten für Such- und Bergungsteams, die unmittelbar nach der Katastrophe zum Einsatz kamen, für humanitäre Hilfe, zum Beispiel der Verteilung von dringend benötigten Nahrungsmitteln, Trinkwasser und Medikamenten und für längerfristige zielgerichtete Unterstützung für die Menschen in Not. Mit dem Geld möchten wir den betroffenen Menschen ein Überleben in Würde und Sicherheit ermöglichen. Dabei haben wir die besonderen Bedarfe von Frauen und Mädchen gemeinsam mit UN WOMEN im Blick. Denn Krisen haben unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer. In Krisenzeiten verschärfen sich bestehende Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern häufig. Frauen und Mädchen brauchen zum Beispiel besonderen Schutz, wenn es an Privatsphäre und Sicherheit in Gemeinschaftsräumen mangelt.
Hilfe für die Menschen in Syrien: eine besondere Herausforderung
 Besonders in Nordwest-Syrien, wo die humanitäre Lage ohnehin extrem angespannt ist und zahlreiche syrische Binnenvertriebene leben, gab es enorm viele Tote und Verletzte. Als einer der größten Unterstützer der Menschen dort hat Deutschland bereits vor den Erdbeben humanitäre Hilfe geleistet und verfügt über ein belastbares Netzwerk von Partnerorganisationen vor Ort. Dank dieses Netzwerks konnten wir nach den Erdbeben Hilfe schnell auf die Beine stellen und in diesem Jahr bereits 135 Millionen Euro umsetzen. Deutschland ist als zweitgrößter Geber auch an den Hilfslieferungen der Vereinten Nationen beteiligt, die über drei Grenzübergänge aus der Türkei nach Nordwest-Syrien gehen. Es ist besonders wichtig, dass Hilfslieferungen verlässlich und ohne Einfluss des Regimes in Damaskus weiter die Bedürftigsten im Nordwesten Syriens erreichen. Auch im Gesundheitssektor sind wir präsent und unterstützen zum Beispiel die Versorgung von Krebspatientinnen und -patienten, die zeitweise nicht mehr wie vor dem Erdbeben in der Türkei behandelt werden konnten.
Besonders in Nordwest-Syrien, wo die humanitäre Lage ohnehin extrem angespannt ist und zahlreiche syrische Binnenvertriebene leben, gab es enorm viele Tote und Verletzte. Als einer der größten Unterstützer der Menschen dort hat Deutschland bereits vor den Erdbeben humanitäre Hilfe geleistet und verfügt über ein belastbares Netzwerk von Partnerorganisationen vor Ort. Dank dieses Netzwerks konnten wir nach den Erdbeben Hilfe schnell auf die Beine stellen und in diesem Jahr bereits 135 Millionen Euro umsetzen. Deutschland ist als zweitgrößter Geber auch an den Hilfslieferungen der Vereinten Nationen beteiligt, die über drei Grenzübergänge aus der Türkei nach Nordwest-Syrien gehen. Es ist besonders wichtig, dass Hilfslieferungen verlässlich und ohne Einfluss des Regimes in Damaskus weiter die Bedürftigsten im Nordwesten Syriens erreichen. Auch im Gesundheitssektor sind wir präsent und unterstützen zum Beispiel die Versorgung von Krebspatientinnen und -patienten, die zeitweise nicht mehr wie vor dem Erdbeben in der Türkei behandelt werden konnten.
Erleichtertes Visumverfahren für Betroffene
Neben der humanitären Hilfe hatte das Auswärtige Amt zusammen mit dem BMI bereits kurz nach den verheerenden Erdbeben auch ein erleichtertes Visumverfahren für Betroffene aus den Erdbebengebieten aufgelegt: Sie konnten in einem vereinfachten und pragmatischen Verfahren von engen Familienangehörigen für einen vorübergehenden Aufenthalt nach Deutschland eingeladen werden. Und auch das Visaverfahren zum Zwecke des Daueraufenthalts wurde vereinfacht: So wurden an den Visastellen Istanbul und Beirut Termine zur Familienzusammenführung aufgestockt und Antragstellende aus den von den Erdbeben betroffenen Regionen bei der Terminvergabe bevorzugt. Dies galt insbesondere für den Familiennachzug zu subsidiär schutzberechtigten syrischen Staatsangehörigen. Beim Ehegattennachzug von syrischen Antragstellenden wurde ferner in vielen Fällen auf den gesetzlich erforderlichen Nachweis einfacher Kenntnisse der deutschen Sprache verzichtet.
Unsere Visastellen in der Region konnten so insgesamt über 16.900 Visa ausstellen. Mehr als 12.300 dieser Visa waren Schengenvisa und mehr als 4.000 Visa zum Daueraufenthalt im Rahmen des Familiennachzugs. Da die Nachfrage nach derartigen Visa immer weiter rückläufig war, wurde das Verfahren am 6. August eingestellt.
München: Hier ist es im Sommer am chilligsten
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Zwei der beliebtesten Münchner Volkssportarten sind: eine Bootsfahrt auf der Isar und Bier trinken im Biergarten. Stimmt das? Die besten Tipps geben unsere Kollegen und Kolleginnen in und aus Bayern...
Australien, Neuseeland, Fidschi: Außenministerin Baerbock reist in die Zukunftsregion Indopazifik
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Hinweis: Die Reise von Außenministerin Baerbock nach Australien, Neuseeland und Fidschi wurde aufgrund eines mechanischen Defekts am Flugzeug der Flugbereitschaft abgebrochen.
Gemeinsam mit unseren Partnern in Australien, Neuseeland und Fidschi stehen wir für den Schutz der internationalen Ordnung, von Lebensgrundlagen und Sicherheitsinteressen ein, insbesondere auch im Hinblick auf die von China ausgehenden Herausforderungen in und für die Region. Australien und Neuseeland sind zudem unverzichtbare Partner, wenn es um die Diversifizierung unserer Lieferketten geht: Ein Fünftel unseres globalen Handels erfolgt bereits jetzt mit dem Indopazifik.
Australien: Von Sicherheitspolitik bis Fußball-WM
Vom 13. bis 16. August wird Außenministerin Baerbock ihre australische Amtskollegin Wong sowie Partner in Australien treffen, um mit ihnen die deutsch-australischen Beziehungen zu vertiefen sowie die Zusammenarbeit im Bereich der Klima- sowie der Sicherheitspolitik auszubauen. Dabei geht es insbesondere um Fragen der wirtschaftlichen Absicherung, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Rolle Chinas im Indo-Pazifik. Passend zum Thema steht der Besuch australischer Sicherheitsbehörden in den Bereichen Cyber, Katastrophenschutz und der Satelliten-Herstellung auf der Tagesordnung. Dabei wird Außenministerin Baerbock auch einen Flottenstützpunkt der australischen Marine besuchen. Bei einem Termin in Canberra wird Außenministerin Baerbock außerdem Kulturgüter an die indigene Gemeinschaft der Kaurna zurückgeben.
Anlässlich der Fußballweltmeisterschaft der Frauen wird Außenministerin Baerbock in Sydney den Preis der Fußball-Botschafterin des Jahres verleihen und anschließend das Halbfinalspiel der Weltmeisterschaft besuchen – auch, wenn es die deutsche Nationalelf leider nicht ins Halbfinale geschafft hat.
Neuseeland: Brücke zu den pazifischen Inselstaaten und Verbündeter im Kampf gegen die Klimakrise
Bei Außenministerin Baerbocks Aufenthalt in Auckland am 17. August wird es neben der bilateralen und wirtschaftlichen Kooperation unserer Länder um die Eindämmung der Klimakrise, die Stabilität im Indo-Pazifik sowie die Zusammenarbeit mit den pazifischen Inselstaaten gehen. Nach dem Treffen mit ihrer neuseeländischen Amtskollegin Mahuta wird Außenministerin Baerbock sich zudem mit Vertreterinnen und Vertretern eines neuseeländischen Unternehmens aus dem Bereich des Klimaschutzes austauschen.
Außenministerin Annalena Baerbock:
Obwohl Australien und Neuseeland aus Sicht von uns Europäerinnen und Europäern buchstäblich am anderen Ende der Welt liegen, sind Freiheit und Demokratie Teil unserer gemeinsamen DNA.
Fidschi: Intensivierung der Zusammenarbeit, insbesondere hinsichtlich der Klimakrise
Die letzten beiden Tagen der Reise in die Region des Indopazifiks, der 18. und 19. August, schließen thematisch an die Treffen Außenministerin Baerbocks in Neuseeland an. Es ist der erste Besuch einer deutschen Außenministerin in dem Land. Fidschi ist als Inselstaat ganz direkt vom steigenden Meeresspiegel bedroht, daher stehen die Auswirkungen der Klimakrise bei Außenministerin Baerbocks Terminen ganz besonders im Fokus. So auch im Gespräch mit dem Generalsekretär der Regionalorganisation „Pacific Islands Forum“ und im Austausch mit Studierenden der University of the South Pacific. Beim Besuch zweier Dörfer, die u.a. wegen Landerosion und Überschwemmungen ganz besonders von den Folgen der Klimakrise betroffen sind, trifft Außenministerin Baerbock Bewohnerinnen und Bewohner, um sich über deren persönliche Situation zu informieren.
Zum Abschluss der Reise steht ein besonderes und seltenes Ereignis an: Die Eröffnung einer neuen Botschaft. In einer feierlichen Zeremonie wird Außenministerin Baerbock gemeinsam mit dem Premier- und Außenminister Fidschis die Deutsche Botschaft Suva eröffnen.
Köln: Hier lässt sich die Stadt am Rhein im Sommer genießen
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Köln ist chaotisch, gefühlsduselig und ein bisschen verrückt. SPIEGEL-Redakteure und -Redakteurinnen zeigen ihre liebsten Veedel, Untergrundorte und Zufluchtsplätze im Grünen...
#HalloAußenpolitik: Einladung zum Tag der offenen Tür 2023
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Das Programm zum Tag der offenen Tür im Auswärtigen Amt finden Sie hier.
Einblicke in die Arbeit des Auswärtigen Amts
An rund 50 Ständen werden sich Kolleginnen und Kollegen der unterschiedlichsten Arbeitseinheiten und Abteilungen des Auswärtigen Amts, Partnerinnen und Partner der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik sowie der Humanitären Hilfe vorstellen:
Erfahren Sie, wie Cyberaußen- und Cybersicherheitspolitik den digitalen Raum schützt, lernen Sie die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten besser kennen und seien Sie live bei einer Schalte zur Internationalen Raumstation ISS dabei!
 Wir laden Sie ein: Seien Sie an den beiden Tagen der offenen Tür unser Staatsgast, werfen Sie einen Blick in das Krisenreaktionszentrum, in dem zuletzt die Evakuierungsoperation aus dem Sudan koordiniert wurde, und informieren Sie sich über die verschiedenen Berufsbilder im Auswärtigen Amt. Unsere Partnerländer Indien und Japan haben ebenfalls spannende Angebote für Sie im Gepäck.
Wir laden Sie ein: Seien Sie an den beiden Tagen der offenen Tür unser Staatsgast, werfen Sie einen Blick in das Krisenreaktionszentrum, in dem zuletzt die Evakuierungsoperation aus dem Sudan koordiniert wurde, und informieren Sie sich über die verschiedenen Berufsbilder im Auswärtigen Amt. Unsere Partnerländer Indien und Japan haben ebenfalls spannende Angebote für Sie im Gepäck.
Mit dabei ist auch unser 2021 gegründetes Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten. An den Ständen können Sie zum Beispiel Ihr Wissen im Bereich Visa testen, mehr darüber erfahren, wie eine Botschaft ausgestattet wird und sich über aktuelle Stellenangebote informieren.
50 Jahre ist Deutschland in den Vereinten Nationen
Einen besonderen Augenmerk legen wir an dem Wochenende auf die Vereinten Nationen: 1973 wurden die beiden deutschen Staaten in die UNO aufgenommen. Feiern Sie die 50-jährige Mitgliedschaft mit uns – mit einem Foto vor der Selfiewand aus der Generalversammlung in New York oder einer Kugel Eis in der Farbe der Vereinten Nationen!
Bühnenprogramm im Weltsaal…
Im großen Weltsaal erwartet Sie ein umfangreiches Bühnenprogramm. Diskutieren Sie mit unseren Panellistinnen und Panellisten über Fragen von Frieden und Sicherheit. Und Außenministerin Annalena Baerbock stellt sich beim Bürgerforum Ihren Fragen.
... und vorbeischauen im Büro der Außenministerin!
Auch der Arbeitsbereich der Ministerin öffnet seine Türen für große und kleine Besucherinnen und Besucher: Im zweiten Stock des Altbaus können Sie alleine oder mit Führung durch das Büro der Ministerin sowie das Pressefoyer des Auswärtigen Amts besichtigen, in dem normalerweise die Außenministerin mit ihren ausländischen Gästen vor die Medien tritt. Jetzt können Sie sich mal hinter das Pult stellen.
Food Market und Open Air Programm
Machen Sie es sich in den Liegestühlen im Protokollhof gemütlich und genießen Sie das Programm auf der Open-Air Bühne mit Auburn Light und Rockhouse Brothers, Indigo Masala und Project Mishram. Sie mögen es laut? Dann sollten Sie auf keinen Fall die Performance von iki iki TAIKO verpassen. Mit japanischen Trommelklängen sorgen sie für gute Stimmung auf und vor der Bühne.
Verschiedene Food Trucks bieten Ihnen leckeres Essen und coole Drinks an und auf dem Basar können Sie Reisemitbringsel, Seltenheiten und Gastgeschenke aus fernen Ländern für einen guten Zweck erwerben.
Spaß für Kinder und Familien
Auch für unsere kleinsten Gäste bereiten wir ein abwechslungsreiches Angebot vor: farbenfrohe Gesichtsmalerei, Bastelangebote, die Hüpfburg des Technischen Hilfswerks und einer Reise um die Welt mit spannenden Geschichten aus verschiedenen Ländern stehen auf dem Programm. Als „special guest“ erwarten wir die Biene Maja!
 Villa Borsig
Villa Borsig
Ein besonderes Highlight gibt es am Sonntag, den 20. August: Dann öffnet das Gästehaus der Außenministerin, die Villa Borsig im Tegeler Forst, seine Türen für Sie. Neben spannenden Geschichten zum Haus, das ab 1911 von Nachfahren des Berliner Lokomotiv-Fabrikanten Johann Carl Friedrich August Borsig als „kleines Sanssouci“ erbaut wurde, können Sie den naturgeschützten Park der Anlage bei einem Rundgang entdecken. Bleiben Sie doch gerne etwas länger, schauen bei unserem Food Truck vorbei und lassen den Tag im Liegestuhl am See ausklingen.
Wegbeschreibung zur Villa Borsig
Aufgrund der Sicherheitskontrollen kann es beim Einlass zu Wartezeiten kommen.
Eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen (U2/Hausvogteiplatz, U5/Museumsinsel).
Das Gelände sowie die Villa Borsig in Tegel sind barrierefrei.
Rückschau: so war der Tag der offenen Tür 2022
Sydney: Warum ich mich in der australischen Stadt zu Hause fühle
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Sydney ist ein Brummkreisel: Ständig wird irgendwo irgendwas abgerissen, restauriert, neu erfunden. Den Autor zieht es seit Jahrzehnten immer wieder in die diesjährige Fußball-WM-Stadt. Hier verrät er seine Lieblingstipps...
Putsch in Niger: Politische Lage und Evakuierung deutscher Staatsangehöriger
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Mit ihrer Festsetzung des gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum am Morgen des 26. Juli 2023 haben die Putschisten die noch junge Demokratie Nigers ins Wanken gebracht. Der Putsch ist insbesondere ein Schlag ins Gesicht der vielen Nigrerinnen und Nigrer, die sich in den letzten Jahren unermüdlich für eine bessere Zukunft des Landes eingesetzt haben. Die Bundesregierung hat mit der Aussetzung der Entwicklungszusammenarbeit bereits erste Konsequenzen gezogen und steht bereit, gemeinsam mit ihren europäischen Partnern weitere Maßnahmen zu ergreifen.
Wir sind weiterhin fest davon überzeugt, dass nur eine demokratische Regierung nachhaltige Antworten auf die vielen Herausforderungen finden kann, vor denen das Land steht. Denn wo Militärs nach der Macht greifen, schaden sie ihrem Land.
- Außenministerin Annalena Baerbock
Die Regionalorganisation ECOWAS sowie die Afrikanische Union bemühen sich derzeit um Vermittlung, damit schnellstmöglich eine Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung gelingen kann. Dafür müssen die Putschisten sofort die unrechtmäßig von ihnen festgehaltenen Mitglieder der demokratisch legitimierten Regierung freilassen und die Macht an diese zurückgeben. Deutschland und Europa unterstützen ECOWAS und die Afrikanische Union bei ihren Vermittlungsbemühungen. Denn Niger verdient eine demokratische Zukunft.
Evakuierung deutscher Staatsangehörige läuft
Oberstes Gebot hat in dieser Stunde für die Bundesregierung die Sicherheit der deutschen Staatsangehörigen im Land. Deswegen hat das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für Niger ausgesprochen und alle deutschen Staatsangehörigen aufgefordert, das Land zu verlassen. Praktisch unterstützt werden sie dabei vom Krisenstab der Bundesregierung und der deutschen Botschaft in Niamey, die zusammen eine sichere Ausreise der in Niger befindlichen deutschen Staatsangehörigen organisieren. Wie bereits bei vorherigen Krisen erfolgt dies in enger Abstimmung mit Frankreich und anderen europäischen Partnern. Dabei wird die enge deutsch-französische Freundschaft ganz praktisch gelebt: Frankreich nimmt auch viele Deutsche auf seinen Evakuierungsflügen mit. Die deutsche Botschaft in Niamey wird ihre Arbeit weiter fortführen.
Niger sah sich in vergangenen Jahren zahlreichen Herausforderungen ausgesetzt: Die Folgen der Klimakrise, die Knappheit natürlicher Ressourcen, ein hohes Bevölkerungswachstum und große Armut stellten die Regierung von Präsident Bazoum vor große Hürden. Zudem kämpft Niger - wie seine Nachbarstaaten - mit Terrorismus und organisierter Kriminalität. Die nigrische Regierung hat sich trotz dieser widrigen Umstände bemüht, Armut zu bekämpfen, dass Leben seiner Bevölkerung nachhaltig zu verbessern und so dem Terrorismus den Nährboden zu entziehen. Unterstützt wurde die demokratische Regierung Nigers dabei unter anderem von der Europäischen Union.
Hamburg: Hier ist die Hansestadt im Sommer besonders schön
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Wer Hamburg sagt, meint Elbe, Alster oder Hafen. Und ja, am Wasser liegen viele Lieblingsplätze der SPIEGEL-Redaktion. Wir haben aber noch mehr Ideen für Sommerausflüge in der Stadt...
Luxus-Kreuzfahrtschiff »Explora I«: Marmor, Champagner und ein Rolex-Shop auf hoher See
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Explora Journeys will die Luxuskreuzfahrt neu erfinden. Ihr erstes Schiff geht jetzt auf Jungfernfahrt. Luxus bedeute auch Nachhaltigkeit, sagt die Reederei – und organisiert Helikopterflüge auf Gletscher...
Rhodos: TUI sagt Flüge wegen Waldbränden auf Urlaubsinsel ab
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Tausende mussten vor den Waldbränden auf Rhodos fliehen. Einige Reiseveranstalter reagieren – und bringen vorerst keine neuen Gäste auf die Insel...
Rhodos: TUI sagt Flüge wegen Waldbrand ab
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Tausende mussten vor den Waldbränden auf Rhodos fliehen. Einige Reiseveranstalter reagieren – und bringen vorerst keine neuen Gäste auf die Insel...
Hier ist Berlin im Sommer besonders schön: Tipps zum Baden, Chillen und Abhängen
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Berlin ist grün und vermüllt, hipsterig und rotzig, laut und leise. Unsere Autorinnen und Autoren verraten ihre sommerlichen Highlights der Hauptstadt...
Ukraine, Türkei, Wirtschaftssicherheit – Außenministerin Baerbock beim Juli EU-Außenrat
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Die Agenda des letzten Außenrates vor der Brüsseler Sommerpause ist vollgepackt. Gemeinsam mit dem per Video zugeschalteten Außenminister der Ukraine, Dmytro Kuleba, werden sich die Außenministerinnen und Außenminister über die aktuelle Lage in der Ukraine austauschen. Im Anschluss wird es im EU-Kreis darum gehen, wie die Ukraine bei ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg weiter unterstützt werden kann. Ein Schwerpunkt wird darauf liegen, wie mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine ausgestaltet werden können. Dies baut auf Gespräche am Rande des NATO Gipfels vergangene Woche in Vilnius auf. Die Außenministerinnen und Außenminister werden zudem darüber beraten, wie Russland für in der Ukraine begangene Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden kann (weitere Informationen zu dieser sog. „Accountability“ hier).
EU-Türkei Beziehungen
Die Europäische Union hat ein strategisches Interesse an guten Beziehungen zur Türkei. Das Verhältnis ist dabei komplex. Enge Verbundenheit zwischen den Menschen, EU-Beitrittskandidatenstatus und Bündnispartnerschaft in der NATO stehen teils gravierende Defizite in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten gegenüber. Dies hat die EU-Kommission wiederholt festgestellt. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben beim Europäischen Rat Ende Juni 2023 auf deutsche Initiative die EU-Kommission aufgefordert, bis zum Herbst einen Bericht zum Kurs der Türkei nach dem erneuten Wahlsieg von Staatspräsident Erdoğan vorzulegen. Die Außenministerinnen und Außenminister diskutieren dazu heute über den aktuellen Stand in den EU-Türkei Beziehungen.
Wirtschaftssicherheit
Die unterbrochenen Lieferketten während der Covid-19 Pandemie, die Instrumentalisierung von Gas und Öl als Waffe durch Russland – Fragen der wirtschaftlichen Resilienz und Souveränität sind immer mehr auch Sicherheitsfragen. Am 20. Juni hat die EU ihre „Economic Security Strategie“ vorgestellt, die dem Dreiklang „promote, protect and partner“ folgt. Die EU27 werden sich gemeinsam über die außenpolitische Dimension von wirtschaftlicher Sicherheit austauschen. In diesem Zusammenhang wird auch die vergangene Woche vorgestellte deutsche China Strategie eine Rolle spielen.
Austausch mit Antony Blinken
Die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten sind so eng wie selten zuvor. Als Ausdruck dieser engen Abstimmung ist US-Außenminister Blinken dem Treffen heute für einen ausführlichen Austausch zugeschaltet – im Vordergrund steht die gemeinsame Unterstützung der Ukraine. Aber auch weitere außenpolitische Themen wie die Lage auf dem Westbalkan oder der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan werden voraussichtlich Gegenstand des Austausches sein.
Weitere Themen – Sanktionen, COP28…
Die Menschenrechtslage für Frauen und Mädchen ist in vielen Regionen der Welt weiterhin schlecht. Die EU wird deswegen im Rahmen des bestehenden Menschenrechtssanktionsregimes voraussichtlich neue Listungen von Verantwortlichen u. a. in Afghanistan, Südsudan und der Zentralafrikanischen Republik wegen Menschenrechtsverstößen und sexualisierter Gewalt gegenüber Frauen beschließen. Auf Initiative der deutsch-dänischen Freundesgruppe für eine ambitionierte Klimaaußenpolitik der EU werden sich die Außenministerinnen und Außenminister über die Vorarbeit für die 28. Weltklimakonferenz COP28 kommenden Dezember austauschen.
Der „Rat für Auswärtige Angelegenheiten" (RfAB) ist zuständig für das außenpolitische Handeln der EU. Dies umfasst die Bereiche der Außen‑, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, den Handel, die Entwicklungszusammenarbeit und die humanitäre Hilfe. Er hat vor allem die Aufgabe, gemeinsam mit der Europäischen Kommission und unter Einbindung des Hohen Vertreters der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, ein einheitliches und koordiniertes außenpolitisches Handeln der EU sicherzustellen. Der RfAB tagt in der Regel einmal im Monat.
Reisepass-Ranking: Deutschlands Pass ist zweitmächtigster der Welt
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Wie groß die Reisefreiheit in einem Land ist, lässt sich am Pass ablesen. Der deutsche öffnet 190 Grenzen. An der Spitze der Rangliste stand lange Japan. Nun aber nicht mehr...
Reisepass-Ranking: Deutschlands Pass belegt Platz zwei im »Henley Passport Index 2023«
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Wie groß die Reisefreiheit in einem Land ist, lässt sich am Pass ablesen. Der deutsche öffnet 190 Grenzen. An der Spitze der Rangliste stand lange Japan. Nun aber nicht mehr...
Deutschlandreise #GemeinsamStark: Außenministerin Baerbock im Dialog
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Die Reise steht im Zeichen von Widerstandsfähigkeit und Resilienz angesichts der vielfältigen außen-, sicherheits- und europapolitischen Herausforderungen unserer Gegenwart.
Deutschlands Zukunft bauen wir alle gemeinsam: Wir Politikerinnen und Politiker, aber vor allem innovative Unternehmer und Wissenschaftlerinnen genauso wie die unzähligen Menschen, die sich tagtäglich ehrenamtlich für unser Land engagieren, sei es im Sportverein, in der freiwilligen Feuerwehr oder in dem Integrations- oder Antirassismusprojekt in der eigenen Nachbarschaft. Mit ihnen möchte ich in den kommenden Tagen offen und ehrlich diskutieren.
- Außenministerin Annalena Baerbock
Die Agenda
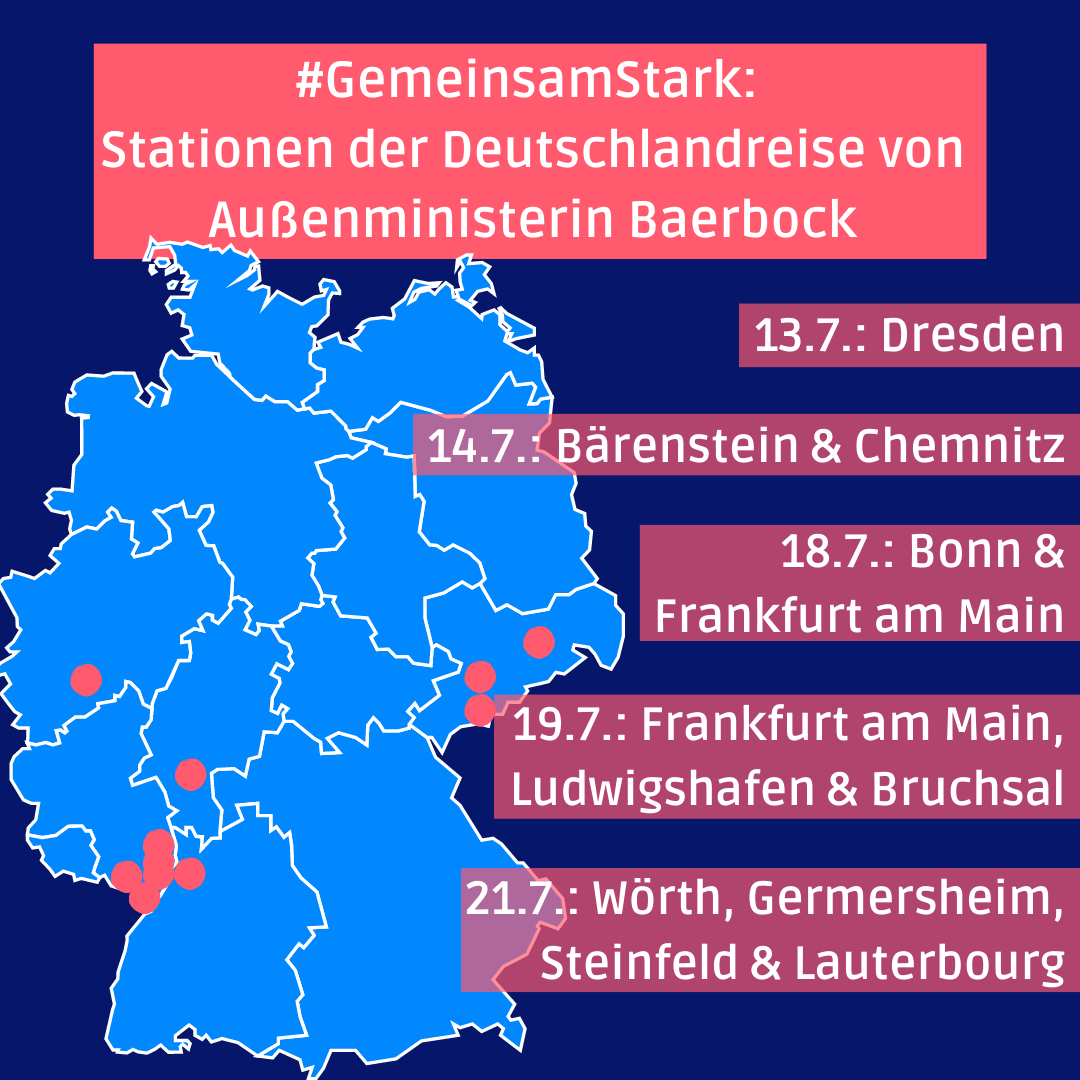 Der erste Stopp auf der Reise ist Dresden, wo Außenministerin Baerbock am 13.07. gemeinsam mit Wirtschaftsminister Habeck ein Werk der Firma Infineon, einen der größten Halbleiter-Produzenten weltweit, besucht. Wie können wir die europäische technologische Souveränität stärken? Wie die digitale und grüne Transformation unserer Wirtschaft mit innovativen Technologien vorantreiben? Dies sind nur einige der Fragen, die bei dem Termin im Mittelpunkt stehen werden. Bei einem Treffen mit dem tschechischen Außenminister Lipavský am 14.07. im Erzgebirge steht die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Fokus, z. B. bei Feuerwehren und der Daseinsvorsorge. Am gleichen Tag besucht Außenministerin Baerbock zivilgesellschaftliche und kulturelle Initiativen in Chemnitz, das 2025 europäische Kulturhauptstadt sein wird. Gemeinsam mit Wladimir Klitschko wird Außenministerin Baerbock dort am Abend mit Bürgerinnen und Bürgern zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sprechen.
Der erste Stopp auf der Reise ist Dresden, wo Außenministerin Baerbock am 13.07. gemeinsam mit Wirtschaftsminister Habeck ein Werk der Firma Infineon, einen der größten Halbleiter-Produzenten weltweit, besucht. Wie können wir die europäische technologische Souveränität stärken? Wie die digitale und grüne Transformation unserer Wirtschaft mit innovativen Technologien vorantreiben? Dies sind nur einige der Fragen, die bei dem Termin im Mittelpunkt stehen werden. Bei einem Treffen mit dem tschechischen Außenminister Lipavský am 14.07. im Erzgebirge steht die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Fokus, z. B. bei Feuerwehren und der Daseinsvorsorge. Am gleichen Tag besucht Außenministerin Baerbock zivilgesellschaftliche und kulturelle Initiativen in Chemnitz, das 2025 europäische Kulturhauptstadt sein wird. Gemeinsam mit Wladimir Klitschko wird Außenministerin Baerbock dort am Abend mit Bürgerinnen und Bürgern zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sprechen.
 Weiter geht es am 18.07. mit einem Besuch bei der Deutschen Telekom in Bonn. Hier geht es um das Risiko digitaler Angriffe und die Risiken der Nutzung chinesischer Bauteile in der deutschen Netz-Infrastruktur. Am Abend findet in Frankfurt am Main eine weitere Diskussionsrunde mit Bürgerinnen und Bürgern statt. Am Morgen des 19.07. trifft Außenministerin Baerbock Vertreter der Deutschen Bank, der Commerzbank sowie der Unicredit-HypoVereinsbank, um sich über die Chancen und Herausforderungen des wachsenden asiatischen Marktes und der Globalisierung sowie zu Formen der Klimafinanzierung auszutauschen. Bei BASF in Ludwigshafen informiert sich Außenministerin Baerbock zur Diversifizierung von Bezugs- und Absatzmärkten, insbesondere im Hinblick auf China, und wird mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen. In Bruchsal besucht Außenministerin Baerbock ein Geothermie-Projekt, bei dem auch Lithium gewonnen wird. Dass nachhaltige Energiegewinnung und die Unabhängigkeit von Rohstoff-Importen zentrale sicherheitspolitische Anliegen sind, ist nicht zuletzt seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine klar.
Weiter geht es am 18.07. mit einem Besuch bei der Deutschen Telekom in Bonn. Hier geht es um das Risiko digitaler Angriffe und die Risiken der Nutzung chinesischer Bauteile in der deutschen Netz-Infrastruktur. Am Abend findet in Frankfurt am Main eine weitere Diskussionsrunde mit Bürgerinnen und Bürgern statt. Am Morgen des 19.07. trifft Außenministerin Baerbock Vertreter der Deutschen Bank, der Commerzbank sowie der Unicredit-HypoVereinsbank, um sich über die Chancen und Herausforderungen des wachsenden asiatischen Marktes und der Globalisierung sowie zu Formen der Klimafinanzierung auszutauschen. Bei BASF in Ludwigshafen informiert sich Außenministerin Baerbock zur Diversifizierung von Bezugs- und Absatzmärkten, insbesondere im Hinblick auf China, und wird mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen. In Bruchsal besucht Außenministerin Baerbock ein Geothermie-Projekt, bei dem auch Lithium gewonnen wird. Dass nachhaltige Energiegewinnung und die Unabhängigkeit von Rohstoff-Importen zentrale sicherheitspolitische Anliegen sind, ist nicht zuletzt seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine klar.
 Der Abschluss der Deutschlandreise am 21.07. steht ganz im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft. In Wörth am Rhein trifft Außenministerin Baerbock Schülerinnen und Schüler, die an deutsch-französischen Ausbildungsprojekten teilgenommen haben und ihr Projekt „Smart Factory“ vorstellen werden. Zusammen mit ihrer französischen Amtskollegin Catherine Colonna wird die Außenministerin ein grenzüberschreitendes Wasserwerk besuchen sowie mit deutschen und französischen Bürgerinnen und Bürgern u. a. über Europa sprechen und wie wir in Europa gemeinsam stark bleiben.
Der Abschluss der Deutschlandreise am 21.07. steht ganz im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft. In Wörth am Rhein trifft Außenministerin Baerbock Schülerinnen und Schüler, die an deutsch-französischen Ausbildungsprojekten teilgenommen haben und ihr Projekt „Smart Factory“ vorstellen werden. Zusammen mit ihrer französischen Amtskollegin Catherine Colonna wird die Außenministerin ein grenzüberschreitendes Wasserwerk besuchen sowie mit deutschen und französischen Bürgerinnen und Bürgern u. a. über Europa sprechen und wie wir in Europa gemeinsam stark bleiben.
Durchbruch in der internationalen Rüstungskontrolle: Neues Globales Rahmenwerk zu Munition
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren stark für die Entwicklung internationaler Regeln eingesetzt, um Gefahren, die von konventioneller Munition ausgehen, so gut es geht einzudämmen. Die für diese Frage zuständige Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen zu konventioneller Munition (OEWG) in New York hat nun unter deutschem Vorsitz den Entwurf für das „Global Framework for Through-life Conventional Ammunition Management“ angenommen.
Das klingt sehr technisch, ist aber ein großer Durchbruch. Die Regelungen werden dazu beitragen, Leben zu retten und Leid zu verringern. Auch vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist das Rahmenwerk einer der wenigen Lichtblicke für eine zunehmend ausgehebelte internationale Rüstungskontrollarchitektur.
15 Ziele zur Vermeidung von Explosionsrisiken und zur Einhegung illegaler Munitionsströme
 Das Globale Rahmenwerk enthält 15 Ziele zur Risikoreduzierung und deckt verschiedenste Etappen im Lebenszyklus von Munition ab, von der Produktion über den Transfer bis hin zu Einsatz und Vernichtung. Den Zielen sind einzelne Maßnahmen zugeordnet, um etwa Explosionsrisiken zu vermeiden, Umleitungsrisiken zu verringern, die Markierung und Nachverfolgung zu verbessern sowie Informationssammlung und Austausch zu illegaler Munition zu stärken. Die internationale Gemeinschaft kann diesen Gefahren nur gemeinsam begegnen. Daher betont das Rahmenwerk die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit und Unterstützung und legt Ansätze zur künftigen Umsetzung dar.
Das Globale Rahmenwerk enthält 15 Ziele zur Risikoreduzierung und deckt verschiedenste Etappen im Lebenszyklus von Munition ab, von der Produktion über den Transfer bis hin zu Einsatz und Vernichtung. Den Zielen sind einzelne Maßnahmen zugeordnet, um etwa Explosionsrisiken zu vermeiden, Umleitungsrisiken zu verringern, die Markierung und Nachverfolgung zu verbessern sowie Informationssammlung und Austausch zu illegaler Munition zu stärken. Die internationale Gemeinschaft kann diesen Gefahren nur gemeinsam begegnen. Daher betont das Rahmenwerk die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit und Unterstützung und legt Ansätze zur künftigen Umsetzung dar.
Der Erfolg der langjährigen Initiative beruht auch auf dem großen Engagement zahlreicher Länder, die jenseits politischer Trennungslinien zusammengearbeitet haben. Wenn die 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen im Herbst das Globale Rahmenwerk durch die Annahme des Entwurfs in Kraft setzt, wird damit eine seit über zwanzig Jahren kontrovers geführte Diskussion beendet und eine wesentliche Lücke in der globalen Rüstungskontrolle geschlossen.
50 Jahre Deutschland in den Vereinten Nationen
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Am 18. September 2023 jährt sich der Beitritt der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik zu den Vereinten Nationen (UN) zum fünfzigsten Mal. Deutschland ist verlässlicher Partner der Vereinten Nationen und prinzipienfester Verteidiger einer internationalen Ordnung, die auf der UN-Charta und dem Völkerrecht beruht.
Das wiedervereinigte Deutschland hat in den vergangenen Jahrzehnten in den Vereinten Nationen immer mehr Verantwortung übernommen. Deutschland ist mittlerweile zweitgrößter Beitragszahler für das gesamte UN-System und zweitgrößter bilateraler Geber humanitärer Hilfe. Deutschland war mehrfach Mitglied des UN-Sicherheitsrats und des UN-Menschenrechtsrats und blickt auf eine lange Tradition deutscher Beteiligungen an zahlreichen UN-Friedensmissionen zurück. Deutschland beheimatet den für wichtige Zukunftsfragen entscheidenden UN-Standort Bonn und den Internationalen Seegerichtshof in Hamburg. Wussten Sie, dass in Deutschland 33 UN-Institutionen mit rund 1.000 Beschäftigten arbeiten?
- UN-Haushalt: Deutschland ist zweitgrößter Beitragszahler zum gesamten UN-System (2021: 6,7 Mrd. US-Dollar) und viertgrößter Beitragszahler zum regulären UN-Budget (2023: 178,8 Mio. US-Dollar, 6,1%).
- Humanitäre Hilfe: Deutschland ist zweitgrößter bilateraler Geber humanitärer Hilfe (2022: 3,5 Mrd. US-Dollar).
- Ernährungssicherheit: Deutschland hat 2022 rund 5 Mrd. Euro bereitgestellt, davon 1,734 Mrd. für das Welternährungsprogramm WFP.
- Entwicklungshilfe: Deutschland ist zweitgrößter Geber (2021: 27,3 Mrd. Euro) mit einer ODA-Quote (Anteil der ODA am Bruttonationaleinkommen) von 0,74% in 2021.
- Menschenrechte: Deutschland ist fünftgrößter Beitragszahler für das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte (2021: 16 Mio. US-Dollar).
- Peacekeeping: Deutschland stellt gegenwärtig 1.250 Soldatinnen und Soldaten für die UN-Friedensmissionen MINUSMA, UNIFIL, UNMISS und MINURSO zur Verfügung, ist damit drittgrößter Truppensteller in Europa und ist viertgrößter Beitragsleister zum Peacekeeping-Haushalt der UN (2022-2023: 549 Mio. US-Dollar).
- Globale Gesundheit: Deutschland ist zweitgrößter Geber der globalen Imfpstoffinitiative ACT-A (2020-2022: 3,3 Mrd. Euro), stellt 550 Mio. Euro für die Impfstoffproduktion in Afrika zur Verfügung und hat 128 Mio. Impfdosen gespendet.
- Heimat der Vereinten Nationen: Deutschland beheimatet 33 UN-Institutionen mit 1.000 Beschäftigten.
Deutschland setzt sich ein für die Stärkung der Vereinten Nationen: Denn die großen globalen Herausforderungen unserer Zeit - Klimakrise, Bewahrung des Weltfriedens, sozioökonomische Ungleichheit und andauernde Ernährungsunsicherheit – kann die Gemeinschaft der Völker nur gemeinsam effektiv zu begegnen. Damit die Vereinten Nationen auch in Zukunft handlungsfähig bleiben, setzt Deutschland auf eine multilaterale Ordnung und partnerschaftliche Zusammenarbeit, die auf Völkerrecht und Gerechtigkeit sowie gemeinsamen Werten und Zielen wie Frieden und Sicherheit, Freiheit und Menschenrechten sowie Nachhaltigkeit und Entwicklung beruht.
Deutschland ist bereit, im wichtigsten Gremium der Vereinten Nationen erneut Verantwortung für Frieden und Sicherheit zu übernehmen. Deshalb kandidiert Deutschland für einen nicht-ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat in den Jahren 2027/2028. Auch für die Reform des UN-Sicherheitsrats macht sich Deutschland stark. Um nicht an Relevanz, Legitimität und Autorität zu verlieren, sollte der Sicherheitsrat –fast 80 Jahre nach seiner Gründung – die Realitäten des 21. Jahrhunderts abbilden. Dazu gehört zum Beispiel eine angemessene Repräsentanz afrikanischer Staaten und der zentralen Beitragsleister.
Cookinsel Mauke in der Südsee: Ohne Touristen stirbt das Inselparadies aus
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Vor der Küste von Mauke tanzen die Wale, und jede Urlauberin wird mit einem Blumenkranz begrüßt. Unsere Autorin entdeckt eine entschleunigte Insel, die ums Überleben kämpft...
Außenministerin Baerbock in New York – Gemeinsam für einen starken Internationalen Strafgerichtshof
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

25 Jahre Römisches Statut – ein Meilenstein des Völkerrechts
Der starke Einsatz für die regelbasierte internationale Ordnung bildet einen Grundpfeiler deutscher Außenpolitik. Nicht zuletzt aus der historischen Verantwortung Deutschlands erwächst die Erkenntnis über die tragende Rolle, die dem Völkerrecht in der Wahrung von Frieden und Sicherheit, aber auch in der Wiederherstellung von Gerechtigkeit und Verantwortung zuteilwird.
Annalena Baerbock vor ihrem Abflug:
Als vor einem Vierteljahrhundert, nach langen, zähen Verhandlungen, das Römische Statut Wirklichkeit wurde, verhalf es einer jahrhundertealten Idee endlich zu einem wichtigen Durchbruch: Frieden durch Recht. Das Fundament unserer Weltgemeinschaft, das Völkerrecht, bekam mit dem Internationalen Strafgerichtshof einen neuen Stein. Endlich akzeptierten Staaten, dass die schwersten Verbrechen, welche die internationale Gemeinschaft als Ganzes berühren, nicht unbestraft bleiben dürfen.
Deutschlands Engagement für ein starkes Völkerrecht
 Deutschland ist nicht nur zweitgrößter Geber für den Internationalen Strafgerichtshof, sondern unterstützt auch die Kandidatur deutscher Juristinnen und Juristen für eine Position als Richterinnen und Richter am Internationalen Strafgerichtshof. Aus diesem Grund wird die Außenministerin bei ihrer Reise von Dr. Ute Hohoff begleitet, die als Richterin des Bundesgerichtshofs und mit ihrer langjährigen Expertise im Bereich der Verfolgung insbesondere von Sexualverbrechen in Zusammenhang von Konflikten bei den Richterwahlen 2023 als Nachfolgerin für den derzeitigen deutschen Richter Prof. Dr. Bertram Schmitt kandidiert und einen großartigen Gewinn für den Internationalen Strafgerichtshof darstellen würde.
Deutschland ist nicht nur zweitgrößter Geber für den Internationalen Strafgerichtshof, sondern unterstützt auch die Kandidatur deutscher Juristinnen und Juristen für eine Position als Richterinnen und Richter am Internationalen Strafgerichtshof. Aus diesem Grund wird die Außenministerin bei ihrer Reise von Dr. Ute Hohoff begleitet, die als Richterin des Bundesgerichtshofs und mit ihrer langjährigen Expertise im Bereich der Verfolgung insbesondere von Sexualverbrechen in Zusammenhang von Konflikten bei den Richterwahlen 2023 als Nachfolgerin für den derzeitigen deutschen Richter Prof. Dr. Bertram Schmitt kandidiert und einen großartigen Gewinn für den Internationalen Strafgerichtshof darstellen würde.
Mehr Informationen zu Richterin Dr. Hohoff finden Sie hier.
Anpassung des Römischen Statuts an die Anforderungen des 21. Jahrhunderts
Als erste Außenministerin hatte sich Außenministerin Baerbock bei ihrer Rede an der Haager Akademie für Völkerrecht im Januar dieses Jahres für eine Überarbeitung des Römischen Statuts in Bezug auf das Verbrechen der Aggression ausgesprochen.
Außenministerin Baerbock im Januar in Den Haag:
Russlands Krieg gegen die Ukraine ist auch ein brutaler Angriff auf das Völkerrecht. Zeitenwende bedeutet: Wir müssen auch im Völkerrecht neue Antworten finden, damit es seine Geltung auch entfalten kann.
Seit dem Kompromiss von Kampala, der das Römische Statut ergänzt, zählt auch Aggression zu den Straftaten, die vom IStGH verfolgt werden. Allerdings kann nach derzeitiger Definition das Verbrechen der Aggression nur verfolgt werden, wenn sowohl Opferstaat als auch Staat, dem der Aggressor angehört, die Einigung von Kampala ratifiziert haben.
Mit Blick auf Russlands Angriffskrieg weist das Völkerrecht also eine Strafbarkeitslücke in Bezug auf das Verbrechen der Aggression auf. Deutschland schlägt daher ein zweigleisiges Vorgehen vor, um diese zu schließen:
Zum einen unterstützt Deutschland die Ukraine mit einem Sondertribunal in Den Haag für Aggressionen, das auf ukrainischem Recht fußt und um internationale Elemente ergänzt wird. Als Ergänzung zum Internationalen Strafgerichtshof kann es dort aktiv werden, wo dieser wegen der Lücke derzeit nicht tätig werden kann.
Zum anderen wird Außenministerin Baerbock beim Festakt in New York und der anschließenden Paneldiskussion auf Ministerebene dafür werben, den für 2025 vorgesehenen Überprüfungsprozess des Kompromisses von Kampala zu nutzen, um praktische Änderungen des Römischen Statuts vorzunehmen, um den Anforderungen der Gegenwart und Zukunft gerecht zu werden. Neben Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen soll auch der Tatbestand der Aggression so umfänglich verfolgt werden können, dass es ausreicht, wenn der Opferstaat unter die IStGH-Jurisdiktion fällt.
Weiter wirbt Deutschland bei allen Staaten, die bislang nicht Teil des IStGH sind, dafür, das Römische Statut und die Einigung von Kampala zu unterschreiben und ratifizieren.
Außenministerin Baerbock vor der Reise nach New York:
In den Augen der Täter ist der IStGH schon jetzt ein scharfes Schwert. Und in den Augen der Opfer ist er die Hoffnung darauf, dass ihr Leid nicht ungestraft bleibt. Deshalb schmerzt eine Lücke in der Strafverfolgung besonders: Das Verbrechen der Aggression, das Verbrechen gegen das kostbarste Gut, das wir haben: unseren Frieden. Hier sind die Hürden für eine Strafverfolgung noch zu hoch. Niemand darf im 21. Jahrhundert einen Angriffskrieg führen und straflos bleiben. Deshalb wollen wir gemeinsam mit Partnern das Völkerrecht weiterentwickeln, so dass es unseren Realitäten im 21. Jahrhundert gerecht wird.
Sitzung des Sicherheitsrats
Bei der Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen am Nachmittag, bei der auch Außenministerin Baerbock sprechen wird, wird die Situation in der Ukraine, insbesondere in Bezug auf die internationalen Friedensbemühungen und die humanitären Belange, diskutiert werden.
Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH), auf Englisch International Criminal Court (ICC), in Den Haag ist ein unabhängiger, ständiger Gerichtshof zur Ahndung von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen der Aggression. Er dient damit auch der Abschreckung vor solchen Taten. Derzeit ist das Römische Statut zum IStGH von 123 Staaten ratifiziert, es hat 31 Gerichtsurteile gegeben und 10.000 Opfer waren in den Verfahren beteiligt.
In seiner Arbeit geleitet wird der Gerichtshof durch das Römische Statut, das am 17. Juli 1998 verabschiedet wurde und am 1. Juli 2002 in Kraft trat.
Deutschland ist mit ca. 20 Millionen Euro im Jahr 2023 zweitgrößter Beitragszahler nach Japan. Deutschland hat frühzeitig zusammen mit 42 weiteren Staaten den IStGH mit den russischen Verbrechen in der Ukraine befasst und unterstützt diese. Gegenwärtig ist Prof. Dr. Bertram Schmitt als deutscher Richter am IStGH tätig. Die von der Bundesregierung unterstützte Kandidatin für seine Nachfolge ist die Richterin am Bundesgerichtshof, Dr. Ute Hohoff.
Deutschland gibt sich erstmals eine umfassende China-Strategie
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Der Text der China-Strategie der Bundesregierung ist ab sofort hier abrufbar:
China hat in den letzten Jahrzehnten starkes Wirtschaftswachstum und beachtlichen Wohlstand erreicht und die Armut im Land auf beeindruckende Art verringern können. Dabei haben China und auch Europa vom verstärkten politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Austausch sehr profitiert.
Diesen positiven Entwicklungen in China stehen Rückschritte bei bürgerlichen und politischen Rechten gegenüber. Und Chinas Wirtschaftspolitik zielt darauf, die eigene Abhängigkeit vom Ausland zu verringern, während es die Abhängigkeiten anderer von China zu steigern sucht. Außenpolitisch tritt China deutlich offensiver auf und versucht, die bestehende regelbasierte internationale Ordnung umzugestalten – mit Auswirkungen auch auf die europäische und globale Sicherheit.
Mit diesen Herausforderungen, vor die uns China stellt, müssen wir umgehen – und zugleich den Austausch und die Zusammenarbeit mit China weiterhin suchen und stärken. China bleibt für uns unverzichtbarer Partner zur Bekämpfung des Klimawandels, zur Lösung der Schuldenkrisen einzelner Staaten, für Ernährungssicherheit und damit auch für Stabilität weltweit. China ist zugleich Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale. Diesen Dimensionen trägt die China-Strategie der Bundesregierung Rechnung.
Was steht in der China-Strategie?
Die Strategie legt die Sichtweise der Bundesregierung auf den Stand und die Perspektiven der Beziehungen mit China dar. Sie versetzt die Bundesregierung in die Lage, in diesen komplexen Beziehungen unsere Werte und Interessen besser zu verwirklichen. Sie zeigt Wege und Instrumente auf, um angesichts des Wettbewerbs und der systemischen Rivalität die Zusammenarbeit mit China fortzusetzen, ohne unsere freiheitlich-demokratische Lebensweise, unsere Souveränität, unseren Wohlstand, unsere Partnerschaften mit anderen oder unsere Sicherheit zu gefährden. Sie soll den Rahmen setzen, innerhalb dessen die einzelnen Ministerien ihre Politik gegenüber China kohärent gestalten. Und sie soll die Grundlage bilden für verstärkte chinapolitische Koordinierung in Deutschland, in Europa und darüber hinaus.
Zum Cover der China-Strategie:
Das chinesische Strategiespiel Weiqi (围棋) - in Europa auch bekannt unter dem Namen Go - gehört zu den ältesten bekannten Brettspielen der Welt.
Gespielt wird Weiqi von zwei Personen, die abwechselnd schwarze oder weiße Steine auf ein quadratisches Gitterfeld setzen. Es gibt 10 hoch 170 mögliche Konstellationen der Spielsteine auf dem Brett. Anders als bei Schach geht es bei Weiqi nicht um das Mattsetzen des Gegners, sondern um das Erlangen vorteilhafter Positionen und die Verteidigung sogenannter „Freiheiten“.
NATO-Gipfel 2023 in Litauen
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

 Der noch immer andauernde Krieg Russlands gegen die Ukraine führt deutlich vor Augen, dass die NATO der Garant unserer Sicherheit ist. Als Organisation, die für die Sicherheit von fast einer Milliarde Bürgerinnen und Bürgern in den NATO-Staaten sorgt, wird es darum gehen, wie sich das Bündnis hier noch besser aufstellen kann. Dazu wird der Gipfel drei neue regionale Verteidigungspläne verabschieden.
Der noch immer andauernde Krieg Russlands gegen die Ukraine führt deutlich vor Augen, dass die NATO der Garant unserer Sicherheit ist. Als Organisation, die für die Sicherheit von fast einer Milliarde Bürgerinnen und Bürgern in den NATO-Staaten sorgt, wird es darum gehen, wie sich das Bündnis hier noch besser aufstellen kann. Dazu wird der Gipfel drei neue regionale Verteidigungspläne verabschieden.
Die Vereinbarung von Wales 2014 zu den Verteidigungsausgaben für die NATO läuft dieses Jahr aus. Die Bündnispartner werden in Vilnius noch ehrgeizigere Ziele vereinbaren. Jährlich sollen mindestens 2% des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investiert werden. Die Partner sind dabei schon jetzt auf einem guten Weg: die Verteidigungsausgaben der europäischen Bündnispartner und Kanadas im Jahr 2023 weisen einen realen Anstieg von 8,3% auf. Deutschland hat sich bereits in der Nationalen Sicherheitsstrategie dazu bekannt, im Durchschnitt mindestens zwei Prozent seines BIP für Verteidigung auszugeben.
NATO-Ukraine Partnerschaft im Zentrum des Gipfels
 Zentrales Thema wird sein, wie die Ukraine näher an das Bündnis herangeführt werden kann. Dazu wird der Gipfel ein mehrjähriges Unterstützungsprogramm auf den Weg bringen. Ziel ist es, die Zusammenarbeit mit NATO-Streitkräften einfacher zu machen. Expertinnen und Experten sprechen hier von Interoperabilität. Zudem hebt das Bündnis die politischen Beziehungen zur Ukraine auf eine neue Ebene. Erstmals tagt der neuen NATO-Ukraine-Rat. Bei den Treffen dieses Rats sitzen die Mitglieder der NATO und der Partner gleichberechtigt am Tisch und definieren gemeinsam das Arbeitsprogramm und die Agenda. Mit einem dichten Tagungsrhythmus ‑ mindestens viermal im Jahr ‑ wird auf Augenhöhe besprochen, wie die Partnerschaft weiterentwickelt werden soll.
Zentrales Thema wird sein, wie die Ukraine näher an das Bündnis herangeführt werden kann. Dazu wird der Gipfel ein mehrjähriges Unterstützungsprogramm auf den Weg bringen. Ziel ist es, die Zusammenarbeit mit NATO-Streitkräften einfacher zu machen. Expertinnen und Experten sprechen hier von Interoperabilität. Zudem hebt das Bündnis die politischen Beziehungen zur Ukraine auf eine neue Ebene. Erstmals tagt der neuen NATO-Ukraine-Rat. Bei den Treffen dieses Rats sitzen die Mitglieder der NATO und der Partner gleichberechtigt am Tisch und definieren gemeinsam das Arbeitsprogramm und die Agenda. Mit einem dichten Tagungsrhythmus ‑ mindestens viermal im Jahr ‑ wird auf Augenhöhe besprochen, wie die Partnerschaft weiterentwickelt werden soll.
Die Staats- und Regierungschefs Australiens, Neuseelands, Japans und Südkoreas werden ebenfalls an dem Gipfel in Vilnius an einer Sitzung teilnehmen. Zudem sind die Spitzen der Europäischen Union anwesend. Diese Sitzung wird dem Austausch mit den Partnern zu Fragen der Resilienz im umfassenden Sinne dienen. Hier ist die EU ein strategischer Partner der NATO. In den Bereichen von Cyber, hybrider Bedrohung oder auch Energiesicherheit ergänzen sich beide Organisationen.
Litauen erstmals Gastgeber eines NATO-Gipfels
 Litauen ist seit fast zwei Jahrzehnten NATO-Mitglied und zum ersten Mal Gastgeber eines NATO-Gipfels.
Litauen ist seit fast zwei Jahrzehnten NATO-Mitglied und zum ersten Mal Gastgeber eines NATO-Gipfels.
Dies ist der erste Gipfel mit Finnland als NATO-Bündnispartner. Der schwedische Beitritt ist noch nicht vollzogen, da die Ratifikation der Türkei und Ungarns noch ausstehen. Trotzdem ist Schweden als sogenannter „invitee“ bereits im Saal. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass der Beitritt zügig kommt.
Meilenstein für die Abrüstung: Letzte offiziell deklarierte Chemiewaffen wurden vernichtet
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Die ersten Chemiewaffen bestanden aus giftigen Industriegasen, wie z. B. Phosgen oder Chlor. Später entwickelte man neue Kampfstoffe speziell für die militärische Kriegsführung. Bei Soldatinnen und Soldaten waren Chemiewaffen seit dem Ersten Weltkrieg besonders gefürchtet, da der Tod qualvoll ist und sich oft nicht sofort einstellt. Überlebende leiden zudem häufig unter dauerhaften Schäden. Die völkerrechtlich verbindliche Ächtung dieser Waffen mit dem Chemiewaffenübereinkommen, welches 1997 in Kraft trat, war der Startschuss für umfassende Vernichtungsaktivitäten, zu denen sich die acht Besitzerstaaten chemischer Waffen verpflichtet haben.
Vernichtung von über 70.000 Tonnen chemischer Waffen
Die Vernichtung der über 70.000 Tonnen chemischer Waffen, größtenteils Bestände aus dem Kalten Krieg, war ein enormer Kraftakt. Die zur Überwachung der Vernichtung und des Verbots von Chemiewaffen geschaffene Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) wurde für ihre Arbeit bereits 2013 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.
Deutschland, das bei Abschluss des Chemiewaffenübereinbkommens selbst über keine solchen Waffen verfügte, hat die weltweite Vernichtung chemischer Waffen entschieden unterstützt. Allein für die Vernichtung der deklarierten chemischen Waffen in Russland haben wir über 350 Mio. EUR beigetragen, weitere 15 Mio. EUR für die Vernichtung der Bestände in Irak, Libyen und Syrien. Damit wurden unter anderem Chemiewaffen-Vernichtungsanlagen vor Ort gebaut, um diese gefährlichen Waffen sicher und umweltgerecht zu vernichten.
Aber noch nicht am Ziel einer chemiewaffenfreien Welt
Wir sind allerdings noch lange nicht am Ziel einer chemiewaffenfreien Welt. Der Einsatz von Chemiewaffen in Syrien und die Verwendung verbotener chemischer Kampfstoffe zur Vergiftung Oppositioneller wie im Fall Nawalny, unter Verstoß gegen die Verpflichtungen aus dem Chemiewaffenübereinkommen, zeigen die Gefahr einer Wiederkehr von Chemiewaffen. Es besteht Grund zur Sorge, dass chemische Waffen in Russlands völkerrechtswidrigem Angriffskrieg gegen die Ukraine zum Einsatz kommen könnten. Vier Staaten, darunter Nordkorea, sind dem Chemiewaffenübereinkommen bisher nicht beigetreten. Unser Einsatz für eine Welt ohne Chemiewaffen ist daher nicht beendet: Deutschland wird sich auch zukünftig für eine stark aufgestellte OVCW und für die weltweite Ächtung von Chemiewaffen einsetzen.
Deutschland ist mit einem Pflichtbeitrag von 4,2 Mio. EUR der drittgrößte Beitragszahler der OVCW. Darüber hinaus haben wir der OVCW seit 2020 zusätzlich ca. 4 Mio. EUR zur Verfügung gestellt, u.a. zur Aufklärung von Chemiewaffeneinsätzen in Syrien, für die Ausbildung von OVCW-Inspektoren und zur Unterstützung afrikanischer Staaten bei der Umsetzung ihrer Verpflichtungen.
Tipps für Leipzig: Hier ist Leipzig im Sommer besonders schön
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Trödeln im Hinterhof, Cornern am Kanusteg, Baden in meergrünen Gruben: Die schönsten Ecken in und um Leipzig erinnern an Italien oder Berlin – man muss sie nur finden. Unsere Autorinnen und Autoren verraten ihre Geheimtipps...
EU Global Gateway: Globale Partnerschaften für demokratische und nachhaltige Standards
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Infrastruktur ist das, was die Welt am Laufen hält: Schienen, Häfen und Straßen, aber auch Kraftwerke, Stromleitungen, Datenkabel, Wasserrohre, Bildungs- und Gesundheitssysteme zählen dazu. Nach Schätzungen der G20 werden bis 2040 etwa 13 Billionen Euro fehlen, um globale Infrastrukturlücken zu schließen. Genau dort setzt die EU mit Global Gateway an und verbindet Infrastrukturprojekte mit der Förderung von Demokratie, Nachhaltigkeit und Resilienz.
Geopolitisches Instrument zur Schließung von Infrastrukturlücken und Reduzierung von Abhängigkeiten
Mit Global Gateway hat die EU ein geopolitisches Instrument geschaffen, um in die Infrastruktur in Partnerländern der Europäischen Nachbarschaft, Afrika, Lateinamerika und der Karibik und Asien dauerhaft und nachhaltig zu investieren. Denn Global Gateway ist ein faires und nachhaltiges Angebot ohne versteckte Abhängigkeiten, das sich auf die spezifischen Bedarfe der Partnerländer fokussiert. Die Bundesregierung unterstützt die EU-Kommission bei der Umsetzung von Global Gateway tatkräftig finanziell, politisch und mit Knowhow. Ziel ist es, Partnerschaften nachhaltig auszubauen und mit geopolitischen Zielen zu verknüpfen.
Außenministerin Baerbock sagte zu Global Gateway:
Im Systemwettbewerb genügt es nicht, gute Argumente für unser liberal-demokratisches Modell zu haben. Wir müssen anderen Ländern auch zeigen, dass wir als EU damit die besseren Angebote machen können – transparent, auf Augenhöhe, ohne Knebelverträge. Deshalb ist Global Gateway so wichtig, gerade bei großen Zukunftsthemen wie Klimaschutz, Energietransformation und Digitalisierung.
Weltweite Partnerschaften für mehr Demokratie, Nachhaltigkeit und Resilienz
Global-Gateway-Investitionen sollen bilaterale Partnerschaften stärken und die EU in einer wettbewerbsorientierten Welt besser positionieren. Zugleich sollen Global Gateway-Projekte auch die globale Energie- und Ernährungssicherheit und Resilienz von Lieferketten stärken. Global Gateway ist damit auch eine Antwort auf die globalen Verwerfungen durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Die Umsetzung von Global Gateway erfolgt durch regionale Partnerschaften. Zum Beispiel durch das EU-Afrika-Global-Gateway-Investitionspaket, das auf dem Gipfeltreffen der EU und der Afrikanischen Union im Februar 2022 verabschiedet wurde und bei dem Infrastrukturprojekte in Höhe von 150 Milliarden Euro vereinbart wurden. Auch bei der EU-Zentralasien-Konnektivitätskonferenz im November 2022 in Samarkand, dem EU-ASEAN-Gipfel im Dezember 2022 in Brüssel und dem Indopazifik-Forum im Februar 2022 in Paris spielte Global Gateway eine wichtige Rolle. Für 2023 stehen eine EU-Investitionsagenda mit Lateinamerika und der Karibik sowie die weitere Umsetzung von Projekten in Afrika und der Südlichen Nachbarschaft im Fokus.
Global Gateway Leuchtturmprojekte
Im September 2022 hat die Europäische Kommission fünf Leuchtturmprojekte vorgestellt, die über Global Gateway gefördert werden:
- ein Wasserkraftwerk in Rogun, Tadschikistan
- ein Projekt zur Erzeugung von grünem Wasserstoff in Chile
- ein Projekt zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und zur Förderung von kritischen Rohstoffen in Namibia
- der Ausbau des Hafens von Maio und Mindelo in Cabo Verde
- die Unterstützung der Impfstoffherstellung in fünf afrikanischen Ländern
2023 ist diese Liste auf 87 größere und hunderte kleinere Projekte angewachsen. Global Gateway leistet damit schon jetzt einen wertvollen Beitrag und verbessert das Leben der Menschen in Partnerländern und der EU.
Weitere Informationen
Aktuelle Informationen der Europäischen Kommission zu Global Gateway finden Sie hier.
Interessierte Firmen können sich auf dem Team-Europe-Partnerships-Portal registrieren und so auch an Global Gateway mitwirken.
Auch die Germany Trade and Invest (GTAI) informiert zu Global Gateway. Auf der Seite finden Sie aktuelle Analysen zu Global Gateway, die wichtigsten Leuchtturmprojekte und Erfahrungsberichte von beteiligten Firmen. Zudem können Sie aktuelle Ausschreibungen für Projekte abrufen.
Die EU-Konnektivitätsinitiative Global Gateway wurde am 1. Dezember 2021 durch die Europäische Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst vorgestellt. Sie baut auf Vorarbeiten der EU-Asien-Konnektivitätsstrategie von 2018 auf und soll zu einer Verbesserung der globalen Konnektivität beitragen. Im Einklang mit der Agenda 2030 der Vereinten Nationen und ihren Zielen für nachhaltige Entwicklung sowie dem Pariser Klimaabkommen sollen mit Global Gateway weltweit Projekte für hochwertige und nachhaltige Infrastruktur in den Bereichen Digitales, Energie und Klima, Transport, Gesundheit, Bildung und Forschung initiiert und in Partnerschaften umgesetzt werden. Dafür sollen zwischen 2021 und 2027 Investitionen in Höhe von bis zu 300 Milliarden Euro in einem „Team Europe“-Ansatz mobilisiert werden: Die EU und ihre Mitgliedstaaten, nationale und europäische Entwicklungsbanken und die Privatwirtschaft arbeiten hierfür Hand in Hand.
Global Gateway ist außerdem der Beitrag der EU und der EU-Mitgliedstaaten zur G7 Partnerschaft für globale Infrastruktur und Investitionen (G7 PGII).
Deutschland übergibt Vorsitz des Ostseerats an Finnland
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Die Folgen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine prägten das deutsche Vorsitzjahr. Im Mai 2022 trat Russland aus dem Ostseerat aus. Ein zentrales Anliegen des deutschen Vorsitzes war es daher, die zukünftige Ausrichtung des Ostseerats zu gestalten, der lange als eines der letzten verbliebenen Kooperationsformate mit Russland galt. Die verbliebenen Mitglieder waren sich schnell einig, dass der Ostseerat weiter gebraucht wird: als Forum für politischen Dialog und praktische Zusammenarbeit in der Region. Unter der deutschen Präsidentschaft ist es gelungen, den Ostseerat als eine solche Plattform für vertrauensvollen Austausch zu politisch aktuellen Themen neu aufzustellen.
Das Highlight des deutschen Präsidentschaftsjahres stellte das Treffen der Außenministerinnen und Außenminister des Rates sowie der EU am 1. und 2. Juni in Wismar dar. Dabei ging es insbesondere um die Themen Resilienz, erneuerbare Energien sowie Beseitigung von Munitionsaltlasten in der Ostsee. In Vorbereitung des bereits 20. Treffens der Außenministerinnen und Außenminister des Ostseerats fand eine Vielzahl von Projekten, Treffen und Initiativen entlang der drei Kernprioritäten des deutschen Vorsitzes statt.
Deutsche Prioritäten während des Präsidentschaftsjahres – Munitionsaltlasten, Offshore-Wind und Jugendbeteiligung
 Besonderer Fokus wurde während des deutschen Vorsitzes auf drei Schlüsselbereiche gelegt, die für die Sicherheit der Menschen in ihrem Alltag von besonderer Bedeutung sind: die Bergung von Munitionsaltlasten in der Ostsee, den Ausbau von Offshore‑Windenergie und die Förderung von Jugendbeteiligung.
Besonderer Fokus wurde während des deutschen Vorsitzes auf drei Schlüsselbereiche gelegt, die für die Sicherheit der Menschen in ihrem Alltag von besonderer Bedeutung sind: die Bergung von Munitionsaltlasten in der Ostsee, den Ausbau von Offshore‑Windenergie und die Förderung von Jugendbeteiligung.
Alleine 400.000 Tonnen konventionelle Weltkriegsmunition liegen auf dem Boden der Ostsee, dazu kommen noch einmal rund 40.000 Tonnen chemische Kampfstoffe. Diese Munitionsaltlasten in der Ostsee stellen eine enorme Herausforderung dar und eine Gefahr sowohl für Mensch als auch Umwelt. Diese Herausforderung lässt sich nur grenz- und länderübergreifend lösen.
 Die politische Abschlusserklärung des Ostseeratstreffens in Wismar erkennt dies als Ergebnis der deutschen Bemühungen erstmals als ein regionales Problem an, dem sich die Ostseeanrainer gemeinsam stellen müssen. Während der deutschen Präsidentschaft wurde im Dezember 2022 in Kiel ein multidisziplinärer Austausch mit Experteninnen und Experten verschiedener Fachrichtungen zu diesem Thema durchgeführt, Deutschland hat zudem ein Sofortprogramm von 100 Mio. Euro zur Bergung von Altlasten in Nord- und Ostsee aufgelegt.
Die politische Abschlusserklärung des Ostseeratstreffens in Wismar erkennt dies als Ergebnis der deutschen Bemühungen erstmals als ein regionales Problem an, dem sich die Ostseeanrainer gemeinsam stellen müssen. Während der deutschen Präsidentschaft wurde im Dezember 2022 in Kiel ein multidisziplinärer Austausch mit Experteninnen und Experten verschiedener Fachrichtungen zu diesem Thema durchgeführt, Deutschland hat zudem ein Sofortprogramm von 100 Mio. Euro zur Bergung von Altlasten in Nord- und Ostsee aufgelegt.
Der Ausbau von Offshore‑Windenergie war ein weiterer Fokus, insbesondere vor dem Hintergrund einer durch den russischen Angriffskrieg notwendig gewordenen Erhöhung europäischer Energiesouveränität. In der sogenannten „Berlin Declaration“ haben die Ostseeratsmitglieder unter anderem die sicherheitspolitische Notwendigkeit des Ausbaus der Offshore‑Windenergie in der Ostsee unterstrichen. In dieser Erklärung verpflichten sie sich zu ambitionierten Ausbauzielen für Offshore‑Wind in der Ostsee: Bis 2030 soll die Offshore-Windkraftleistung in der Ostsee versiebenfacht werden.
Um diese politischen Ziele insbesondere auch in die Privatwirtschaft zu tragen, veranstaltete das Auswärtige Amt – gemeinsam mit Dänemark – am 9. Mai 2023 im Auswärtigen Amt das Baltic Offshore Wind Forum. Rund 300 Teilnehmende nahezu aller Ostseeratsstaaten - aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft – konnten sich zum Thema Offshore‑Wind austauschen. Das Forum wurde von Außenministerin Baerbock eröffnet, gemeinsam mit ihrem dänischen und ihrem finnischen Amtskollegen.
Jugendbegegnungen
 Junge Menschen sind die Zukunft – auch im Ostseeraum. Ihre Beteiligung und ihre Ideen sind bei der Gestaltung von Antworten auf Europas Herausforderungen besonders wichtig. Das Auswärtige Amt setzte sich daher für die Schaffung des Baltic Sea Region Youth Forums (BSRYF) ein, das verschiedene Formate für Jugendbeteiligung entwickelt und organisiert. Ein Beispiel ist der Baltic Sea Youth Dialogue (BSYD), der im November 2022 in Hamburg zum Thema Zivilschutz stattfand. Im Vorfeld des Außenministertreffens in Wismar richtete das Auswärtige Amt zudem gemeinsam mit dem BSRYF das „CBSS Youth Ministerial“ aus. Hierzu kamen vom 21. bis 25. Mai 2023 30 junge Menschen aus den Mitgliedsstaaten des Ostseerats zu einem Projektworkshop zum Thema gesellschaftliche Resilienz in Berlin zusammen. Die jungen Erwachsenen erarbeiteten dort konkrete Projektideen, u. a. zu den Themen Bekämpfung von Desinformation, der stärkeren Einbindung von Jugendlichen im Bereich des Zivilschutzes und der Prävention und Erkennung von Menschenhandel. Fünf der jungen Teilnehmenden präsentierten die Ergebnisse des „CBSS Youth Ministerials“ den Außenministerinnen und Außenministern in Wismar.
Junge Menschen sind die Zukunft – auch im Ostseeraum. Ihre Beteiligung und ihre Ideen sind bei der Gestaltung von Antworten auf Europas Herausforderungen besonders wichtig. Das Auswärtige Amt setzte sich daher für die Schaffung des Baltic Sea Region Youth Forums (BSRYF) ein, das verschiedene Formate für Jugendbeteiligung entwickelt und organisiert. Ein Beispiel ist der Baltic Sea Youth Dialogue (BSYD), der im November 2022 in Hamburg zum Thema Zivilschutz stattfand. Im Vorfeld des Außenministertreffens in Wismar richtete das Auswärtige Amt zudem gemeinsam mit dem BSRYF das „CBSS Youth Ministerial“ aus. Hierzu kamen vom 21. bis 25. Mai 2023 30 junge Menschen aus den Mitgliedsstaaten des Ostseerats zu einem Projektworkshop zum Thema gesellschaftliche Resilienz in Berlin zusammen. Die jungen Erwachsenen erarbeiteten dort konkrete Projektideen, u. a. zu den Themen Bekämpfung von Desinformation, der stärkeren Einbindung von Jugendlichen im Bereich des Zivilschutzes und der Prävention und Erkennung von Menschenhandel. Fünf der jungen Teilnehmenden präsentierten die Ergebnisse des „CBSS Youth Ministerials“ den Außenministerinnen und Außenministern in Wismar.
Mitglieder des Ostseerats sind die acht Ostseeanrainer Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Litauen, Lettland, Polen und Schweden sowie Island, Norwegen und die EU. Die russische Mitgliedschaft und der belarussische Beobachterstatus wurden im März 2022 infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine suspendiert. Im Mai 2022 gab Russland seinerseits seinen Austritt aus dem Ostseerat bekannt. Seit seiner Gründung hat sich der Ostseerat zu einem breiten Netzwerk zwischenstaatlicher Kooperation auf zahlreichen Fachgebieten rund um die Ostsee entwickelt. Der Ostseerat verfolgt drei Langzeitprioritäten:
- Schaffung einer regionalen Identität
- Förderung einer Region der Nachhaltigkeit und des Wohlstands
- Förderung einer Region der Sicherheit.
Gemeinsam für feministische Außenpolitik – Außenministerin Baerbock reist in die Mongolei
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

 Zwischen Russland und China eingebettet liegt die Mongolei – ein Staat, der trotz seiner beiden weitaus größeren Nachbarn seinen demokratischen und eigenständigen Weg geht und mit Deutschland viele Werte teilt.
Zwischen Russland und China eingebettet liegt die Mongolei – ein Staat, der trotz seiner beiden weitaus größeren Nachbarn seinen demokratischen und eigenständigen Weg geht und mit Deutschland viele Werte teilt.
Aufgrund ihrer exponierten geopolitischen Lage sucht sich die Mongolei zusätzlich „dritte Nachbarn“, enge Partner auch weit weg von den eigenen Grenzen mit Russland und China. Deutschland ist ein solcher „dritter Nachbar“, auch weil die Demokratien der Welt zusammenstehen müssen – über hohe Gebirge und Steppen hinweg.
Annalena Baerbock:
Die Mongolei befindet sich in einer unglaublich herausfordernden geographischen Lage. Als dünn besiedeltes Binnenland mit der Einwohnerzahl von Berlin teilt sich die Mongolei mehr als 8.000 Kilometer Grenze mit zwei deutlich größeren Nachbarn: Russland im Norden und China im Süden. Alle Exporte und Importe der Mongolei müssen durch diese beiden Länder. Zwischen diesen Riesen behauptet sich die Mongolei als Demokratie und entwickelt daraus Strahlkraft weit über die eigene Nachbarschaft hinaus.
Am ersten Tag ihrer Reise wird Außenministerin Annalena Baerbock gemeinsam mit der mongolischen Außenministerin Batmunkh Battsetsegund der französischen Außenministerin Catherine Colonna Gastgeberin des Außenministerinnentreffens sein. Auf der Tagesordnung stehen Themen wie etwa die Rolle von Frauen bei der Schaffung von Frieden und Sicherheit.
Annalena Baerbock:
Ich möchte das Außenministerinnen-Treffen in Ulan Bator vor allem nutzen, um unseren asiatischen und afrikanischen Partnerinnen zuzuhören und im direkten Austausch mehr über ihren Einsatz für Frauenrechte und Gleichberechtigung zu erfahren. Die Mongolei gehört zum Beispiel seit Jahren zu den Ländern, die die meisten Frauen in Peacekeeping-Operationen der Vereinten Nationen entsenden. Mich interessiert, wie wir von diesen Erfahrungen auch für unsere Beteiligung an UN-Missionen lernen können. Denn die Beteiligung von Frauen ist ein Gradmesser für den Zustand unserer Gesellschaften. Wo alle Menschen gleiche Rechte und Chancen haben, profitieren alle.
Am zweiten Tag wird Außenministerin Baerbock bilaterale Gespräche mit der mongolischen Regierung führen, sowie das mongolische Engagement bei Friedensmissionen der Vereinten Nationen würdigen.
Hierfür wird sie ein Einsatzkontingent besuchen, bei dem mongolische Soldatinnen und Soldaten durch die Bundeswehr ausgebildet werden. Von 2009 bis 2021 standen mongolische Streitkräfte als verlässlicher Partner an der Seite der Bundeswehr in Afghanistan.
So buchen Sie möglichst günstig Ihren Urlaub: Inkognito zum Billig-Ticket
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Auf Last-minute-Angebote zu hoffen, lohnt sich in diesem Jahr kaum. Mit einigen Tricks lässt sich dennoch viel Geld bei der Buchung von Ferienwohnungen oder Flügen sparen. Wir haben die wichtigsten Tipps gesammelt...
Lebenswerteste Städte: Was haben Wien oder Kopenhagen, was Hamburg und Berlin nicht haben?
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Metropolen im Nahen Osten werden immer lebenswerter, sagt eine Studie des britischen »Economist«. Hier erklärt ein Stadtforscher, warum es bei solchen Rankings auch ums Geld geht. Und weshalb sich deutsche Städte schwertun...
Stuttgart: Tipps für Spaziergänge, Wanderungen, Picknick
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Im Ranking der lebenswerten Städte der Welt sprang Stuttgart etliche Plätze nach oben. Hier erfahren Sie, was die schwäbische Metropole so reizvoll macht und welche besonders grünen Ecken der Stadt Sie kennen sollten...
Thaidene Nene in den Nordwest-Territorien: Das ist Kanadas neuester Nationalpark
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Der Thaidene-Nene-Nationalpark lässt sich nur per Propellermaschine und Boot erreichen: Mit Dutzenden von Seen, Wasserfällen und Klippen ist er eine Welt für sich...
Überleben sichern: Wie kann Deutschland den Menschen in Syrien helfen?
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Aufwachsen zwischen Krieg, Armut und Hunger
Ein Kind, das 2011 in Syrien geboren wurde, steht mittlerweile kurz vor dem Teenageralter. Frieden hat es in seiner Kindheit nicht erlebt. Wenn es großes Glück hat, kann es zur Schule gehen – wenn diese nicht wie etwa ein Drittel aller Schulen vom Krieg zerstört worden ist. Wahrscheinlich hat es, wie ein Großteil der Bevölkerung, nur unsichere Alternativen zu sauberem Wasser und womöglich benötigt es wie über fünf Millionen weitere Frauen, Männer und vor allem Kinder im Land Nahrungsmittelhilfe zum Überleben. Schlimmer noch: Das Kind sieht keine Verbesserung der Situation.
Noch nie waren die humanitären Bedarfe der notleidenden syrischen Bevölkerung so hoch wie heute - Tendenz steigend. Hierzu haben die schrecklichen Erdbeben in der Türkei und im Norden Syriens dieses Jahr zusätzlich beigetragen. Damit die von der Syrien-Krise betroffenen Menschen nicht die Hoffnung verlieren und um sie mit dem Nötigsten zu versorgen, bedarf es der fortdauernden Unterstützung der Staatengemeinschaft.
Worum geht es bei der heutigen Syrien-Konferenz in Brüssel?
Heute werden bei einer internationalen Konferenz in Brüssel dringend benötigte Hilfsgelder für die Menschen in Syrien und der Region gesammelt. Deutschland sagt gut 1 Milliarde Euro zu. Das Geld fließt in Hilfsprojekte wie beispielsweise der Deutschen Welthungerhilfe. In den Provinzen Idlib und Aleppo verteilt die Deutsche Welthungerhilfe Lebensmittelgutscheine und Brot, unterstützt Bäckereien bei der Produktion und verteilt zum Beispiel auch Saatgut, Düngemittel und Werkzeuge. Saatgut und Düngemittel werden an Binnenflüchtlinge in Aleppo und Idlib verteilt, damit Syrer und Syrerinnen die lokale Lebensmittelproduktion wieder selber ein Stück weit ankurbeln können und so hoffentlich ein klein wenig Kontrolle über ihr Leben und ihre Sicherheit wiedererlangen. Zudem wird zum Beispiel eine kleine Anzahl von Menschen im Gemüseanbau geschult.
Die Konferenz legt auch einen Schwerpunkt auf die Lage in den Nachbarstaaten, die seit Jahren Hauptaufnahmeländer syrischer Flüchtlinge sind. Hierzu gehören Türkei, Libanon, Jordanien, Irak und Ägypten. Die Flüchtlinge haben das Recht auf die Bereitstellung einer adäquaten Unterkunft, von Hygiene- und Gesundheitsversorgung, Sicherheit, Schutz und Nahrung. Die Bundesregierung unterstützt diese Länder, die Herausforderungen zu meistern, die mit der Versorgung der Flüchtlinge verbunden sind.
Letztlich wird jedoch nur eine politische Lösung des Konflikts die Grundursachen des Leids adressieren können. Die Resolution 2254 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen legt dafür die Grundlage. Entsprechend setzt sich die Bundesregierung gemeinsam mit ihren Partnern für eine friedliche Lösung des Konflikts entlang dieser Resolution ein.
Insgesamt hat die Bundesregierung von 2012 bis Ende 2022 rund 17 Milliarden Euro zur Unterstützung der Menschen in Syrien und in den von der Krise betroffenen Nachbarstaaten beigetragen.
Reise-YouTuber Mike Corey: »Je mehr wir von der Welt sehen, desto weniger Angst müssen wir haben«
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Der Kanadier Mike Corey zeigt in seinen Videos eine schillernde Welt voller Abenteuer. Hier berichtet er von Begegnungen mit bedrohten Kulturen, echter und eingebildeter Gefahr und Kuhdung im Gesicht...
Nationale Sicherheitsstrategie vom Bundeskabinett verabschiedet
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Der Text der Nationalen Sicherheitsstrategie ist ab sofort auf https://www.nationalesicherheitsstrategie.de/ abrufbar.
Unsere Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit. Das wissen wir spätestens seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Freiheit muss aktiv geschützt und verteidigt werden. Aber persönliche Sicherheit geht über den Schutz vor Krieg und Gewalt hinaus. Sicherheit bedeutet auch, keine Sorgen hinsichtlich der Strom- und Gasversorgung zu haben und in der Apotheke verlässlich lebensnotwendige Medikamente zu bekommen. Sicherheit bedeutet, im Internet nicht ausspioniert oder bei der Nutzung von sozialen Netzwerken von ausländischen Bots manipuliert zu werden. Sicherheit bedeutet Schutz vor den Folgen der Klimakrise und dem Verlust von Biodiversität.
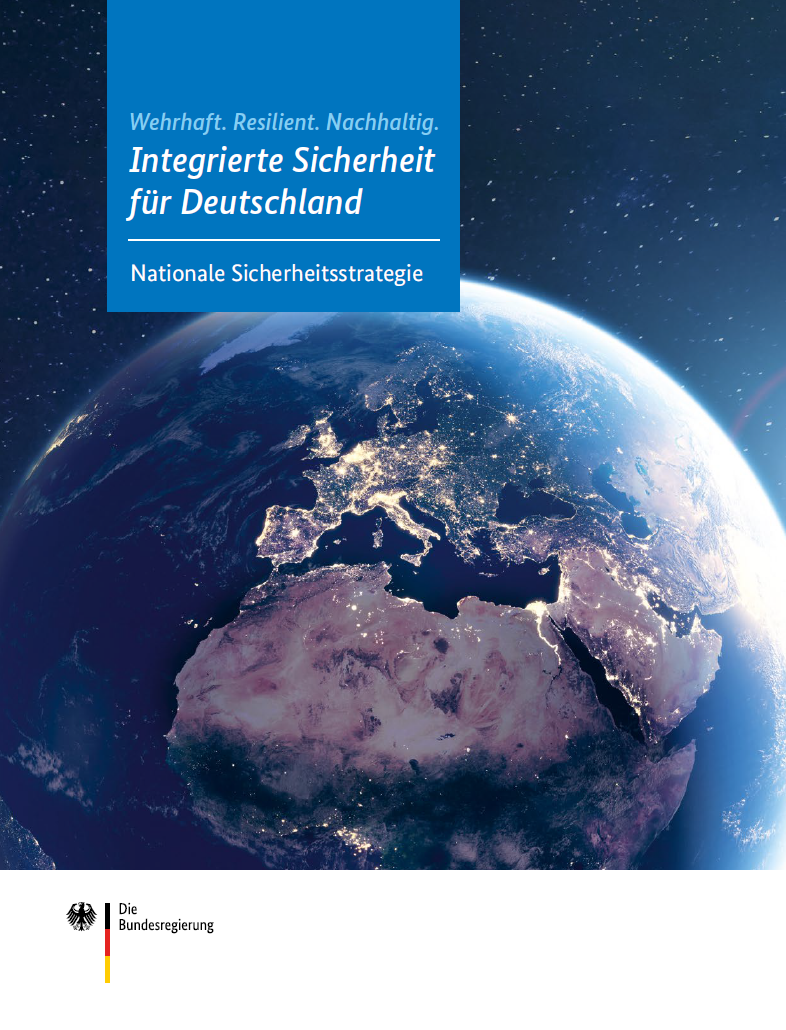 Die Nationale Sicherheitsstrategie legt Deutschlands Rolle in Zeiten globaler Machtverschiebungen und systemischer Rivalität dar und gibt Antworten auf die Bedrohungen von außen auf unsere Demokratie und unsere freiheitliche Grundordnung. Sie definiert Sicherheitspolitik umfassend und auf den einzelnen Menschen ausgerichtet.
Die Nationale Sicherheitsstrategie legt Deutschlands Rolle in Zeiten globaler Machtverschiebungen und systemischer Rivalität dar und gibt Antworten auf die Bedrohungen von außen auf unsere Demokratie und unsere freiheitliche Grundordnung. Sie definiert Sicherheitspolitik umfassend und auf den einzelnen Menschen ausgerichtet.
Der Ansatz dieser Strategie ist der einer Integrierten Sicherheit. Das bedeutet, Sicherheit ist Bestandteil aller Politikbereiche – nicht nur von Militär und Diplomatie - und beschreibt ein ihnen gemeinsames Ziel. Jeder Politikbereich ist von einer verschlechterten Sicherheitslage betroffen, jeder kann zur Verbesserung der Sicherheit unseres Landes beitragen.
Die drei zentralen Dimensionen deutscher Sicherheitspolitik sind dabei Wehrhaftigkeit, Resilienz und Nachhaltigkeit.
»Air Defender 2023«: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Nato-Luftwaffenübung
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Über Deutschland hat die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der Nato begonnen. Fallen Passagierflüge deshalb aus? Welche Flugzeuge lärmen über deutschem Himmel? Und: Ist das für Menschen gefährlich? ...
Sicherheit im Ostseeraum gemeinsam gestalten – Treffen des Ostseerats in Wismar
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Von Oslo nach Wismar: Nach Ende des NATO-Treffens in Oslo wird Außenministerin Baerbock heute nach Wismar weiterreisen. Der Grund dafür ist der aktuelle Vorsitz Deutschlands im Ostseerat. Außenministerin Baerbock hat ihre Amtskolleginnen und Amtskollegen der Mitgliedsstaaten des Ostseerats für den 1. und 2. Juni nach Wismar eingeladen. Die Hansestadt an der Ostseeküste steht mit ihrer Geschichte wie kaum ein anderer Ort Deutschlands für die engen Verflechtungen im Ostseeraum, aber auch für eine über die Jahrhunderte wechselvolle Geschichte der Region.
Folgen von Russlands Krieg gegen die Ukraine
Der Ostseerat ist eine Regionalorganisation mit Sitz in Stockholm, die 1992 gegründet wurde. Mitglieder sind derzeit acht Ostseeanrainerstaaten: Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Litauen, Lettland, Polen und Schweden; sowie Island, Norwegen und die EU. Die außen- und sicherheitspolitische Lage im Ostseeraum hat sich durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine stark verändert – diese neue sicherheitspolitische Realität wird selbstverständlich auch bei dem Treffen in Wismar eine Rolle spielen. Russlands Mitgliedschaft wurde infolge des Angriffs auf die Ukraine durch die übrigen Mitglieder suspendiert. Russland ist anschließend im Mai 2022 aus der Organisation ausgetreten.
Die elf Mitglieder haben daraufhin entschieden, den Ostseerat noch stärker als Forum für den politischen Dialog und die praktische Zusammenarbeit zu nutzen. Seit seiner Gründung hat sich der Ostseerat zu einem breiten Netzwerk zwischenstaatlicher Kooperation auf zahlreichen Fachgebieten rund um die Ostsee entwickelt.
Prioritäten des deutschen Vorsitzes im Ostseerat: Energie, Jugendaustausch und Munitionsbergung
 Konkret werden bei dem Treffen in Wismar u.a. die drei Schwerpunktthemen des einjährigen deutschen Vorsitzes besprochen. Zum einen ist es das gemeinsame Ziel, die Energiesicherheit im Ostseeraum durch den Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere von Offshore-Windkraft, zu stärken. Mit diesem Thema werden sich die Außenministerinnen und Außenminister während ihres Arbeitsessens im Stadtgeschichtlichen Museum Wismar im Schabbellhaus befassen. Anfang Mai 2023 fand im Auswärtigen Amt das „Baltic Offshore Wind Forum“ statt, bei dem sich staatliche und wirtschaftliche Akteure aus dem gesamten Ostseeraum über die Herausforderungen des Ausbaus der Windkraft und Energieinfrastruktur in der Ostsee ausgetauscht haben. Dabei ging es um konkrete Wege zum Ausbau: So haben bei dem Forum beispielsweise Unternehmen aus Deutschland und dem Baltikum vereinbart, die Netzinfrastruktur zur Übertragung von Strom aus baltischen Offshore-Windparks auszubauen.
Konkret werden bei dem Treffen in Wismar u.a. die drei Schwerpunktthemen des einjährigen deutschen Vorsitzes besprochen. Zum einen ist es das gemeinsame Ziel, die Energiesicherheit im Ostseeraum durch den Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere von Offshore-Windkraft, zu stärken. Mit diesem Thema werden sich die Außenministerinnen und Außenminister während ihres Arbeitsessens im Stadtgeschichtlichen Museum Wismar im Schabbellhaus befassen. Anfang Mai 2023 fand im Auswärtigen Amt das „Baltic Offshore Wind Forum“ statt, bei dem sich staatliche und wirtschaftliche Akteure aus dem gesamten Ostseeraum über die Herausforderungen des Ausbaus der Windkraft und Energieinfrastruktur in der Ostsee ausgetauscht haben. Dabei ging es um konkrete Wege zum Ausbau: So haben bei dem Forum beispielsweise Unternehmen aus Deutschland und dem Baltikum vereinbart, die Netzinfrastruktur zur Übertragung von Strom aus baltischen Offshore-Windparks auszubauen.
Die Stärkung der Resilienz unserer demokratischen Gesellschaften, vor allem auch durch Bildung und Jugendaustausch, wird ein weiteres Thema sein. Im Rahmen des Treffens wird es einen gemeinsamen Austausch der Außenministerinnen und Außenminister des Ostseerats mit Jugendvertreterinnen und Jugendvertretern geben. Vom 21. bis 25. Mai haben junge Menschen aus den Mitgliedsstaaten des Ostseerats im Rahmen des „CBSS Youth Ministerials“ in Berlin gemeinsam Projekte zur Stärkung gesellschaftlicher Resilienz in der Region entwickelt, die sie nun in Wismar vorstellen werden.
Eine Last aus der Geschichte im Ostseeraum, vor allem aus den Weltkriegen, sind Munitions- und Kampfmittelaltlasten auf dem Meeresgrund. Das Ostseeratstreffen beginnt daher auch mit einem Austausch und der Präsentation von Technik zur Bergung von Munitionsaltlasten durch Forschungseinrichtungen und Unternehmen im Alten Hafen Wismars.
Informelles Treffen der NATO-Außenministerinnen und -Außenminister in Oslo: Vorbereitung des Gipfels in Vilnius
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

 Norwegen ist erst der zweite Gastgeber eines NATO-Treffens mit informellem Charakter. Die Ministerinnen und Minister treffen sich hier in einem sehr kleinen, vertraulichen Rahmen. Anstelle eines vorstrukturierten Ablaufs ist ein offenerer, direkterer und interaktiverer Austausch geplant. Das heißt ganz konkret: Die Ministerinnen und Minister sitzen alleine im Raum, ohne ihre Beraterinnen und Berater. Es werden keine vorbereiteten Statements verlesen, sondern miteinander diskutiert und gerungen, es geht um eine echte Debatte. Außenministerin Baerbock unterstrich dazu:
Norwegen ist erst der zweite Gastgeber eines NATO-Treffens mit informellem Charakter. Die Ministerinnen und Minister treffen sich hier in einem sehr kleinen, vertraulichen Rahmen. Anstelle eines vorstrukturierten Ablaufs ist ein offenerer, direkterer und interaktiverer Austausch geplant. Das heißt ganz konkret: Die Ministerinnen und Minister sitzen alleine im Raum, ohne ihre Beraterinnen und Berater. Es werden keine vorbereiteten Statements verlesen, sondern miteinander diskutiert und gerungen, es geht um eine echte Debatte. Außenministerin Baerbock unterstrich dazu:
Ich bin froh, dass Norwegen den Staffelstab für die noch junge, erst im vergangenen Jahr begründete Tradition eines informellen Treffens der NATO-Außenministerinnen und Außenminister von uns übernommen hat. Wie letztes Jahr in Berlin geht es auch in Oslo darum, sich kurz vor dem NATO-Gipfel der Staats- und Regierungschefs noch einmal ein Bild von der sicherheitspolitischen Gesamtgemengelage zu machen und gemeinsam auf die strategischen Kernfragen der Allianz zu schauen.
Schwerpunkte der Arbeitssitzung: Konsequenzen aus dem Angriffskrieg gegen die Ukraine
Den inhaltlichen Schwerpunkt der Diskussionen der NATO-Außenministerinnen und Außenminister wird die Vorbereitung des Gipfeltreffens in Vilnius Anfang Juli bilden. Zentrales Thema ist damit unter anderem die Weiterentwicklung der Partnerschaft der NATO mit der Ukraine. Zudem wird es darum gehen, wie die Ukraine weiter in ihrer Verteidigung und ihrem Kampf für den Frieden gegen den seit mehr als 450 Tagen andauernden russischen Angriff unterstützt werden kann.
Thema sind weiterhin die Konsequenzen, die die NATO aus dem aggressiven russischen Verhalten für ihre eigene Sicherheit ziehen muss. Die NATO ist der entscheidende Stützpfeiler für die euroatlantische Sicherheit. „Deswegen werden wir in Oslo auch darüber sprechen, wie wir konsequent die Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit der NATO stärken, nicht nur für heute und morgen, sondern für die nächsten Jahre, damit die Menschen überall in unserer Allianz in Sicherheit leben können“, so die Außenministerin vor dem Treffen. In diesem Zusammenhang sprechen die Ministerinnen und Minister über die Erneuerung des sogenannten „Defence Investment Pledge“ sowie darüber, wie die Resilienz der kritischen Infrastruktur in der Allianz gestärkt werden kann. Dazu zählt beispielsweise auch die kritische Unterwasserinfrastruktur.
Ratifizierung von Schwedens Mitgliedschaft steht in der Türkei und Ungarn weiterhin aus
Für Ratifizierung des schwedischen Beitritts bleibt vor dem Gipfeltreffen in Vilnius Anfang Juli nur noch wenig Zeit. Ungarn hat wiederholt erklärt, dass die Ratifizierung noch vor der Türkei erfolgen werde, sobald dort entsprechende Schritte eingeleitet worden sind. Nach der Konstituierung des türkischen Parlaments besteht jetzt die Gelegenheit, den Vorschlag zur Ratifizierung des schwedischen Beitritts zügig dem Parlament vorzulegen.
Hierzu sagte Außenministerin Baerbock vor Abreise:
Einen riesengroßen Schritt für die Stärkung des Bündnisses haben wir mit dem Beitritt Finnlands als 31. Mitglied getan. Der logische nächste Schritt muss nun mit dem Beitritt Schwedens kommen - so wie wir das alle gemeinsam beim letzten NATO-Gipfel in Madrid vereinbart haben. Das Ziel der Bundesregierung ist und bleibt Vilnius mit 32 Bündnispartnern am Tisch.
European Sleeper – Nachtzug von Berlin nach Amsterdam: So lief die Jungfernfahrt
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Ein Eisenbahn-Start-up bietet einen Nachtzug aus der deutschen in die niederländische Hauptstadt an. Verbindung und Unternehmen sind neu, Lok und Waggons alt. Lohnt sich die Reise? So lief die Jungfernfahrt...
Kampf gegen Hunger am Horn von Afrika
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Hauptgrund für den Hunger ist die Dürre: Die letzte Regenzeit liegt in vielen Regionen am Horn von Afrika nun bereits fünf Jahre zurück. Viele Millionen Menschen betreiben dort Subsistenzwirtschaft. Sie arbeiten in der Landwirtschaft oder halten Vieh. Die Menschen sind auf das angewiesen, was ihnen ihre Felder und Tiere einbringen. Die einst jährlich wiederkehrenden Regenzeiten waren ihre Lebensversicherung: Die Regenzeiten ließen Gemüse und Getreide wachsen, sorgten für genügend Trinkwasser und Viehfutter. Mit dem ausbleibenden Niederschlag verlieren jedes Jahr mehr Menschen ihre Lebensgrundlage: Böden trocknen aus, Pflanzen verdorren, rund 11 Millionen Kühe, Ziegen und Schafe sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen bereits verendet.
Spirale aus Klimakrise und Konflikten verstärkt sich
Doch die Dürre ist nicht der einzige Grund für diesen humanitären Notstand. Auch bewaffnete Konflikte führen immer wieder zu Not, Flucht und Vertreibung. Hinzu kommen die gravierenden, globalen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf Lieferketten sowie Weizen- und Düngemittelpreise, die die Versorgung auf den lokalen Märkten für viele Menschen unerschwinglich machen. Die Folge: Sie sind gezwungen, Mahlzeiten auszulassen, und rutschen weiter in die Mangelernährung.
Konkrete Hilfe für Menschen in Not
Für die Überlebenssicherung der Menschen am Horn von Afrika wird Deutschland in den kommenden zwei Jahren 210 Millionen Euro bereitstellen, um gemeinsam mit Hilfsorganisationen die Lebensgrundlagen zu sichern.
Zum Beispiel: Das Landwirtschaftsprogramm der Vereinten Nationen (FAO). Mit seiner Arbeit in Äthiopien, Somalia und Kenia setzt es sprichwörtlich an der Wurzel an, denn mit den klimatischen Bedingungen verändert sich auch die Art und Weise, wie Lebensmittel angebaut werden müssen. Mit Unterstützung des Auswärtigen Amts begleitet die FAO 115 000 besonders vulnerable Familien, beispielsweise mit dürreresistentem Saatgut und bei der Versorgung ihrer Tiere. Ziel ist es, die Menschen dabei zu unterstützen, sich künftig wieder selbst versorgen zu können.
Zum Beispiel Help Age: Die Organisation unterstützt gemeinsam mit lokalen Hilfsorganisationen Flüchtlinge und Binnenvertriebene in Äthiopien. Mehr als 42.500 Menschen erhalten bis Ende 2024 konkrete Unterstützung, zum Beispiel durch therapeutische Nahrung zur Behandlung von schwerer Unterernährung, durch Saatgut und landwirtschaftliche Geräte. Oder auch in Form von Sanitäts- und Hygienepaketen für Mädchen und Frauen. Ältere Menschen mit Sehbehinderung erhalten Mobilitätstrainings, um ihren Alltag besser bewältigen zu können. Das Auswärtige Amt finanziert mit 2,75 Millionen Euro.
Zum Beispiel die Nichtregierungsorganisation IRC, die unterernährte Kinder in Oromia/Äthiopien im Rahmen eines besonderen Regionalprogramms behandelt, das besonders auf die Bedürfnisse von Binnenvertriebenen, Geflüchteten, Rückkehrenden, Aufnahmegemeinden und besonders gefährdeten Gruppen ausgerichtet ist. Neben der Deckung von Grundbedürfnissen legt die Organisation auch besonderes Augenmerk auf die Prävention und Behandlung von Komplikationen bei Schwangerschaft und Geburt von Frauen und heranwachsenden Mädchen. Denn häufig geht der Hunger Hand in Hand mit weiteren Problemen, die sich gegenseitig beeinflussen und verstärken.
Das Auswärtige Amt leistet Hilfe nach den Humanitären Prinzipien. Außerdem wird besonders darauf geachtet, dass die am stärksten Betroffenen von Hilfe profitieren und diese Hilfe den unterschiedlichen Bedürfnissen, insbesondere denen von Frauen und Kindern, entspricht.
Deutschland wird in den kommenden zwei Jahren 210 Millionen Euro bereitstellen, um die Not der Menschen am Horn von Afrika zu lindern. Insgesamt stehen dem Auswärtigen Amt für humanitäre Hilfe im Jahr 2023 2,7 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Bundesregierung setzt sich angesichts wachsender Bedarfe weltweit dafür ein, dass humanitäre Hilfe immer effizienter geleistet wird – und dass sich auch andere Staaten entsprechend ihrer Möglichkeiten stärker humanitär engagieren.
UN-Konferenz im Auswärtigen Amt bringt Fraueninitiativen aus aller Welt zusammen
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Die vom 23.–25. Mai gemeinsam vom Auswärtigen Amt und der UN-Organisation Women’s Peace & Humanitarian Fund (WPHF) ausgerichtete internationale Konferenz Global Women’s Forum for Peace & Humanitarian Action stellt die Bedeutung von Frauen für Konfliktlösungen und Prävention in den Mittelpunkt und bringt Vertreterinnen von knapp 90 Nicht-Regierungs-Organisationen aus 29 Ländern aller Kontinente mit Vertreterinnen und Vertretern aus Zivilgesellschaft, Politik und Think Tanks zusammen.
Frauen gestalten ihr Leben selbstbestimmt
 Fragen von Gleichstellung, Teilhabe und Schutz von Frauen sind integrale Bestandteile einer Außen- und Sicherheitspolitik, die das Leben aller Menschen in Krisen- und Konfliktregionen in den Blick nimmt. Somit ist das internationale Treffen von Fraueninitiativen aus Ländern wie Äthiopien, Irak, Nigeria und Kolumbien auch ein Beispiel für gelebte feministische Außenpolitik. Die Teilnehmerinnen sind Frauen, die sich dafür einsetzen, dass in ihrem direkten Umfeld Flüchtlinge wieder eine Perspektive, dass Opfer von sexualisierter Gewalt Zuwendung und juristische sowie medizinische Versorgung erhalten und dass marginalisierte Gruppen Zugang zu humanitärer Hilfe bekommen. Sie sind an formellen oder informellen Friedensverhandlungen und bei der Prävention von Gewaltkonflikten beteiligt. Nach dem Ende von Kampfhandlungen fördern sie die Versöhnung, den Frieden und den wirtschaftlichen Wiederaufbau eines Dorfes oder einer Region.
Fragen von Gleichstellung, Teilhabe und Schutz von Frauen sind integrale Bestandteile einer Außen- und Sicherheitspolitik, die das Leben aller Menschen in Krisen- und Konfliktregionen in den Blick nimmt. Somit ist das internationale Treffen von Fraueninitiativen aus Ländern wie Äthiopien, Irak, Nigeria und Kolumbien auch ein Beispiel für gelebte feministische Außenpolitik. Die Teilnehmerinnen sind Frauen, die sich dafür einsetzen, dass in ihrem direkten Umfeld Flüchtlinge wieder eine Perspektive, dass Opfer von sexualisierter Gewalt Zuwendung und juristische sowie medizinische Versorgung erhalten und dass marginalisierte Gruppen Zugang zu humanitärer Hilfe bekommen. Sie sind an formellen oder informellen Friedensverhandlungen und bei der Prävention von Gewaltkonflikten beteiligt. Nach dem Ende von Kampfhandlungen fördern sie die Versöhnung, den Frieden und den wirtschaftlichen Wiederaufbau eines Dorfes oder einer Region.
WPHF – Women’s Peace and Humanitarian Fund
Der WPHF ist ein internationaler Fonds, der seit 2016 Frauen dabei unterstützt, eine stärkere Rolle in Krisenprävention, Friedensförderung, humanitärer Hilfe und in der Nothilfe wahrzunehmen. Im WPHF kommen dafür verschiedene UN-Organisationen, einzelne besonders engagierte Staaten wie Deutschland und Nicht-Regierungsorganisationen zusammen. Lokale Initiativen können sich für die Finanzierung ihrer Projekte direkt beim WPHF bewerben. Neben längerfristig angelegten Projekten wird Frauen ganz konkret ermöglicht, an Friedensprozessen oder der Umsetzung von Friedensabkommen mitzuwirken: Es geht zum Beispiel um Coachings vor der Teilnahme an Verhandlungen, die Erstattung von Reisekosten oder die Organisation von Kinderbetreuung an Verhandlungsorten, aber vor allem die aktive Ermutigung von Frauen, Verantwortung zu übernehmen, ihre Stimme zu erheben und ihre Perspektive einzubringen. Inzwischen hat der WPHF mehr als 800 zivilgesellschaftliche Organisationen in insgesamt 32 Ländern unterstützt. Seit seinem Bestehen haben das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung knapp 52 Millionen EUR zu dem Fonds beigetragen. Deutschland ist damit der größte finanzielle Einzelgeber.
Ukraine, Horn von Afrika, Iran & QMV – Außenministerin Baerbock beim Mai EU-Außenrat
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Erstes Thema des vollgepackten Tages: Wie kann die EU international handlungsfähiger werden? Ein Hindernis dafür ist manchmal, dass alle Entscheidungen in der Außen- und Sicherheitspolitik mit Einstimmigkeit unter allen 27 Mitgliedsstaaten getroffen werden müssen. Deutschland will das ändern. Außenministerin Baerbock hat deshalb zu einem Arbeitsfrühstück der gemeinsam mit neun anderen EU-Mitgliedsstaaten ins Leben gerufenen Freundesgruppe zum stärkeren Einsatz von qualifizierten Mehrheitsentscheidungen – kurz: QMV – in der gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik (weitere Informationen zur Gruppe hier) eingeladen. Die Gruppenmitglieder werden dazu gemeinsam mit allen interessierten EU-Mitgliedsstaaten Ideen austauschen und Vorschläge erörtern, wie auf Basis der bestehenden EU-Verträge Verbesserungen in den Entscheidungsprozessen erreicht werden können.
Weitere Unterstützung für die Ukraine
Im Anschluss werden die Außenministerinnen und Außenminister darüber beraten, wie die Ukraine im Angesicht des russischen Angriffskriegs weiter unterstützt werden kann. Dabei wird es insbesondere um die weitere finanzielle Unterstützung der Ukraine durch die sogenannte Europäische Friedensfazilität gehen. Auch die völkerstrafrechtliche Verfolgung des Aggressionsverbrechens der russischen Führung wird ein Thema sein: die Außenministerinnen und Außenminister werden sich dazu weiter über die Errichtung eines internationalisierten Gerichts austauschen. Parallel bereitet die EU das nächste, bereits elfte, Sanktionspaket gegen Russland vor, welches zeitnah beschlossen werden soll. Damit erhöht die EU weiter den Druck auf Russland und die russische Führung, den illegalen Angriff gegen die Ukraine beenden.
Horn von Afrika
Die Lage am Horn von Afrika beschäftigt die Außenministerinnen und Außenminister weiter. Ein Schwerpunkt der Beratungen bleibt auch gut einen Monat nach Ausbruch der Kämpfe Sudan. Priorität haben ein belastbares und langfristiges Waffenstillstandsabkommen, das den Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten sicherstellt sowie die Einrichtung eines humanitären Korridors, damit die Menschen umkämpfte Gebiete verlassen und mit dem notwendigsten an Lebensmitteln und medizinischen Gütern versorgt werden können. Neben Sudan wird es zudem um die zuletzt ermutigenden Entwicklungen im Friedensprozess in Äthiopien sowie die Lage in Somalia gehen.
8. Sanktionspaket gegen Iran
Die Menschen in Iran verfolgen entgegen allen Repressionsversuchen des iranischen Regimes ihren Traum von Freiheit und Selbstbestimmung mutig weiter. Die EU bleibt dabei fest an ihrer Seite. Die 27 Außenministerinnen und Außenminister werden ein achtes Sanktionspaket annehmen. Mit den neuen Listungen im Rahmen des bestehenden EU-Menschenrechts-Sanktionsregimes zielt die EU insbesondere auf Teile des Justiz- und Sicherheitsbereichs sowie zwei Umfeldorganisationen der iranischen Revolutionsgarden.
Austausch mit den Außenministerinnen und Außenministern der Westbalkan Staaten
Bereits am Mittag sind auf Einladung von Josep Borrell die Außenministerinnen und Außenminister der sechs Westbalkanländer zum informellen Arbeitsmittagessen zu Gast. Dabei wird es insbesondere um Fragen des EU-Beitrittsprozesses sowie die dringend notwendige Umsetzung von vereinbarten Normalisierungsschritten im Verhältnis von Kosovo und Serbien gehen.
Virtuelle Klassenfahrt
Außenministerin Baerbock hat darüber hinaus heute eine ungewöhnliche „Reisebegleitung“. Im Rahmen des EU-Projekttages 2023 der Bundesregierung wird die Außenministerin virtuell von der 9d der Schule am Schillerpark aus dem Berliner Wedding nach Brüssel begleitet.
Der „Rat für Auswärtige Angelegenheiten" (RfAB) ist zuständig für das außenpolitische Handeln der EU, was die Bereiche der Außen‑, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, den Handel, die Entwicklungszusammenarbeit und die humanitäre Hilfe umfasst. Er hat vor allem die Aufgabe, gemeinsam mit der Europäischen Kommission und unter Einbindung des Hohen Vertreters der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, ein einheitliches und koordiniertes außenpolitisches Handeln der EU sicherzustellen. Der RfAB tagt in der Regel einmal im Monat.
Berlin-Tipps für Foodies: Dies sind die tollsten neuen Restaurants in der Hauptstadt
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Ob chinesisch oder türkisch, israelisch oder italienisch – in Berlin kann Essengehen zur Weltreise werden. Ständig tauchen neue Restaurants auf. Die hier sind uns besonders aufgefallen...
Weichenstellung für die Zukunft: 4. Gipfel der Staats- und Regierungschefs des Europarates
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

 Auf Einladung des isländischen Vorsitzes haben sich vom 16. bis 17. Mai 2023 die Staats- und Regierungschefs der 46 Mitgliedstaaten des Europarates in Reykjavik zu einem Gipfel getroffen. Für Deutschland nahm Bundeskanzler Olaf Scholz teil; stellvertretende Leiterin der deutschen Delegation war die Staatsministerin für Europa und Klima Anna Lührmann. Neben den Mitgliedstaaten waren auch Repräsentanten der EU, der Vereinten Nationen und der OSZE sowie Vertreterinnen und Vertreter der fünf Beobachterstaaten – USA, Vatikan, Japan, Kanada und Mexiko eingeladen.
Auf Einladung des isländischen Vorsitzes haben sich vom 16. bis 17. Mai 2023 die Staats- und Regierungschefs der 46 Mitgliedstaaten des Europarates in Reykjavik zu einem Gipfel getroffen. Für Deutschland nahm Bundeskanzler Olaf Scholz teil; stellvertretende Leiterin der deutschen Delegation war die Staatsministerin für Europa und Klima Anna Lührmann. Neben den Mitgliedstaaten waren auch Repräsentanten der EU, der Vereinten Nationen und der OSZE sowie Vertreterinnen und Vertreter der fünf Beobachterstaaten – USA, Vatikan, Japan, Kanada und Mexiko eingeladen.
In den 74 Jahren des Bestehens der ältesten Staatenorganisation Europas war dies erst das vierte Treffen auf dieser Ebene. Der Europarat hat Gipfel dann einberufen, wenn Entscheidungen von großer Tragweite zu treffen waren. In Reykjavik stand angesichts des russischen Angriffskrieges und des daraufhin erfolgten Ausschlusses Russlands das erneuerte Bekenntnis zu den Grundwerten des Europarates – Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Fokus. Dies in dem Bewusstsein, dass der russische Überfall auf ein Nachbarland zugleich ein Angriff auf die europäische Friedens- und Werteordnung ist, die nach dem Zweiten Weltkrieg vom Europarat maßgeblich mit errichtet wurde.
Register für Schäden des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine
Vom Gipfel ging daher vor allem auch ein Signal der Solidarität und Unterstützung für die Ukraine aus. Mit der in Reykjavik beschlossenen Einrichtung eines Registers, das Schäden, Verluste und Verletzungen, die durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine entstanden sind, dokumentieren soll, leistet der Europarat einen wesentlichen Beitrag zu den internationalen Bemühungen gegen Straflosigkeit für die von Russland begangenen Verbrechen. Deutschland unterstützt die herausragend wichtige Arbeit des Europarats und des Schadensregisters über die Pflichtbeiträge hinaus mit zusätzlichen, freiwilligen Leistungen.
Die bisherigen Gipfel des Europarates fanden 1993 in Wien, 1997 in Straßburg und 2005 in Warschau statt.
Weitere Informationen zum 4. Gipfel des Europarates
Besuch am Golf: Außenministerin Baerbock reist nach Saudi-Arabien und Katar
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Angesichts der zahlreichen Herausforderungen in der Region beginnend mit der akuten Krise in Sudan, den schon lange andauernden Konflikten in Syrien und in Jemen bis hin zur Machtübernahme der Taliban in Afghanistan ist ein belastbarer Dialog mit den Partnern am Golf für Deutschland und Europa essentiell. Denn:
Die Golfregion ist geopolitischer Dreh- und Angelpunkt zwischen Asien, Afrika und Europa, mit Einfluss weit über die Arabische Halbinsel hinaus.
- Außenministerin Annalena Baerbock
Außenministerin Baerbock reist zunächst nach Djidda, wo sich die saudi-arabische Regierung den Sommer über aufhält. Dort wird sie bilaterale Themen sowie Fragen der regionalen Krisendiplomatie mit ihrem Amtskollegen Prinz Faisal bin Farhan Al Saud besprechen. Saudi-Arabiens regionales Engagement hat sich zuletzt in Sudan gezeigt: Das Königreich vermittelt zwischen den Konfliktparteien, mit dem Ziel eines raschen Waffenstillstandes, und hat eine entscheidende Rolle bei der Evakuierung tausender Menschen aus Sudan gespielt.
Außenministerin Baerbock wird daher auch den Hafen von Djidda besuchen, an dem ein Großteil der Evakuierten angekommen ist, und sich dort mit Hafenmitarbeiterinnen über deren Erfahrungen austauschen. Anschließend trifft die Außenministerin Kunstschaffende in einem Kulturzentrum. Die Stimmen der Zivilgesellschaft in Saudi-Arabien zu hören ist wichtig, denn sie liefern entscheidende Treibkraft für gesellschaftlichen Wandel vor Ort. Die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien ist weiterhin sehr schwierig.
Die ersten Schritte gesellschaftlicher Öffnung haben viele junge Menschen in Saudi-Arabien ermutigt. Für mich ist es daher selbstverständlich, dass eine Gesellschaft, die Vorbild für eine ganze Region sein will, auch auf die Stimmen seiner Frauen hört - online wie offline.
 Am zweiten Tag ihrer Reise trifft Außenministerin Baerbock ihren jemenitischen Amtskollegen Mubarak sowie den UN-Koordinator für humanitäre Hilfe in Jemen, David Gressly, in Djidda. Der inzwischen mehr als neun Jahre andauernde Konflikt in Jemen hat die Infrastruktur des Landes zum großen Teil zerstört, über zwei Drittel der Bevölkerung - und damit über 23 Millionen Menschen - sind auf humanitäre Hilfe und Schutz angewiesen.
Am zweiten Tag ihrer Reise trifft Außenministerin Baerbock ihren jemenitischen Amtskollegen Mubarak sowie den UN-Koordinator für humanitäre Hilfe in Jemen, David Gressly, in Djidda. Der inzwischen mehr als neun Jahre andauernde Konflikt in Jemen hat die Infrastruktur des Landes zum großen Teil zerstört, über zwei Drittel der Bevölkerung - und damit über 23 Millionen Menschen - sind auf humanitäre Hilfe und Schutz angewiesen.
Deutschland engagiert sich als einer der größten humanitären Geber für die Jemenitinnen und Jemeniten. Für eine nachhaltige Verbesserung der Lage der Bevölkerung wird aber dringend eine dauerhafte Beilegung des Konflikts benötigt.
Dass Saudi-Arabien in Jemen nun auf Gespräche mit den Huthis setzt, ist der richtige erste Schritt. Nur eine politische Lösung kann das unfassbare Leid der Menschen in Jemen beenden.
 Anschließend trifft Außenministerin Baerbock in Doha ihren katarischen Amtskollegen Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Hierbei wird es ebenfalls um regionale Fragen wie auch die bilateralen Beziehungen Deutschlands mit Katar gehen. Als weiteres Thema wird die von arabischen Staaten angestrebte Normalisierung der Beziehungen zu Syrien auf der Agenda stehen, die aus Sicht Deutschlands wegen der anhaltenden Repression des Assad-Regimes an klare Bedingungen geküpft sein muss.
Anschließend trifft Außenministerin Baerbock in Doha ihren katarischen Amtskollegen Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Hierbei wird es ebenfalls um regionale Fragen wie auch die bilateralen Beziehungen Deutschlands mit Katar gehen. Als weiteres Thema wird die von arabischen Staaten angestrebte Normalisierung der Beziehungen zu Syrien auf der Agenda stehen, die aus Sicht Deutschlands wegen der anhaltenden Repression des Assad-Regimes an klare Bedingungen geküpft sein muss.
Außerdem wird Außenministerin Baerbock am letzten Tag ihrer Reise mit Vertreterinnen und Vertretern der International Labor Organisation Gespräche zum Thema Arbeitnehmerrechte führen. Dieses Thema war vor allem im Lichte der Fußballweltmeisterschaft in Katar in den Fokus gerückt.
Humanitäre Hilfe für die Menschen in Syrien: dringend benötigt, nicht einfach zu liefern
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Seit mehr als einem Jahrzehnt leiden die Menschen in Syrien unter dem Konflikt. Die Bilanz ist verheerend: Über 300.000 Menschen sind gestorben, mehr als die Hälfte der syrischen Bevölkerung musste ihre Heimat verlassen. Die Erdbeben vom Februar haben die Not vieler Syrerinnen und Syrer noch vergrößert, über 6.000 Menschen haben aufgrund der Beben ihr Leben verloren. Laut den Vereinten Nationen benötigen über 15 Millionen Menschen im Land humanitäre Hilfe. Das ist mehr als die Bevölkerung der 15 größten Städte in Deutschland. Die Bundesregierung unterstützt die Menschen in Syrien und in den von der Krise betroffenen Nachbarländern seit Jahren. Nach dem Erdbeben hat die Bundesregierung zusätzliche Hilfe in Höhe von 238 Millionen Euro für die betroffenen Menschen in der Türkei und in Syrien zugesagt.
Es bleibt jedoch eine Herausforderung, humanitäre Hilfe an alle bedürftigen Menschen in Syrien zu liefern. Warum?
Humanitäre Hilfe mit Herausforderungen
 Der seit 2011 herrschende Konflikt hat das Land in Gebiete unterteilt, die von verschiedenen Gruppen kontrolliert werden, darunter das Assad-Regime, oppositionelle Gruppen, Rebellen und kurdische Kräfte. Fast sieben Millionen Menschen im ganzen Land gelten als Binnenvertriebene. Der Transport von Hilfsgütern über die Konfliktlinien innerhalb Syriens hinweg ist nur in wenigen Fällen möglich. Deutschland setzt sich dafür ein, dass alle Möglichkeiten genutzt werden, um hilfsbedürftige Menschen zu erreichen, unabhängig davon in welchem Gebiet sie sich aufhalten. Dazu gehört auch die dauerhafte Öffnung wichtiger Grenzübergänge. Besonders wichtig ist die Hilfe aus der Türkei nach Nordsyrien. Diese grenzüberschreitende Versorgung ist essenziell für die vier Millionen Menschen im Nordwesten des Landes. Allein das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) erreicht dort monatlich bis zu 1,4 Millionen. Menschen. Deutschland war im vergangenen Jahr der größte Geber für das WFP in Syrien.
Der seit 2011 herrschende Konflikt hat das Land in Gebiete unterteilt, die von verschiedenen Gruppen kontrolliert werden, darunter das Assad-Regime, oppositionelle Gruppen, Rebellen und kurdische Kräfte. Fast sieben Millionen Menschen im ganzen Land gelten als Binnenvertriebene. Der Transport von Hilfsgütern über die Konfliktlinien innerhalb Syriens hinweg ist nur in wenigen Fällen möglich. Deutschland setzt sich dafür ein, dass alle Möglichkeiten genutzt werden, um hilfsbedürftige Menschen zu erreichen, unabhängig davon in welchem Gebiet sie sich aufhalten. Dazu gehört auch die dauerhafte Öffnung wichtiger Grenzübergänge. Besonders wichtig ist die Hilfe aus der Türkei nach Nordsyrien. Diese grenzüberschreitende Versorgung ist essenziell für die vier Millionen Menschen im Nordwesten des Landes. Allein das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) erreicht dort monatlich bis zu 1,4 Millionen. Menschen. Deutschland war im vergangenen Jahr der größte Geber für das WFP in Syrien.
Humanitäres Koordinierungstreffen in Berlin
 Diese Woche richtet das Auswärtige Amt gemeinsam mit der EU Kommission ein Koordinierungstreffen in Berlin aus. Im Mittelpunkt steht dabei zum Beispiel die Frage, wie die hilfsbedürftigen Menschen im gesamten Land – daher spricht man auch von einem „whole of Syria“-Ansatz noch besser humanitär versorgt werden können. Das Koordinierungstreffen dient auch der Vorbereitung der siebten Geberkonferenz zur Unterstützung der Zukunft Syriens und der Region, die am 14. und 15. Juni in Brüssel stattfinden wird. Dort wird der Schwerpunkt auch auf dem UN-gestützten, politischen Prozess und der Lage in den von der syrischen Flüchtlingskrise besonders betroffenen Nachbarstaaten Türkei, Libanon, Jordanien, Irak und Ägypten liegen.
Diese Woche richtet das Auswärtige Amt gemeinsam mit der EU Kommission ein Koordinierungstreffen in Berlin aus. Im Mittelpunkt steht dabei zum Beispiel die Frage, wie die hilfsbedürftigen Menschen im gesamten Land – daher spricht man auch von einem „whole of Syria“-Ansatz noch besser humanitär versorgt werden können. Das Koordinierungstreffen dient auch der Vorbereitung der siebten Geberkonferenz zur Unterstützung der Zukunft Syriens und der Region, die am 14. und 15. Juni in Brüssel stattfinden wird. Dort wird der Schwerpunkt auch auf dem UN-gestützten, politischen Prozess und der Lage in den von der syrischen Flüchtlingskrise besonders betroffenen Nachbarstaaten Türkei, Libanon, Jordanien, Irak und Ägypten liegen.
Lage im Nahostkonflikt: Außenministerin Baerbock lädt zu Kleeblatt-Treffen nach Berlin ein
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

1993 reichte Israels Ministerpräsident Rabin dem PLO-Vorsitzenden Arafat vor dem Weißen Haus in Washington die Hand. Das Foto ging um die Welt, Frieden schien möglich. 30 Jahre später ist der Nahostkonflikt noch immer nicht gelöst, sondern fordert weiter zahlreiche Menschenleben. Was kann Deutschland gemeinsam mit Partnern in Europa und der Region unternehmen, um die Lage zu deeskalieren? Außenministerin Annalena Baerbock lädt die französische Außenministerin Colonna, ihren jordanischen Kollegen Safadi und den ägyptischen Außenminister Shukry heute nach Berlin ein, um genau dieser Frage nachzugehen.
Auch, wenn der Konflikt bislang auf diplomatischem Weg nicht gelöst werden konnte, ist Wegschauen und die Hände in den Schoß legen keine Alternative. Es ist Aufgabe der Diplomatie, selbst in aussichtslosen Konfliktsituationen Perspektiven zu schaffen. Aus Sicht der Bundesregierung geht kein Weg an einer politischen, verhandelten Zweistaatenlösung für den Konflikt vorbei. Eine Einigung, auf deren Grundlage Israelis wie Palästinenserinnen und Palästinenser in Frieden und in Sicherheit leben können. Dass dieser Konflikt bereits Jahrzehnte andauert, führt uns umso mehr vor Augen, wie dringlich international koordiniertes, diplomatisches Engagement in diesem Fall ist.
Das Kleeblatt-Format: eine europäisch-arabische Schnittstelle
Das Kleeblatt Format - auch Münchner Gruppe genannt - besteht aus vier Teilnehmenden: Deutschland, Frankreich, Ägypten und Jordanien. Aktuell ist es die einzige Gruppe, in dem europäische und arabische Partner zusammenarbeiten, die sich mit dem Nahostkonflikt beschäftigt. Das Nahost-Quartett, bestehend aus den Vereinten Nationen, der EU, den USA und Russland, ist seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine dauerhaft blockiert. Für Deutschland und Frankreich sind die aktuellen Lageeinschätzungen von Jordanien und Ägypten besonders wertvoll. Diese beiden Länder sind als unmittelbare Nachbarn direkt von den Auswirkungen des Nahostkonflikts betroffen.
Die Mitglieder der Münchner Gruppe sind sich einig: Gemeinsam wollen sie dazu beitragen, dass es dauerhaften Frieden und Stabilität in der Region geben kann. Gemeinsam verfügen sie über starke Beziehungen zu den Konfliktparteien, in die Region und darüber hinaus. Gemeinsam als europäisch-arabische Schnittstelle stehen sie bereit, um Israelis und Palästinenserinnen und Palästinenser dabei zu unterstützen, die Logik der Gewalt in dem Konflikt zu durchbrechen.
Insbesondere im Vor- und Umfeld der jüdischen/muslimischen Feiertage im April ist es dank internationaler Kooperation gelungen, größere Eskalation zwischen Israelis und Palästinenserinnen und Palästinensern zu verhindern. Dabei leistete der unter US-Ägide lancierte Aqaba-Prozess einen wichtigen Beitrag, bei dem auch Jordanien und Ägypten eine wichtige Rolle spielten. Die Perspektive des Aqaba-Prozesses ist sicherheitszentriert, der Prozess dient dem Krisenmanagement. Das Kleeblatt-Format verfolgt eine langfristigere Perspektive mit dem Ziel, einen Pfad zur politischen Lösung des Konfliktes offen zu halten.
Was ist mit der Zweistaatenlösung?
Eine Zweistaatenregelung im Nahostkonflikt ist weiter möglich. Die Hürden, eine Zweistaatenlösung umzusetzen, sind jedoch sehr hoch, da solch eine Umsetzung für beide Konfliktparteien mit hohen politischen Kosten verbunden wäre. Die schwierigen Voraussetzungen sind den Mitgliedern des Kleeblatt-Formats bewusst. Aus Sicht der Bundesregierung ist und bleibt die Zwei-Staaten-Lösung jedoch die beste Grundlage, auf der Israelis wie Palästinenserinnen und Palästinenser in Frieden und in Sicherheit leben können. Und auch wenn eine solche Lösung nicht unmittelbar vor der Tür steht: Die Mitglieder des Münchner Formats setzen sich genau dafür ein, dass diese Tür zumindest offengehalten wird.
Afrika-Reise im Tuk Tuk: Vier Freunde und die Schlucht der Tausendfüßler
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Von Kenia über Malawi bis Südafrika – seit mehr als einem Jahr fahren vier Freunde mit Tuk-Tuks quer durch Afrika. Ein Gespräch über nächtliche Elefantenbesuche und Todesangst in der Schlucht der Tausendfüßler...
Vivre l'amitié franco-allemande – Außenministerin Baerbock zu Besuch in Paris
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Am Dienstag und Mittwoch wird Außenministerin Baerbock für zwei Tage in die französische Hauptstadt reisen. Dabei auf dem Programm: Intensiver Austausch mit ihrer Amtskollegin Catherine Colonna sowie die Teilnahme an der französischen Kabinettssitzung. Zudem wird die Außenministerin auch Präsident Macron zu einem Gespräch treffen.
Erst im Januar war das Bundeskabinett für einen gemeinsamen Ministerrat zu Gast in Paris. Außenministerin Baerbock knüpft mit ihrer Reise hieran an. Denn in Paris und Berlin haben die gemeinsamen Teilnahmen Tradition: Deutschland und Frankreich haben 2019 im Aachener Vertrag festgelegt, dass regelmäßig Ministerinnen und Minister an den Kabinettssitzungen des anderen Landes teilnehmen. Denn die jahrzehntelange Freundschaft und das gegenseitige Vertrauen zwischen unseren Ländern sind die Grundlage für ein zukunftsfestes Europa.
Für eine starke Europäische Union
 Die Europäische Union hat sich gerade im letzten Jahr stärker und geeinter gezeigt, als es viele ihr zugetraut hätten. Aber auch die oft langsamen Entscheidungsprozesse in Brüssel wurden sichtbar. Daher wird es in den Gesprächen von Außenministerin Baerbock auch darum gehen, die EU handlungsfähiger und fit für künftige Erweiterungen zu machen. Dafür sind schnellere und effektivere Entscheidungen in Brüssel von Nöten, gerade auch in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Gemeinsam mit Frankreich und sieben weiteren EU-Mitgliedsstaaten hat Deutschland eine Freundesgruppe gegründet, die sich für qualifizierte Mehrheitsentscheidungen im Rat einsetzt.
Die Europäische Union hat sich gerade im letzten Jahr stärker und geeinter gezeigt, als es viele ihr zugetraut hätten. Aber auch die oft langsamen Entscheidungsprozesse in Brüssel wurden sichtbar. Daher wird es in den Gesprächen von Außenministerin Baerbock auch darum gehen, die EU handlungsfähiger und fit für künftige Erweiterungen zu machen. Dafür sind schnellere und effektivere Entscheidungen in Brüssel von Nöten, gerade auch in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Gemeinsam mit Frankreich und sieben weiteren EU-Mitgliedsstaaten hat Deutschland eine Freundesgruppe gegründet, die sich für qualifizierte Mehrheitsentscheidungen im Rat einsetzt.
In der Sitzung des französischen Kabinetts, an der die Außenministerin morgen teilnimmt, wird es auch um die Unterstützung für die Menschen in der Ukraine in ihrem Freiheitskampf für einen gerechten Frieden gehen. Auch der europäische Umgang mit China und eine enge deutsch-französische Abstimmung für die Resilienz, Stärke und Wettbewerbsfähigkeit der EU stehen auf der Tagesordnung.
Wahre Freunde zeigen sich in der Not: gemeinsame Evakuierung aus Sudan
Die vertraute Zusammenarbeit und Koordinierung Deutschlands und Frankreichs zeigte sich zuletzt eindrucksvoll während der Evakuierung aus Sudan. Deutschland und Frankreich haben während der gefährlichen Operationen Hand in Hand gearbeitet und eng koordiniert deutsche, französische und andere Staatsangehörige ausgeflogen, damit sie sicher nach Hause zurückkehren konnten - ganz egal ob nach Berlin oder Brest. Für das Vertrauen und diese Teamleistung wird sich Außenministerin Baerbock bei ihren französischen Kolleginnen und Kollegen bedanken.
Und am Ende der zweitägigen Paris-Reise? Da geht’s für Außenministerin Baerbock und ihre französische Amtskollegin Colonna diese Woche noch weiter zum Kleeblatt-Treffen nach Berlin und zum Gymnich-Treffen nach Stockholm. Bei vier von fünf gemeinsamen Arbeitstagen kann man wohl sagen: C’est de l’amitié franco-allemande vécue!
Portmeirion in Wales: Warum steht ein italienisches Dorf an der rauen Küste Großbritanniens?
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Das Feriendorf Portmeirion in Wales war berühmte Filmkulisse und Rückzugsort des Jetsets. Vor allem aber ist es der Lebenstraum eines Romantikers. Das muss man nicht mögen. Warum ein Besuch trotzdem lohnt...
Miniatur Wunderland Hamburg eröffnet Patagonien: Wenn der ganz kleine Gletscher kalbt
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Eine der beliebtesten deutschen Touristenattraktionen wächst weiter. Das Miniatur Wunderland in Hamburg eröffnet Patagonien. Die Macher erfüllten sich damit einen Traum – und senden eine Botschaft...
Die Globale Partnerschaft gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

 Die Globale Partnerschaft (GP) gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und -materialien ist eine von den G7 geführte internationale Initiative, die darauf abzielt, die Verbreitung von chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen (CBRN) Waffen und Materialien zu verhindern. Sie wurde 2002 auf dem Gipfeltreffen in Kananaskis (Kanada) gegründet und ist die größte Arbeitsgruppe der G7. Ihr gehören 31 Mitglieder an: Australien, Belgien, Chile, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Japan, Jordanien, Georgien, Kanada, Kasachstan, Mexiko, Neuseeland, die Niederlande, Norwegen, Philippinen, Polen, Portugal, die Republik Korea, Schweden, die Schweiz, Spanien, Südkorea, Tschechien, Ungarn und die, Ukraine, USA und die Europäische Union. Sie stimmen sich ab und arbeiten kontinuierlich zusammen, um Projekte und Programme zu entwickeln und zu implementieren, die die von Massenvernichtungswaffen und -materialien ausgehenden Bedrohungen eindämmen sollen.
Die Globale Partnerschaft (GP) gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und -materialien ist eine von den G7 geführte internationale Initiative, die darauf abzielt, die Verbreitung von chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen (CBRN) Waffen und Materialien zu verhindern. Sie wurde 2002 auf dem Gipfeltreffen in Kananaskis (Kanada) gegründet und ist die größte Arbeitsgruppe der G7. Ihr gehören 31 Mitglieder an: Australien, Belgien, Chile, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Japan, Jordanien, Georgien, Kanada, Kasachstan, Mexiko, Neuseeland, die Niederlande, Norwegen, Philippinen, Polen, Portugal, die Republik Korea, Schweden, die Schweiz, Spanien, Südkorea, Tschechien, Ungarn und die, Ukraine, USA und die Europäische Union. Sie stimmen sich ab und arbeiten kontinuierlich zusammen, um Projekte und Programme zu entwickeln und zu implementieren, die die von Massenvernichtungswaffen und -materialien ausgehenden Bedrohungen eindämmen sollen.
Unter Leitung des jeweiligen G7-Vorsitzlandes – 2023 Japan – treffen sich die Mitglieder und Unterstützer der Globalen Partnerschaft zweimal im Jahr als Global Partnership Working Group, um Fortschritte zu überprüfen, die Bedrohungslage zu bewerten und zu erörtern, wo und wie sich die Mitglieder der Globalen Partnerschaft sinnvoll engagieren können, um zu verhindern, dass Terroristen und Staaten Massenvernichtungswaffen und -materialien erwerben und einsetzen können.
Die Global Partnership Working Group (GPWG) umfasst vier Arbeitsgruppen, die den regelmäßigen Dialog zwischen Experten über die Prioritäten der GP erleichtern:
- Arbeitsgruppe für biologische Sicherheit
- Arbeitsgruppe für chemische Sicherheit
- CBRN-Arbeitsgruppe
- Arbeitsgruppe für nukleare und radiologische Sicherheit
 Das letzte Treffen der GPWG und ihrer Arbeitsgruppen fand vom 9. bis 10. März 2023 in Tokyo statt.
Das letzte Treffen der GPWG und ihrer Arbeitsgruppen fand vom 9. bis 10. März 2023 in Tokyo statt.
Deutschland hat den Ko-Vorsitz der Arbeitsgruppe für biologische Sicherheit (BSWG) inne. Die BSWG koordiniert u. a. die 2021 ins Leben gerufene Initiative zur Minderung von vorsätzlichen Bedrohungen für biologische Sicherheit in Afrika („Africa Signature Initiative“).
Deutschland legte den Schwerpunkt seines Vorsitzes der Globalen Partnerschaft gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und -materialien 2022 auf biologische Sicherheit. Nicht zuletzt hatte die COVID-19-Pandemie gezeigt, wie verheerend die Auswirkungen der Verbreitung eines hochpathogenen Erregers sein können.
Am 07.10.2022 richtete das Auswärtige Amt eine Konferenz zu aktuellen Herausforderungen für Biosicherheit aus, auf der Experten biologische Bedrohungen wie Hochrisikoforschung, Cyber-Biosicherheit, den potenziellen Einsatz von gefährlichen Krankheitserregern als Waffe und Desinformation sowie geeignete Maßnahmen zur Reduzierung dieser Bedrohungen erörterten. Die Globale Partnerschaft verabschiedete eine Erklärung zur biologischen Sicherheit (die Berliner Handlungslinien).
Aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der damit einhergehenden russischen Desinformationskampagne leisteten die GP-Mitglieder erhebliche Unterstützung für die Ukraine unter Koordinierung des deutschen Vorsitzes. Hierzu zählten zum Beispiel Lieferungen von Schutzausrüstung und Detektionsgeräten für chemische Stoffe.
14. Petersberger Klimadialog: Wichtige Wegmarke für Klimaverhandlungen bis zur COP28
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Zentrales Ziel des Petersberger Klimadialogs ist es, das Vertrauen sowohl in multilaterale Klimaverhandlungen als auch zwischen den Staaten zu stärken. Damit sollen die Verhandlungen auf dem Weg zur COP28 erleichtert werden. Denn auch wenn viele Staaten das Ziel der globalen Minderung von Emissionen und des Ausbaus von Erneuerbaren Energien vereint, sind das keine einfachen Verhandlungen. Neben den größten CO2-Emittenten wie den USA, China und Indien sitzen auch stark betroffene Inselstaaten wie die Marshallinseln mit am Tisch.
Auf der Agenda des 14. Petersberger Klimadialogs steht neben der Emissionsminderung und Anpassung auch eine langstehende Forderung vieler von der Klimakrise besonders betroffener Staaten: die finanzielle Unterstützung bei der Anpassung an die Klimakrise und Bewältigung von Schäden und Verlusten infolge des Klimawandels. Auf der COP27 wurde ein wichtiger Grundsatzbeschluss getroffen, der nun umgesetzt werden muss.
Zur Eröffnung des 14. Petersberger Klimadialogs sagte Außenminister Baerbock:
Der Petersberger Klimadialog ist und bleibt der Ort, wo wir Allianzen bilden können unter Nationen, die vorangehen wollen: Industrienationen, Inselstaaten, Schwellenländer und die Zivilgesellschaft kommen hier zusammen. Hier wollen wir die Grundlagen für gemeinsame Beschlüsse auf der Weltklimakonferenz legen und hier kommen wir mit konkreten Partnerschaften für den Klimaschutz auch über geopolitische Grenzen hinweg in den Dialog.
Petersberger Klimadialog im Zeichen globaler Krisen
Auch der 14. Petersberger Klimadialog steht im Zeichen multipler globaler Krisen. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energie- und Lebensmittelkrise, beraten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie die Energie- und Klimawende dennoch beschleunigen können. Dabei geht es auch darum, Abhängigkeiten von fossilen Energieträgern zu reduzieren und ärmere Länder bei der Umstellung auf nachhaltige Energiequellen zu unterstützen, um die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Dies verdeutlicht: die Klimakrise und Fragen der internationalen Sicherheit sind eng mit einander verknüpft.
In ihrer Rede beim 14. Petersberger Klimadialog betonte Außenministerin Baerbock daher auch:
Wir stehen mit der Klimakrise gemeinsam vor der größten Sicherheitsherausforderung unseres Jahrhunderts. Alle, die heute hier versammelt sind, können ihren Beitrag zur Eindämmung der Klimakrise leisten.
Denn, und das ist die gute Nachricht des jüngsten IPCC-Berichts: Wir haben die politischen Instrumente, wir haben die finanziellen Mittel auf der Welt und die technischen Lösungen, um diese Krise einzudämmen.
 Die Klimapolitik bildet einen Schwerpunkt der deutschen Außenpolitik. Seit Amtsantritt von Außenministerin Baerbock hat das Auswärtige Amt die Steuerung und Koordination der internationalen Klimapolitik – einschließlich der internationalen Klimaverhandlungen – übernommen.
Die Klimapolitik bildet einen Schwerpunkt der deutschen Außenpolitik. Seit Amtsantritt von Außenministerin Baerbock hat das Auswärtige Amt die Steuerung und Koordination der internationalen Klimapolitik – einschließlich der internationalen Klimaverhandlungen – übernommen.
Auf Einladung von Außenministerin Baerbock diskutieren vom 1. bis 3. Mai 2023 hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus über 40 Staaten in Arbeitssitzungen konkrete Schritte zur Bewältigung der Klimakrise im Auswärtigen Amt. Die Vereinigten Arabischen Emirate als Ausrichter der COP28 sind Mitgastgeber. Neben Bundeskanzler Scholz nehmen auch der designierte Präsident der COP28 Dr. Al-Jaber sowie der Generalsekretär der Vereinten Nationen Guterres (per Videobotschaft) teil.
Der Petersberger Klimadialog wurde 2010 von Bundeskanzlerin a.D. Merkel ins Leben gerufen und bringt jährlich ausgewählte Staaten zusammen, um die Weichen für erfolgreiche Verhandlungen bei den Weltklimakonferenzen COP zu stellen. Der erste Petersberger Klimadialog fand auf dem namensgebenden Petersberg in Bonn statt, seither erfolgt das Treffen in Berlin. Von 2011-2021 wurde der Petersberger Dialog durch das Umweltressort ausgerichtet. Mit Übernahme der Zuständigkeit für Klimaaußenpolitik findet die Konferenz seit 2022 im Auswärtigen Amt statt. Mitgastgeber ist jeweils das Land, das als nächstes den Vorsitz für die Weltklimakonferenz übernimmt. Die nächste Weltklimakonferenz COP28 findet vom 30. November bis 12. Dezember 2023 in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt.
Die Krise in Sudan
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

 Seit Sonntag laufen Evakuierungen. Eine Woche nach Ausbruch der Kämpfe, bot sich endlich eine wenn auch brüchige Waffenpause.
Seit Sonntag laufen Evakuierungen. Eine Woche nach Ausbruch der Kämpfe, bot sich endlich eine wenn auch brüchige Waffenpause.
Mit bisher fünf Maschinen der Bundeswehr konnten bereits über 500 Menschen in Sicherheit gebracht werden- darunter auch zahlreiche Staatsangehörige anderer Staaten, wie beispielsweise Frankreich, den Niederlanden, Portugal, Dänemark, Bulgarien oder Großbritannien.
Oberste Priorität ist es, deutsche Staatsangehörige sowie EU-Bürgerinnen und -Bürger in Sicherheit zu bringen
Direkt nach Ausbruch der ersten Kampfhandlungen trat am 15. April das erste Mal der Krisenstab der Bundesregierung im Auswärtigen Amt zusammen. Seitdem tagte er täglich, mehrfach auch unter Leitung der Minister Baerbock und Pistorius.
Ein Team aus Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, Krisenunterstützerinnen und -unterstützern des Auswärtigen Amts und der Bundespolizei führen die Evakuierung vor Ort durch. Nach einem Zwischenstopp in Jordanien landete am Morgen des 24. April der erste Airbus der Luftwaffe mit Evakuierten sicher in Berlin. Seitdem sind noch weitere Maschinen in Deutschland angekommen. Und die Evakuierungsmission geht derzeit noch weiter.
Dabei stimmt sich das Team des Krisenreaktionszentrums eng mit den Hilfsangeboten anderer befreundeter Staaten ab und hält Kontakt zu den Deutschen im Krisengebiet. Mit Hilfe der Krisenvorsorgeliste ELEFAND verschafft es sich einen Überblick über die Aufenthaltsorte der Deutschen im Land und hält aktiv mit ihnen per sogenanntem Landsleutebrief, SMS und Telefon Kontakt.
Evakuierung – internationale Teamarbeit
Dass bereits über 500 Menschen aus Sudan ausgeflogen werden konnten, ist nicht nur der Teamarbeit innerhalb der Bundesregierung zu verdanken, sondern auch der verlässlichen Abstimmung auf internationaler Ebene, insbesondere mit Frankreich, aber auch den USA und Großbritannien. Und auch die Unterstützung durch Jordanien bei der Einrichtung eines Transithubs war essenziell für die Evakuierungen.
Die Krise in Sudan
Der 15. April ist ein schwarzer Tag in der Geschichte des Sudan: Am Morgen brechen Kämpfe zwischen der regulären sudanesischen Armee und der zuvor mit ihr alliierten RSF, einer paramilitärischen Gruppierung, aus. Es geht um Details einer Vereinbarung, mit der Milizen in die Armee integriert werden sollen. Und es geht um die Macht im Land, ein brutaler Kampf auf dem Rücken der Bevölkerung. Hunderte Menschen werden in den folgenden Tagen landesweit durch die Kämpfe getötet, Tausende verletzt, viele weitere innerhalb des Landes vertrieben.
In dem Land am Horn von Afrika lebten zu Beginn der Kampfhandlungen auch mehrere hundert deutsche Staatsangehörige. Sie arbeiteten u.a. für die Vereinten Nationen, als Fachkräfte der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ, oder andere Hilfsorganisationen. Auch an der Deutschen Botschaft waren entsandte Kolleginnen und Kollegen eingesetzt.
Sudan: Ein Land in Transition
Das Land befand sich seit einigen Jahren in einem politischen Transformationsprozess. Der langjährige Diktator Omar al-Bashir wurde im April 2019 nach Protesten in der Bevölkerung gemeinsam von Militär und RSF – Burhan und Hemedti – gestürzt. Ihm werden vom Internationalen Strafgerichtshof schwere Menschenrechtsverletzungen im Darfur-Konflikt zur Last gelegt. Eine Übergangsregierung scheitert im Oktober 2021. Seitdem ist General Burhan der de-facto Machthaber im Land. Er hat sich bis zum Ausbruch der Kämpfe immer wieder dazu bekannt, die Macht in die Hände einer zivilen Regierung legen zu wollen.
Diplomatische Bemühungen
Das Ausmaß der Kämpfe im ganzen Land zeigt, wie tief das Misstrauen zwischen der Armee und den Milizen sitzt. Trotz des enormen Leids der Menschen setzen beide Konfliktparteien offenbar auf einen Sieg mit militärischen Mitteln. Das ist verheerend für das Land und vor allem für die Menschen.
Seit Beginn der Kämpfe engagiert sich die Bundesregierung gemeinsam mit der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, der Afrikanischen Union, den Ländern der Region und weiteren Partnern für eine belastbare Waffenrufe und die Rückkehr zum Dialog.
Unsere Unterstützung für die Menschen in Sudan geht weiter
Die Lage der Menschen in Sudan ist dramatisch. Die Vereinten Nationen gehen mittlerweile von über 400 Toten und über 3.500 Verletzten aus.
Viele Menschen können aufgrund der anhaltenden Kämpfe seit über einer Woche nicht ihr Haus oder ihre Wohnung verlassen, um sich mit Nahrungsmitteln zu versorgen oder medizinische Hilfe zu bekommen. Mehr und mehr Menschen fliehen aus den Städten. Die Anzahl der Binnenvertriebenen nimmt zu. Etwa ein Drittel der Bevölkerung Sudans war dabei schon vor der krisenhaften Zuspitzung auf humanitäre Hilfe angewiesen. Es steht zu befürchten, dass die Not durch die Kämpfe und Zerstörungen noch weiter zunehmen wird.
Humanitäre Hilfe
Deutschland ist großer und verlässlicher humanitärer Geber in Sudan: Trotz der krisenhaften Zuspitzung der Lage muss es nun darum gehen, überall dort wo die Sicherheitslage es zulässt, Hilfe zu leisten. Allerdings hat sich seit Ausbruch der Kämpfe Mitte April die Situation für Hilfeleistende dramatisch verschlechtert, sie arbeiten oft unter Lebensgefahr. Das Auswärtige Amt unterstützt ein breites Netzwerk aus lokalen und internationalen Hilfsorganisationen. Schwerpunkte der Unterstützung sind Nahrungsmittelhilfen und Schutz, auch für Geflüchtete und Binnenvertriebene. Auch prüfen wir, wie Hilfsorganisationen in Nachbarstaaten, die vorübergehend Menschen aus Sudan aufnehmen, unterstützt werden können.
St. Anton: So erlebte ich den »Weißen Rausch«
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Es ist eins der härtesten Jedermann-Skirennen der Welt. 550 Profis und Pistenschrecks preschen beim »Weißen Rausch« in St. Anton über Sulz, Buckel und Matsch ins Tal. Unser Autor ist mitgefahren...
Urlaub und Inflation: So buchen Sie möglichst günstig Flüge
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Fliegen ist teuer geworden. Doch mit diesen Tipps sparen Sie Geld – und vermeiden später Ärger...
Brexit: Orient-Express fährt nicht mehr ab London
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Der Roman von Agatha Christie machte den Orient-Express berühmt. Die moderne Adaption des Luxuszugs streicht nun nach 41 Jahren eine Teilstrecke – als Folge des Brexits...
Urlaub: Mit dem Zug durch Europa reisen - Podcast mit Cindy Ruch
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Bahnfahrten sind nachhaltiger als Flüge – und sie können unseren Urlaub bereichern. Reisejournalistin Cindy Ruch erklärt, welche Strecken sich lohnen und worauf es bei der Planung ankommt...
Asienreise nach China, Südkorea und zum G7-Treffen nach Japan
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

China: Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale
China spielt mit 1,4 Mrd. Menschen, also fast einem Sechstel der Weltbevölkerung, eine zentrale politische, wirtschaftliche und kulturelle Rolle. China hat sich in den letzten Jahren verändert. Darum passt auch Deutschland seine Chinapolitik an. Vor ihrer Abreise betonte Außenministerin Baerbock hierzu:
Partner, Wettbewerber, systemischer Rivale – das ist der Kompass der europäischen China-Politik. In welche Richtung die Nadel künftig ausschlagen wird, liegt auch daran, welchen Weg China wählt. Mit unserer neuen China-Strategie werden wir einer veränderten Rolle Chinas in der Welt Rechnung tragen. Für unser Land hängt viel davon ab, ob es uns gelingt, unser zukünftiges Verhältnis mit China richtig auszutarieren - als unserem größten Handelspartner und als globalem Akteur, der die Weltordnung zunehmend nach eigenen Vorstellungen gestalten möchte. China hat sich verändert, und nach dem Ende der Corona-Restriktionen will ich mir ein genaueres Bild davon machen, welchen Kurs die neue Führung einschlägt, auch mit Blick auf das Spannungsfeld zwischen politischer Kontrolle und wirtschaftlicher Offenheit.
 Außenministerin Baerbock reist zunächst nach Tianjin, das etwa eine halbe Zugstunde von Peking entfernt liegt. Dort befindet sich der größte Containerhafen Nordchinas, der sechstgrößte weltweit. Es ist auch ein bedeutender Standort für deutsche Unternehmen in dieser Region. Dort besucht die Ministerin das Unternehmen Flender. Unter der Marke „Winergy“ stellt Flender seit 1981 Getriebe für Windturbinen her. Das Unternehmen beliefert Windturbinenhersteller wie z.B. Vestas und montiert und validiert seine Getriebe mit Antriebskomponenten in den Windturbinen seiner Kunden am Unternehmensstandort in Tianjin. Am letzten Tag des China-Besuchs wird Außenministerin Baerbock zudem im VW-Entwicklungszentrum ein Gespräch mit deutschen Unternehmensvertreterinnen und -vertretern zu Chancen und Risiken des deutschen Chinageschäfts führen. In diesem Zusammenhang sagte Außenministerin Baerbock:
Außenministerin Baerbock reist zunächst nach Tianjin, das etwa eine halbe Zugstunde von Peking entfernt liegt. Dort befindet sich der größte Containerhafen Nordchinas, der sechstgrößte weltweit. Es ist auch ein bedeutender Standort für deutsche Unternehmen in dieser Region. Dort besucht die Ministerin das Unternehmen Flender. Unter der Marke „Winergy“ stellt Flender seit 1981 Getriebe für Windturbinen her. Das Unternehmen beliefert Windturbinenhersteller wie z.B. Vestas und montiert und validiert seine Getriebe mit Antriebskomponenten in den Windturbinen seiner Kunden am Unternehmensstandort in Tianjin. Am letzten Tag des China-Besuchs wird Außenministerin Baerbock zudem im VW-Entwicklungszentrum ein Gespräch mit deutschen Unternehmensvertreterinnen und -vertretern zu Chancen und Risiken des deutschen Chinageschäfts führen. In diesem Zusammenhang sagte Außenministerin Baerbock:
Ich will vor Ort Chancen für mehr Zusammenarbeit bei der Förderung der Zivilgesellschaft, beim Klimaschutz und in Zukunftsbranchen wie den erneuerbaren Energien ausloten. Für mich ist klar: an einer wirtschaftlichen Entkopplung haben wir kein Interesse – dies wäre in einer globalisierten Welt ohnehin schwer möglich – aber wir müssen die Risiken einseitiger Abhängigkeiten systematischer in den Blick nehmen und abbauen, im Sinne eines De-Risking.
China war 2022 das siebte Jahr in Folge wichtigster Handelspartner Deutschlands. Zwischen Deutschland und China wurden 2022 Waren im Wert von rund 298 Mrd. Euro gehandelt. Es folgen die USA mit rund 248 Mrd. Euro und die Niederlande mit knapp 234 Mrd. Euro. Das bedeutet einen Zuwachs von 21% im Vergleich zu 2021. Der chinesische Markt ist in einzelnen Sektoren für deutsche Unternehmen sehr bedeutend (20% der in China ansässigen deutschen Unternehmen erzielen dort 20-50% ihrer Gewinne; insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Automobil, Chemie). In China sind rund 5.200 deutsche Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen und Produktionsstätten aktiv und schaffen rd. 1,1 Mio. Arbeitsplätze. Deutschland ist mit einem Direktinvestitionskapitalbestand von 89 Mrd. EUR (2019) der mit Abstand größte europäische Investor in China. Ausländische Unternehmen in China unterliegen systematischen Benachteiligungen (u.a. Ausschluss bei öffentlichen Ausschreibungen, Investitionsverbote bzw. Beteiligungsgrenzen, Pflicht zur Lokalisierung von Produktion bzw. Forschung und Entwicklung, Einschränkung von grenzübergreifenden Datentransfers).
 In Tianjin nimmt die Ministerin zudem am Deutschunterricht in einer deutschen PASCH-Schule teil. Die Tianjin „No. 42 High School“ ist eine staatliche Schule mit Unter- und Oberstufe, die 1954 von der Provinzregierung in der Stadt Tianjin eröffnet wurde.
In Tianjin nimmt die Ministerin zudem am Deutschunterricht in einer deutschen PASCH-Schule teil. Die Tianjin „No. 42 High School“ ist eine staatliche Schule mit Unter- und Oberstufe, die 1954 von der Provinzregierung in der Stadt Tianjin eröffnet wurde.
PASCH steht für „Schulen: Partner der Zukunft“. Die Initiative vernetzt weltweit mehr als 2.000 Schulen, an denen Deutsch einen besonders hohen Stellenwert hat. Die PASCH-Partner beraten Schulleitungen, Ministerien und Schulen bei der Entwicklung des Deutschunterrichts. Entsandte Expertinnen und Experten der PASCH-Partner betreuen die Schulen vor Ort und unterstützen beim Ausbau des Deutschunterrichts. Der Austausch zwischen internationalen und deutschen PASCH-Schulen wird besonders gefördert. Die Schulpartnerbörse trägt zum Aufbau von Schulpartnerschaften bei.
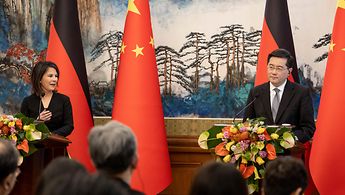 An den beiden folgenden Tagen wird Außenministerin Baerbock in Peking politische Gespräche unter anderem mit ihrem Amtskollegen Qin Gang sowie mit Wang Yi, Direktor der Kommission für Auswärtige Angelegenheiten des Politbüros, sowie mit dem stellvertretenden Staatspräsidenten Han Zheng führen. Bei den Gesprächen wird neben vielen bilateralen Themen auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine oben auf der Agenda stehen. Hierzu unterstrich Außenministerin Baerbock:
An den beiden folgenden Tagen wird Außenministerin Baerbock in Peking politische Gespräche unter anderem mit ihrem Amtskollegen Qin Gang sowie mit Wang Yi, Direktor der Kommission für Auswärtige Angelegenheiten des Politbüros, sowie mit dem stellvertretenden Staatspräsidenten Han Zheng führen. Bei den Gesprächen wird neben vielen bilateralen Themen auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine oben auf der Agenda stehen. Hierzu unterstrich Außenministerin Baerbock:
Als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen trägt China eine besondere Verantwortung für den Weltfrieden. Dass China bereit ist, sich global einzubringen, hat zuletzt die Vermittlung zur Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Iran gezeigt. Welche Rolle China mit seinem Einfluss auf Russland übernimmt, wird für ganz Europa und unsere Beziehung zu China Folgen haben.
Ein weiteres Thema, das im Mittelpunkt der Reise stehen wird, ist die Lage in der Taiwanstraße, die für den weltweiten Handel von herausragender Bedeutung ist. Aus deutscher Sicht gilt es daher unbedingt, eine militärische Eskalation in der Taiwanstraße zu vermeiden. Baerbock hob hervor:
Ich werde bei meinem Besuch deshalb auch die gemeinsame europäische Überzeugung unterstreichen, dass eine einseitige Veränderung des Status Quo in der Taiwanstraße, und erst Recht eine militärische Eskalation inakzeptabel wäre.
China ist heute für 32% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich, damit vier Mal so viel wie die EU (8%). Ohne China sind die Pariser Klimaziele somit nicht erreichbar. Inzwischen ist China auch beim Pro-Kopf-Verbrauch mit Deutschland praktisch gleichgezogen und steht auch bei den historischen Emissionen auf Platz zwei. Hierzu sagte Baerbock:
Und es wird mit China als inzwischen größtem CO2-Emittenten der Welt und zugleich Marktführer bei erneuerbaren Energien darum gehen, wie wir gemeinsam mehr tun können, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen.
Südkorea: Wertepartner und High-Tech Land
Als lebendige Demokratie ist Südkorea Wertepartner Deutschlands. Das Land zählt zu den wichtigen Industrie- und Handelsnationen in Asien und kann auf eine rasante Entwicklung seit dem Ende des Koreakriegs 1953 zurückblicken. Heute setzt es als High-Tech-Land Maßstäbe und hat damit großes Potential für die Diversifizierung der deutschen Handelsbeziehungen in Asien. Außenministerin Baerbock betonte:
Südkorea steht als enger Verbündeter felsenfest an unserer Seite. Das zeigt: politische Nähe lässt sich nicht an geographischer Distanz messen. Mit Südkorea verbindet uns neben gefestigten demokratischen Werten auch die Erfahrung der nationalen Teilung. Dort wird es auch um unser gemeinsames Interesse an regionaler Stabilität im Indopazifik gehen, die zuletzt durch Nordkoreas völkerrechtswidrige Raketentests gefährlich unter Beschuss geraten ist. Umso bedeutender ist es, dass durch die historische Annäherung Südkoreas und Japans zwei gute Freunde Deutschlands den Weg zu einander gefunden haben. Denn unsere äußere Stärke als Verbündete ergibt sich aus unserem inneren Zusammenhalt als Wertepartner in der ganzen Welt.
 Außenministerin Baerbock wird zunächst die Demilitarisierte Zone, die Süd- und Nordkorea trennt, besuchen. Die Demilitarisierte Zone (DMZ) teilt die Koreanische Halbinsel in Nord- und Südkorea auf und führt auf einer Länge von 248 Kilometern und einer Breite von vier Kilometern einmal quer über die Halbinsel. In ihrer Mitte verläuft die Militärische Demarkationslinie (MDL), die Grenze zwischen Nord- und Südkorea. Die DMZ wurde im Waffenstillstandsabkommen am 27. Juli 1953 zwischen der UNO und Nordkorea begründet. In der DMZ befindet sich die Joint Security Area, an der 1953 der Waffenstillstandsvertrag unterschrieben wurde.
Außenministerin Baerbock wird zunächst die Demilitarisierte Zone, die Süd- und Nordkorea trennt, besuchen. Die Demilitarisierte Zone (DMZ) teilt die Koreanische Halbinsel in Nord- und Südkorea auf und führt auf einer Länge von 248 Kilometern und einer Breite von vier Kilometern einmal quer über die Halbinsel. In ihrer Mitte verläuft die Militärische Demarkationslinie (MDL), die Grenze zwischen Nord- und Südkorea. Die DMZ wurde im Waffenstillstandsabkommen am 27. Juli 1953 zwischen der UNO und Nordkorea begründet. In der DMZ befindet sich die Joint Security Area, an der 1953 der Waffenstillstandsvertrag unterschrieben wurde.
Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben in den vergangenen Monaten stark zugenommen. 2022 hat Nordkorea mit 35 Raketentestserien so viele Raketen abgeschossen wie nie zuvor, darunter auch Interkontinentalraketen, was einen Bruch des 2018 selbst erklärten Moratoriums darstellt. Die Lage auf der koreanischen Halbinsel wird die Außenministerin auch mit ihrem Amtskollegen Pak Jin im Rahmen des strategischen Dialogs in der Hauptstadt Seoul besprechen. Den Dialog gibt es seit 2018. Er dient dazu, einmal zu allen Themen miteinander ins Gespräch zu kommen. Daneben geht es auch um die engen bilateralen Beziehungen.
Südkorea ist Deutschlands drittwichtigster Handelspartner in Asien und rund 5.700 Studierende sind an deutschen Hochschulen eingeschrieben. 2023 begehen Deutschland und Südkorea den 140. Jahrestag der Aufnahme bilateraler Beziehungen, die mit dem Handels-, Freundschafts- und Schifffahrtsvertrag am 26.11.1883 begannen.
Japan: Treffen der G7-Außenministerinnen und Außenminister in Karuizawa
Anfang des Jahres übernahm Japan den G7-Vorsitz von Deutschland. Vom 16. bis 18. April 2023 findet das erste Treffen der Außenministerinnen- und Außenminister unter japanischem Vorsitz statt. In mehreren Arbeitssitzungen werden sich die G7 Außenministerinnen und Außenminister mit verschiedenen geopolitischen und sicherheitspolitischen Fragen wie beispielsweise dem Verhältnis zu China, Zusammenarbeit im Indopazifik, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, den Entwicklungen in Iran und der Lage in Zentralasien und in Afghanistan beschäftigen. Hinzu kommen wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Themen wie globale Gesundheit und die Klimakrise. Der informelle Charakter des Treffens erlaubt den Ministerinnen und Ministern einen sehr engen und vertrauensvollen Austausch.
Karuizawa liegt auf einer Hochebene, etwa 900 bis 1100 m über dem Meeresspiegel, am südlichen Abhang des Asama, dem aktivsten Vulkan Japans. Ab dem Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte er sich schnell zu einer beliebten Urlaubsregion.
Am Rande der Konferenz sind zudem bilaterale Gespräche von Außenministerin Baerbock mit Amtskolleginnen und -kollegen geplant, darunter mit ihrem japanischen Amtskollegen und Gastgeber Yoshimasa Hayashi.
Mit Kind durch Japan: Wie ich meinem Sohn das Land meiner Jugend zeigte
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Ich habe in Japan Abitur gemacht und studiert. Nun bin ich für einen Urlaub in das Land zurückgekehrt – mit meinem neunjährigen Sohn...
Die NATO als Sicherheitsanker – Außenministerin Baerbock in Brüssel
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Auf der Tagesordnung des Treffens der Außenministerinnen und Außenminister der NATO stehen Russlands Krieg gegen die Ukraine sowie die Fortsetzung der Unterstützung für die Ukraine, die Vorbereitung des NATO-Gipfels am 11.-12. Juli in Vilnius und die Zusammenarbeit mit NATO-Partnern in der Asien-Pazifik-Region.
Zu Beginn des Treffens ist vor dem Brüsseler NATO-Hauptquartier eine Beitrittszeremonie geplant. Nachdem vergangene Woche auch die noch ausstehenden Ratifikationen erfolgt sind, wird Finnland der NATO beitreten. Auch Schweden ist auf dem Weg in die NATO. Bei diesem Treffen der NATO – wie bei den vergangenen Treffen – wird Schweden wieder als Gast mit dabei sein. Vor neun Monaten, am 5. Juli 2022, hatten die NATO-Staaten die Beitrittsprotokolle für Schweden und Finnland gezeichnet.
Austausch im Rahmen der NATO-Ukraine-Kommission
 Zu Beginn ihres Treffens werden die NATO-Alliierten gemeinsam mit dem Außenminister der Ukraine, Dmytro Kuleba, im Rahmen der „NATO-Ukraine-Kommission“ zusammentreffen. Bereits 1997 wurde dieses gemeinsame Forum zum Austausch zwischen den Alliierten und der Ukraine ins Leben gerufen. Dass die Kommission heute das erste Mal seit März 2017 auf Ebene der Ministerinnen und Minister zusammentrifft, ist ein besonderes Signal der Unterstützung an die Ukraine. Bei der heutigen Sitzung der Kommission wird es um die Unterstützung der NATO-Staaten für die Ukraine angesichts des russischen Angriffskriegs gehen.
Zu Beginn ihres Treffens werden die NATO-Alliierten gemeinsam mit dem Außenminister der Ukraine, Dmytro Kuleba, im Rahmen der „NATO-Ukraine-Kommission“ zusammentreffen. Bereits 1997 wurde dieses gemeinsame Forum zum Austausch zwischen den Alliierten und der Ukraine ins Leben gerufen. Dass die Kommission heute das erste Mal seit März 2017 auf Ebene der Ministerinnen und Minister zusammentrifft, ist ein besonderes Signal der Unterstützung an die Ukraine. Bei der heutigen Sitzung der Kommission wird es um die Unterstützung der NATO-Staaten für die Ukraine angesichts des russischen Angriffskriegs gehen.
Auch außerhalb der NATO unterstützt Deutschland die Ukraine politisch, humanitär, finanziell und durch militärische Lieferungen. Seit dem russischen Überfall hat Deutschland der Ukraine bereits Hilfen im Gesamtwert von mehr als 14 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Eine wichtige Lieferung ist vor wenigen Tagen eingetroffen: 18 Kampfpanzer des Typs Leopard 2 A6 in der Ukraine. Mehr Infos zu den militärischen Unterstützungsleistungen findet man hier.
Am 4. April feiert die NATO ihren „NATO-Tag“. In diesem Jahr wird das 74-jährige Bestehen der Nordatlantischen Allianz begangen. Am 4. April 1949 schlossen zwölf Staaten Europas und Nordamerikas in Washington den Nordatlantikvertrag. Neben Neumitglied Finnland gehören der Nordatlantikpakt-Organisation folgende 30 Staaten an: Albanien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Griechenland, Island, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, die Slowakei, Slowenien, Spanien, die Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und die Vereinigten Staaten von Amerika. Schweden hat einen Beitrittsantrag gestellt und ist auf dem Weg, ebenfalls Mitglied der NATO zu werden.
Blick auf die Asien-Pazifik-Region
Am Mittwoch werden die Außenministerinnen und Außenminister ihre Gespräche fortsetzen, auch um den NATO-Gipfel der Staats- und Regierungschefs am 11. und 12. Juli in Litauens Hauptstadt Vilnius vorzubereiten. Es geht dabei unter anderem um die Frage der Verteidigungsausgaben. 2024 läuft der sogenannte „Defence Investment Pledge“ von Wales aus und es geht jetzt darum, eine Nachfolgeregelung zu finden.
In ihrer dritten Arbeitssitzung stoßen dann vier Partner aus dem Asien-Pazifik-Raum zu den Beratungen dazu: Die Außenministerinnen und Außenminister von Australien, Japan, Südkorea und Neuseeland, die sogenannten „Asia-Pacific-Four“, werden virtuell oder in Präsenz mit den NATO-Alliierten unter anderem über die globalen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sprechen. Ein weiteres Thema wird die wachsende Rolle Chinas und dessen Auftreten in der Asien-Pazifik-Region sein.
Jordaniens Außenminister zu Besuch in Berlin: Was steht auf der Agenda?
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Hauptthema beim heutigen Treffen von Außenministerin Annalena Baerbock und ihrem jordanischen Amtskollegen Ayman Safadi wird vor allem der Nahostkonflikt sein. Jordanien spielt eine hervorgehobene Rolle bei der Suche nach einer Lösung dieses Konflikts. Vor wenigen Wochen haben sich im sogenannten Aqaba-Format Israelis und Palästinenser gemeinsam mit den USA, Jordanien und Ägypten in der Stadt Aqaba, im Süden von Jordanien, getroffen.
Warum fand das Treffen in Aqaba statt und was ist besonders daran?
Ziel des Zusammenkommens war, die Sicherheitslage im Westjordanland sowie Ost-Jerusalem zu verbessern und zu verhindern, dass sich der Konflikt weiter zuspitzt. Seit Beginn des Jahres kamen dutzende Palästinenserinnen, Palästinenser und Israelis ums Leben. Es gibt zudem immer wieder Berichte über Gewalt israelischer Siedlerinnen und Siedler gegen Palästinenserinnen und Palästinenser, israelische Aktivistinnen und Aktivisten oder auch gegen israelische Soldatinnen und Soldaten.
Dieses Treffen war das erste direkte Gespräch zwischen Israelis und Palästinensern seit über 10 Jahren. Vereinbart wurde zum Beispiel ein Stopp des Siedlungsbaus für vier Monate. Man wolle auf einen „gerechten und langfristigen Frieden“ hinarbeiten. Es gab bereits ein weiteres Treffen im Aqaba-Format in Ägypten.
Auf dieser Basis muss nun weitergemacht werden. Deutschland engagiert sich gemeinsam mit Jordanien, Ägypten und Frankreich im Rahmen des Münchner Formats, um den Konfliktparteien Vorschläge zu unterbreiten, wie das Vertrauen zwischen beiden Seiten wiederaufgebaut werden kann. Es bleibt erklärtes Ziel der Bundesregierung, die Grundlagen der Zwei-Staaten-Lösung zu erhalten und eine weitere Erosion des Friedensprozesses zu vermeiden. Nur so kann zu gegebener Zeit ein neuer Anlauf für Verhandlungen ermöglicht werden.
Deutschland und Jordanien: 70 Jahre diplomatische Beziehungen
Außenministerin Baerbock und ihr jordanischer Kollege Safadi werden auch über die bilateralen Beziehungen sprechen. Deutschland und Jordanien sind eng verknüpft: Beide Länder pflegen seit 2018 einen strategischen Dialog, der dazu dient, sich in vielen Bereichen eng abzustimmen. Bei so einem strategischen Dialog sind nicht nur das Außenministerium, sondern gleich mehrere Ministerien einbezogen. Bereits seit 2005 gibt es eine deutsch-jordanische Universität mit knapp 4.600 Studierenden und 120 deutschen Partnerhochschulen und seit über 60 Jahren arbeiten beide Staaten in der Entwicklungszusammenarbeit zusammen. Mit dem Ta’ziz-Programm fördert das Auswärtigen Amt unabhängige Akteure aus Zivilgesellschaft und Medien, mit Fokus auf der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Jugendlichen sowie marginalisierten Gruppen.
Jordanien und Deutschland verbindet auch, dass beide Länder zum Zuhause vieler syrischer Flüchtlinge geworden sind. Mit über 670.000 registrierten syrischen Flüchtlingen und 2,3 Mio. bei UNRWA registrierten Palästina-Flüchtlingen ist Jordanien eines der wichtigsten Aufnahmeländer der Region. Bei der Aufgabe, diese Menschen zu versorgen, werden wir Jordanien weiter zur Seite stehen.
Neuseelands neuer Great Walk: Tuatapere Hump Ridge Track - am äußeren Rand der Welt entlang
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Neuseeland lockt wandernde Touristen mit den »Great Walks« durch Regenwälder, über Berge und an Strände. Der bald neueste führt an der Südspitze entlang. Doch wie »great« ist der Tuatapere Hump Ridge wirklich? ...
EU-Mission „IRINI“: Durchsetzung des VN-Waffenembargos gegen Libyen
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Was genau macht IRINI?
Die maritime EU-Operation EUNAVFOR MED IRINI wurde im März 2020 im Nachgang zur Berliner Libyen-Konferenz geschaffen. Sie hat mehrere Aufgaben: Kernaufgabe ist die Umsetzung und Durchsetzung des Waffenembargos der Vereinten Nationen gegenüber Libyen. Die Staats- und Regierungschefs und Vertreter internationaler Organisationen hatten im Januar 2020 in Berlin bekräftigt, dass dieses Waffenembargo strikt eingehalten werden muss, damit der Konflikt im Land nicht durch Waffenlieferungen aus dem Ausland weiter angeheizt wird. Darüber hinaus soll die Operation auch Informationen über illegale Öl-Exporte aus Libyen sammeln und gegen Menschenschmuggel vorgehen.
 Deutschland hat sich von Beginn an bei IRINI beteiligt. Die vom Bundestag mandatierte Höchstgrenze dieser Beteiligung liegt bei 300 Soldatinnen und Soldaten. Die Bundeswehr unterstützt unter anderem durch den Einsatz eines Seefernaufklärers und ist zudem regelmäßig mit einem Schiff im Einsatzgebiet präsent. Mehr zum konkreten Einsatz erfahren Sie auf bundeswehr.de.
Deutschland hat sich von Beginn an bei IRINI beteiligt. Die vom Bundestag mandatierte Höchstgrenze dieser Beteiligung liegt bei 300 Soldatinnen und Soldaten. Die Bundeswehr unterstützt unter anderem durch den Einsatz eines Seefernaufklärers und ist zudem regelmäßig mit einem Schiff im Einsatzgebiet präsent. Mehr zum konkreten Einsatz erfahren Sie auf bundeswehr.de.
Die Bundesregierung hat beschlossen, dass die deutsche Beteiligung an der Mission um ein weiteres Jahr bis zum 30. April 2024 fortgesetzt werden soll. Über die Mandatsverlängerung wird nun der Bundestag beraten und dann entscheiden.
Ausbildung der libyschen Küstenwache nicht Teil des Mandats
Die im EU-Mandat enthaltene Ausbildung der libyschen Küstenwache und Marine wurde durch EUNAVFOR MED IRINI bisher nicht begonnen. Die Ausbildung ist zudem nicht Teil des Bundestagsmandats. Mit Blick auf das untragbare Verhalten einzelner Einheiten der libyschen Küstenwache gegenüber Flüchtlingen und Migranten sowie Nicht-Regierungsorganisationen ist eine Ausbildung der libyschen Küstenwache durch deutsche Soldatinnen und Soldaten derzeit nicht zu vertreten.
Warum ist IRINI weiterhin wichtig?
Nachdem am 23. Oktober 2020 in Libyen ein Waffenstillstand vereinbart wurde, hatten beide Konfliktseiten mit vertrauensbildenden Maßnahmen begonnen. Das unter VN-Ägide ins Leben gerufene „Libysche Politische Dialogforum“ hat im Februar 2021 einen Präsidialrat und einen Ministerpräsidenten bestimmt, die eine neue Übergangs-Einheitsregierung bildeten und das Land bis Jahresende zu Wahlen führen sollten. Aufgrund von Uneinigkeiten wurden die angesetzten Wahlen abgesagt.
Der politische Transitionsprozess ist seitdemverzögert. Der seit September 2022 amtierende neue VN-Sondergesandte für Libyen hat im Februar 2023 Mediationspläne präsentiert, die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Jahr 2023 ermöglichen sollen. Vor diesem Hintergrund bleibt eine aktive Begleitung entlang des Berliner Prozesses unter VN-Ägide und die Implementierung des VN- Waffenembargos durch die EU-Mission IRINI weiter erforderlich.
IRINI verfügt über Einheiten in der Luft und zu See und betreibt satellitengestützte Aufklärung. Hierdurch können Schiffe, die verdächtigt werden, gegen das Waffenembargo zu verstoßen, aufgespürt und auf hoher See kontrolliert werden. Durch die vielseitigen Aufklärungsfähigkeiten ist es auch möglich, Hinweise auf Verstöße gegen das Waffenembargo auf dem Luft- oder Landweg zu sammeln. Die so beschafften Informationen werden unter anderem an das Expertengremium des Libyen-Sanktionsausschusses des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen weitergegeben. Operation IRINI trägt so zu mehr Transparenz bei und macht Verstöße gegen das Waffenembargo durch Personen, Unternehmen und Staaten sichtbarer.
Maßnahmen für Flüchtlinge in Seenot
Für alle im Rahmen von EUNAVFOR MED IRINI eingesetzten Schiffe gilt die völkerrechtliche Verpflichtung, in Seenot geratenen Personen zu helfen. Leistet ein an EUNAVFOR MED IRINI beteiligtes Schiff eine solche Seenothilfe, so sieht eine sog. „Ausschiffungsregelung“ vor, dass die aus Seenot Geretteten in Griechenland an Land gehen können. Danach werden aus Seenot Gerettete auf verschiedene Mitgliedstaaten der EU verteilt, die sich bereiterklärt haben, sie aufzunehmen.
Taipeh und Taiwan: Wo Technoparty und Sexausstellung auf traditionelle Zeremonien treffen
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Beats wie im Berghain, mutige Museen und eine junge Generation, die ihre Identität neu aushandelt: Unser Autor hat sich durch die energiegeladene Hauptstadt Taiwans treiben lassen...
Unter dem Motto Energiewende – Securing a Green Future“ beginnt der 9. Berlin Energy Transition Dialogue im Auswärtigen Amt
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat uns vor Augen geführt: Bei der Energiewende geht es um mehr als Klimaschutz, es geht um unsere Sicherheit, denn fossile Energien machen uns abhängig und verwundbar. Wir brauchen daher mehr erneuerbare Energien, um die globale Klimakrise einzudämmen, aber auch, um unsere Unabhängigkeit, Energieversorgung und dauerhaften Wohlstand zu sichern.
„Energiewende – Securing a Green Future“
 Wie wir die globale Energiewende und den Ausstieg aus fossilen Energien gemeinsam beschleunigen können, darum geht es beim 9. Berlin Energy Transition Dialogue, der heute unter dem Motto „Energiewende – Securing a Green Future“ im Auswärtigen Amt beginnt. Etwa 2.000 Besucherinnen und Besucher diskutieren gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus über 90 Ländern, der Wirtschaft, internationaler Energieorganisationen und der Zivilgesellschaft. Es geht dabei um die Frage, wie sie ambitionierte Lösungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben wollen.
Wie wir die globale Energiewende und den Ausstieg aus fossilen Energien gemeinsam beschleunigen können, darum geht es beim 9. Berlin Energy Transition Dialogue, der heute unter dem Motto „Energiewende – Securing a Green Future“ im Auswärtigen Amt beginnt. Etwa 2.000 Besucherinnen und Besucher diskutieren gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus über 90 Ländern, der Wirtschaft, internationaler Energieorganisationen und der Zivilgesellschaft. Es geht dabei um die Frage, wie sie ambitionierte Lösungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben wollen.
Einer von ihnen ist Kenias Staatspräsident William Ruto, denn sein Land hat einen ambitionierten Kurs zur Umstellung der Stromversorgung auf hundert Prozent Erneuerbare bis 2030 eingeschlagen und dient somit als Vorbild – nicht nur in Afrika, sondern weltweit.
Zum Auftakt des 9. Berlin Energy Transition Dialogue sagte Außenministerin Baerbock:
Der BETD ist der globale Treffpunkt für diejenigen, die diese Chance nutzen wollen oder schon vorangehen. Kenia zum Beispiel zeigt, dass es möglich ist, komplett auf Erneuerbare umzusteigen. Die weltweite Energiewende muss jetzt an Tempo zulegen – für das Klima und für unseren Wohlstand.
Die Energiewende global vorantreiben
 Die Klimakrise ist die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Bereits heute leben über drei Milliarden Menschen in Regionen, die massiv vom Klimawandel bedroht sind. Zugleich verschärft die Klimakrise bestehende Konflikte durch immer knapper werdende Ressourcen. Die Staatengemeinschaft hat sich daher dazu verpflichtet, die globale Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen, denn das ist die Schmerzgrenze des Planeten.
Die Klimakrise ist die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Bereits heute leben über drei Milliarden Menschen in Regionen, die massiv vom Klimawandel bedroht sind. Zugleich verschärft die Klimakrise bestehende Konflikte durch immer knapper werdende Ressourcen. Die Staatengemeinschaft hat sich daher dazu verpflichtet, die globale Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen, denn das ist die Schmerzgrenze des Planeten.
Der jüngste Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) hat gezeigt, wir werden nur dann die 1,5–Grad-Marke in Reichweite halten können, wenn wir bis 2030 die globalen Emissionen halbieren. Dies wird jedoch nur gelingen, wenn sich auf allen Kontinenten Länder dazu entschließen, die Energiewende ambitionierter als bisher anzugehen. Die Bundesregierung unterstützt daher auch andere Länder dabei, ihre eigene Energiewende voranzutreiben und ihre nationalen Klimaziele zu erreichen. Dabei bietet die Energiewende auch enorme wirtschaftliche Chancen.
Außenministerin Baerbock betonte mit Blick auf die wirtschaftlichen Chancen der Energiewende:
Der massive Umstieg auf erneuerbare Energien ist nicht nur dringend nötig, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen, er ist zugleich eine riesige wirtschaftliche Chance für Unternehmen und Staaten. Die Investitionen von heute entscheiden darüber, wer in dieser neuen industriellen Revolution die Nase vorn hat. Deutschland unterstützt Partner auf der ganzen Welt dabei, ihre Chance zu ergreifen. Länder, die heute etwa in grünen Wasserstoff investieren, können die Gewinner von morgen sein.
Das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie richten seit 2015 gemeinsam den Berlin Energy Transition Dialogue (BETD) aus, der vom Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE), dem Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar), der Deutschen Energie-Agentur (dena) und der Firma Eclareon organisiert wird. Im Mittelpunkt der zweitägigen Konferenz liegt die Beschleunigung der Energiewende und der Ausstieg aus fossilen Energien zum Erreichen globaler Klimaziele. Die Konferenz kann im Livestream verfolgt werden. Weitere Informationen dazu und zur Konferenz finden Sie hier: https://www.energydialogue.berlin
Gemeinsam voran: Außenministerin Baerbock in Rotterdam
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Deutschland und die Niederlande verbinden nicht nur 567 Kilometer gemeinsame Grenze, sondern vor allem auch die vielen Menschen, die sie jeden Tag überqueren: die zur Arbeit pendeln, studieren, Familie und Freunde besuchen oder regelmäßig im Nachbarland Urlaub machen. Mit wenig anderen Ländern sind die Beziehungen so eng und vertrauensvoll, sei es wirtschaftlich und politisch oder aber auch militärisch und kulturell. Denn Deutschland und die Niederlande verbinden gemeinsame Werte, besonders in Krisenzeiten.
Beide Länder stehen vor gemeinsamen Herausforderungen: Vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine über die Wirtschaftssicherheit im härter werdenden Wettbewerb mit China bis hin zur Frage, wie wir Europa zukunftsfest machen.
Bereits zum vierten Mal treffen sich heute die Regierungen Deutschlands und der Niederlande, um im Rahmen der deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen die gemeinsamen Vorhaben in zentralen Politikfeldern voranzutreiben. Im Mittelpunkt stehen dabei drei Themen, die beiden Ländern besonders am Herzen liegen: Klimaschutz und Energiesicherheit, Innovation und Digitalisierung und nicht zuletzt die Sicherheit und Verteidigung angesichts der russischen Aggression gegen die Ukraine.
Unsere beiden Länder sind sich einig: Die größte Stärke Europas ist Geschlossenheit. Gemeinsam mit den Niederlanden unterstützt Deutschland die Ukraine militärisch, finanziell und humanitär - sowohl bilateral als auch im Rahmen der EU. Beide Länder treiben die Initiative für ein Sondertribunal gegen Russland voran und unterstützen die Ermittlungsarbeit in der Ukraine, v.a. auch die des Internationalen Strafgerichtshof (IStGH).
Das Format der Regierungskonsultationen ist dabei eines, das Deutschland nur mit einigen wenigen Ländern durchführt. Enge europäische Freunde gehören dazu, ebenso strategische Partner wie etwa Indien oder Brasilien. Die Niederlande sind als gleichgesinnter Nachbarn und Freund im Herzen Europas ein natürlicher Kandidat für dieses Format.
Skytrax-Ranking 2023: Hier fühlen sich die Reisenden am wohlsten
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Singapur, Doha und Tokio – Passagiere küren diese Flughäfen wieder zu den besten der Welt. Doch Europa zeigt sich stark, wie die aktuelle Skytrax-Umfrage ergab. Ein deutscher Airport hält sich immerhin unter den Top Ten...
Tourismus im Dusky Sound in Neuseeland: Warum ich im Urlaub Ratten jagte
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Wolkenverhangen und atemberaubend schön: Der abgelegene Dusky Sound ist ein Refugium für fast ausgestorbene Vogelarten. Auch Touristen kämpfen für ihren Erhalt – und chillen danach auf dem Schiffsdeck...
Weitere Unterstützung für die Ukraine – Außenministerin Baerbock bei EU-Außenrat in Brüssel
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Russlands verheerender Angriffskrieg gegen die Ukraine bleibt das zentrale Thema für die gemeinsame europäische Außenpolitik. Über ein Jahr ist seit Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 vergangen. Die EU hat seitdem den Menschen in der Ukraine, die sich dem unrechtmäßigen russischen Angriff widersetzen, den Rücken gestärkt. Militärisch, finanziell und humanitär unterstützt die EU die Ukrainerinnen und Ukrainer. Über 4 Millionen Geflüchtete aus der Ukraine haben Zuflucht gesucht und unmittelbar Schutz in der EU erhalten.
Beim Treffen der EU-Außenministerinnen und Außenminister in Brüssel wird es um Möglichkeiten weiterer Unterstützung gehen – sei es beim Wiederaufbau zerstörter Wasser- und Energieversorgung oder durch militärische Hilfen und die Lieferung von Munition. Eine gemeinsame europäische Sonderinitiative zur Munitionsbeschaffung für die Ukraine wird das zentrale Thema bei einer gemeinsamen Sitzung der Außenministerinnen und Außenminister mit den Verteidigungsministerinnen und Verteidigungsministern am Nachmittag sein. Annalena Baerbock und Boris Pistorius werden gemeinsam an diesem Austausch teilnehmen.
Die rechtliche Aufarbeitung russischer Kriegsverbrechen bleibt auch weiterhin wichtiges Thema für die EU-Außenministerinnen und -Außenminister. Vor wenigen Tagen erst hat die Untersuchungskommission des VN-Menschenrechtsrats das Ausmaß der bekannten Gräueltaten aufgezeigt, die im Rahmen des Kriegs bislang verübt wurden.
Vor der Akademie für Völkerrecht forderte Außenministerin Baerbock in Den Haag am 16. Januar 2023, dass Russland für die im Krieg verübten Verbrechen zur Rechenschaft gezogen wird:
Das Völkerrecht ist stark. […] Davon bin ich zutiefst überzeugt. Aber damit das Völkerstrafrecht jetzt seine Stärke entfalten kann, müssen wir Verantwortung übernehmen. Damit Aggression nicht ungestraft bleibt, damit Gerechtigkeit keine abstrakte Größe bleibt, sondern eine wirkliche Perspektive ist. Damit diejenigen, die unseren Frieden brechen, nicht ungestraft davonkommen. Egal wo auf der Welt.
Ein schreckliches Beispiel für russische Verbrechen in der Ukraine ist die Verschleppung Tausender ukrainischer Kinder nach Russland – gegen den Willen der Kinder und der Erziehungs- und Sorgeberechtigten. Auch hier wollen sich die EU und die Mitgliedstaaten noch stärker engagieren, damit Kinder wieder in ihre Heimat zurückkehren können und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Auf deutsche und niederländische Initiative wurden unter anderem im Rahmen des 10. Sanktionspakets gezielt Verantwortliche mit Sanktionen belegt.
Lage in Tunesien als weiterer Schwerpunkt beim EU-Außenrat
Die EU-Außenministerinnen und Außenminister werden auch über die Zusammenarbeit mit Tunesien sprechen. In dem nordafrikanischen Nachbarland der EU leben viele Menschen in einer schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Lage. Mit Sorge blickt die EU auf demokratische Rückschläge in Folge der umfassenden Verfassungsänderung von Staatspräsident Saied.
Die kürzlich erfolgte Verhaftungswelle von Vertreterinnen und Vertretern der tunesischen Opposition, Medienschaffenden sowie von Aktivistinnen und Aktivisten verschärft die Lage. Ziel der EU ist es, die tunesische Zivilgesellschaft zu unterstützen und die dringend notwendigen Reformen im Wirtschafts- und Sozialbereich zu fördern.
Für Menschenrechte: Reaktion der EU auf Lage in Iran und Afghanistan
Auch die Lage der Menschen in Iran steht erneut auf der Tagesordnung. Anlass sind die fortdauernden Repressionen des Regimes gegen die iranische Bevölkerung. Die Außenministerinnen und Außenminister werden ein weiteres Paket mit Listungen unter dem Sanktionsregime gegen Menschenrechtsverletzungen annehmen – seit Beginn der Proteste im September 2022 ist es bereits das sechste Paket dieser Art.
In Brüssel wird es erneut auch um die schwierige Situation in Afghanistan gehen. Seit der Machtübernahme schrumpfen die Freiheitsrechte in dem Land – insbesondere Frauen und Mädchen leiden unter unmenschlichen Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit. Als Ergebnis deutscher Bemühungen werden die Außenministerinnen und Außenminister bei ihrem Treffen auch Ratsschlussfolgerungen zu Afghanistan annehmen. Damit bezieht die EU klar Stellung gegen Aussperrungen aus Universitäten und Schulen, Parkverbote und Kleidungsvorschriften, die ein selbstbestimmtes Leben für Frauen in Afghanistan so gut wie unmöglich machen.
Als Reaktion hat die EU am Internationalen Frauentag, am 8. März, u.a. zwei de facto "Taliban-Minister" mit Sanktionen belegt. Sie sind verantwortlich für das Zugangsverbot zum Hochschulwesen für Frauen und für die Geschlechtertrennung im öffentlichen Raum. Das EU-Sanktionspaket vom 8. März, das sich gegen sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt in Russland, Südsudan, Afghanistan, Myanmar und Syrien richtet, war auf deutsch-französisch-niederländische Initiative zustande gekommen.
Schwere Erdbeben in der Türkei und Syrien: Deutschland und Europa helfen den Menschen vor Ort
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Deutschlands Engagement in den von den Erdbeben betroffenen Gebieten in der Türkei und in Syrien
Die Bundesregierung hat seit den Erdbeben Hilfe in Höhe von 238 Millionen Euro für die betroffenen Menschen in der Türkei und in Syrien zugesagt. Dies umfasst die Kosten für Such- und Bergungsteam, die unmittelbar nach der Katastrophe zum Einsatz kamen, und für humanitäre Hilfe, die die Folgen der Beben adressiert. Zu den bisher bereitgestellten Mitteln in Höhe von 108 Millionen Euro hat die Bundesregierung bei der Unterstützungskonferenz in Brüssel am 20. März weitere 130 Millionen Euro hinzugefügt. Damit wird Deutschland auch nach Abschluss der akuten Bergungsphase die Menschen in den betroffenen Erdbebengebieten nicht allein lassen und weiterhin bedarfsorientiert und zielgerichtet Unterstützung leisten.
Unterstützung für die Menschen in der Türkei
Deutschland hat unmittelbar nach den Erdbeben gemeinsam mit seinen europäischen und internationalen Partnern auf die türkische Bitte nach Unterstützung bei der Bergung von Verschütteten reagiert. Denn in solchen Notfällen ist es essentiell wichtig, auf die konkreten Anforderungen der betroffenen Länder zu hören und das bereitzustellen, was wirklich hilft.
So waren zwei Such- und Bergungsteams – entsandt von I.S.A.R.-Germany und dem THW - in der Türkei im Einsatz. Auch die Bundespolizei war mit Rettungssanitätern und Spürhunden vor Ort. Viele weitere EU-Partner haben ebenfalls Such-und Rettungsteams mit insgesamt über 1.000 Rettungskräften und 70 Spürhunden über das EU-Katastrophenschutzverfahren mobilisiert. Diese sind speziell dafür ausgebildet, mit schwerem Gerät und Hunden Menschen aus solchen Notsituationen zu retten. Und auch unser NGO-Partner @fire war vor Ort und hat den Flughafenbetrieb in Adana und den Rettungseinsatz in Kahramanmaras unterstützt.
Die Bedingungen der Überlebenden sind prekär: Tausende Menschen haben ihr Zuhause verloren, die Versorgung mit Nahrungsmitteln, Trinkwasser und medizinischen Gütern ist beeinträchtigt. Benötigt werden zum Beispiel Zelte, Schlafsäcke, Decken, Feldbetten, Heizgeräte und Generatoren. Das Technische Hilfswerk stellt daher mit Mitteln des Auswärtigen Amts bereits 343 Tonnen an derartigen Hilfsgütern bereit. Aber auch die Bundesländer und das Bundesgesundheitsministerium haben Angebote über das EU-Katastrophenschutzverfahren für die Türkei gemacht. Ein Großteil dieser Hilfsgüter wurde schon von der Bundeswehr in die Krisenregion transportiert.
Die deutschen Durchführungsorganisationen GIZ und KfW sind ebenfalls in der Krisenregion vor Ort und setzen mit Entwicklungsgeldern Projekte zur Unterstützung und Integration syrischer Geflüchteter sowie aufnehmender Gemeinden um. Zur unmittelbaren Reaktion wurden bereits ad hoc 13 Millionen Euro für Unterstützungsmaßnahmen wie die Bereitstellung von psychologischen Ersthilfeteams und Barmittelhilfe für kleine Unternehmen geleistet.
Deutschland wird sich auch zukünftig weiter engagieren und hört dabei genau auf die von der Türkei formulierten Bedarfe, zum Beispiel mit Blick auf Wasseraufbereitung und medizinische Versorgung.
Hilfe für die Menschen in Syrien
Auch Syrien wurde stark von den Erdbeben getroffen. Besonders in Nordwest-Syrien einschließlich der Region Idlib, wo die humanitäre Lage ohnehin extrem angespannt war und zahlreiche syrische Binnenvertriebene leben, gab es enorm viele Tote und Verletzte. Hinzu kommt, dass genau diese Gebiete bereits vor den Erdbeben stark betroffen waren von dem nunmehr 12 Jahre anhaltenden Konflikt. Die Unterstützung der notleidenden Menschen vor Ort hat daher ebenfalls hohe Priorität für die Bundesregierung.
Als einer der größten Unterstützer der Menschen in Nordwest-Syrien hat Deutschland bereits vor den Erdbeben umfangreiche humanitäre Hilfe geleistet und im vergangenen Jahr rund 100 Millionen Euro für die Arbeit unserer Partner vor Ort bereitgestellt. Dieses etablierte Netzwerk hat dazu beigetragen, dass wir auch nach den Erdbeben bedarfsgerechte Hilfe schnell auf die Beine stellen konnten. Die Bundesregierung fördert zum Beispiel die Arbeit der Deutschen Welthungerhilfe für die Verteilung von Brot sowie von Malteser International für Zugang zu sauberem Wasser.
Konkret haben wir unsere humanitäre Hilfe für die Menschen in Syrien bereits um weitere 99 Millionen Euro aufgestockt. Die Mittel gehen u.a. an den Syria Cross-border Humanitarian Fund und an den Syria Humanitarian Fund. Die beiden Fonds werden von der VN-Organisation OCHA verwaltet. So können die Mittel rasch und bedarfsorientiert an internationale und syrische NGOs und auch an internationale Organisationen abfließen.
Deutschland ist als zweitgrößter Geber zudem finanziell an den VN-Hilfslieferungen beteiligt, die mittlerweile über drei Grenzübergänge aus der Türkei nach Nordwest-Syrien gehen.
Darüber hinaus beteiligt sich die Bundesregierung mit 1,5 Millionen Euro an einem EU-Transport von Hilfsgütern in die Region. Deutschland stellt 73 Tonnen bereit: Zelte, Heizgeräte, Betten & Generatoren. Auch diese Materialien werden mit Mitteln der internationalen Katastrophenhilfe des Auswärtigen Amts finanziert. Das THW übernimmt die Beschaffung und Bereitstellung in Deutschland, vor Ort ausgegeben werden die Hilfsgüter vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP).
An die humanitäre Hilfe anknüpfend leistet die GIZ in Nordwest-Syrien aus Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit strukturbildende Maßnahmen. Dies ermöglicht den Partnern, überwiegend syrischen NGOs, beispielweise den Betrieb von Krankenhäusern und Gesundheitsstationen aufrecht zu erhalten und Gesundheitspersonal weiterzubilden. Entwicklungsgelder der Bundesregierung in Höhe von 15 Millionen Euro tragen zur Rehabilitierung von durch das Erdbeben beschädigter öffentlicher Infrastruktur der Daseinsvorsorge in Nordwest-Syrien und anderer betroffener Regionen bei.
Aus dem Bereich Krisenprävention, Stabilisierung und Friedensförderung stellt die Bundesregierung zivilgesellschaftlichen Partnern 1,5 Millionen Euro für dringend benötigte Unterstützung zur Verfügung, darunter Wasserreinigungstabletten und Babyprodukte.
Weitere internationale Maßnahmen
Die Vereinten Nationen haben darüber hinaus bekanntgegeben, dass 50 Millionen US-Dollar aus dem zentralen Nothilfefonds CERF für Menschen in Syrien und der Türkei bereitgestellt werden. Deutschland ist für diesen Fonds der größte Geber.
Auch für das Deutsche Rote Kreuz wurden umgehend nach den Beben Mittel für Soforthilfemaßnahmen bewilligt. Über die Rot-Halbmond-Schwestergesellschaften werden in der Türkei 100 Tonnen Hilfsgüter (Nahrungsmittel, Decken) bereitgestellt, in Syrien geht es vor allem um Bereitstellung von Medikamenten, Nahrungsmitteln und finanzielle wie personelle Unterstützung bei Logistik und Koordinierung.
Darüber hinaus stellt der von Deutschland mitgegründete Syria Recovery Trust Fund fast 9 Millionen Euro für Zivilschutzhilfen und weitere Unterstützung bereit. Davon sind 1,9 Millionen Euro für die Syrischen Weißhelme vorgesehen. Deutschland ist für diesen Fonds der größte Geber.
Winter-Survival-Kurs in der Uckermark: Warum tut man sich das an?
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Die Kälte ist der Angstgegner: In einem Survivalcamp lernen die Teilnehmer, wie sie im Falle einer Katastrophe im Freien überleben. Warum tut man sich das an? ...
Antworten auf die häufigsten Fragen zu den Erdbeben in der Türkei und Syrien
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Ich erreiche meine deutschen Angehörigen in der Türkei nicht. An wen kann ich mich wenden? Was kann ich tun?
Prüfen Sie als Erstes, ob sich Ihre Angehörigen zuletzt in den von den Erdbeben betroffenen Gebieten aufgehalten haben. Besonders betroffen sind nach jetzigem Stand die Provinzen Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Malatya, Diyarbakir, Şanliurfa, Adiyaman, Kilis und Osmaniye.
Sollten sich Ihre Angehörigen zuletzt in den betroffenen Regionen aufgehalten haben, teilen Sie uns bitte über das Kontaktformular der Botschaft Ankara alle Informationen zu der vermissten Person mit, sodass wir mit den türkischen Behörden Kontakt aufnehmen können.
Dazu zählen zum Beispiel folgende Angaben: Wie heißen Ihre Angehörigen? Welche Staatsangehörigkeiten haben sie? Wann wurden die vermissten Personen geboren? Wo haben sie sich zum Zeitpunkt des Erdbebens aufgehalten?
Wir benötigen außerdem Ihre eigenen Kontaktdaten, um uns mit Ihnen (als der „als meldenden Kontaktperson“) in Verbindung setzen zu können.
Alternativ erreichen Sie unsere Botschaft auch telefonisch. Bitte halten Sie auch für den Anruf die oben erbetenen Informationen bereit.
Mein Pass ist in den Trümmern in der Türkei verloren. Ich möchte nach Deutschland zurück. Was kann ich tun?
Wenden Sie sich bitte direkt per Kontaktformular an die Deutsche Botschaft in Ankara. Geben Sie als Stichwort „Passbeantragung Erdbebenopfer“ an. Sofern Sie aufgrund des Erdbebens keine weiteren Unterlagen für die Identitätsprüfung mehr haben, bitten wir Sie, uns vorab folgende persönliche Daten über das Kontaktformular mitzuteilen:
Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Wohnort in Deutschland oder (falls kein Wohnort in Deutschland vorhanden) Behörde der letzten Passausstellung.
Geben Sie bitte ferner eine Mailadresse an, unter der wir Sie erreichen können. Die Botschaft nimmt dann so schnell wie möglich mit Ihnen Kontakt auf.
Ich bin deutsche/-r Staatsangehörige/-r und durch das Erdbeben in der Türkei jetzt obdachlos. An wen kann ich mich wenden?
Die Lage in den Erdbebengebieten entwickelt sich kontinuierlich fort. Verfolgen Sie bitte weiterhin aufmerksam die Reise- und Sicherheitshinweise und die Meldungen der deutschen Botschaft Ankara in den sozialen Medien. Für Hilfe vor Ort wenden Sie sich bitte zunächst an die Kräfte des türkischen Katastrophenschutzes und der weiteren Behörden vor Ort.
Ich möchte meine vom Erdbeben betroffenen Angehörigen nach Deutschland holen – welche Möglichkeiten gibt es?
Auch nach der furchtbaren Erdbeben-Katastrophe gilt grundsätzlich, dass türkische und syrische Staatsangehörige für eine Einreise nach Deutschland ein gültiges Visum benötigen.
Das Auswärtige Amt hat mit dem Bundesministerium des Innern und für Heimat ein vereinfachtes, pragmatisches Visumverfahren abgestimmt.
Das vereinfachte Verfahren richtet sich an türkische Staatsangehörige, auf die Folgendes zutrifft:
- Sie sind nachvollziehbar individuell vom Erdbeben besonders betroffen (es droht Obdachlosigkeit oder Sie haben behandlungsbedürftige Verletzungen)
- Sie sind Angehörige 1. oder 2. Grades (Ehepartner/-partnerin, Eltern, Kinder, Großeltern, Enkelkinder, Geschwister) von deutschen Staatsangehörigen oder von einer Person mit einem dauerhaften deutschen Aufenthaltstitel. (Das vereinfachte Verfahren umfasst auch für die Kernfamilienangehörigen (Ehepartner und minderjährige Kinder) der o.g. Angehörigen 1. oder 2. Grades.)
- Das Familienmitglied in Deutschland hat eine Verpflichtungserklärung nach §§ 66 bis 68 Aufenthaltsgesetz abgegeben. (Details zur Verpflichtungserklärung finden Sie auf unserer Webseite)
- Sie hatten zum Zeitpunkt des Erdbebens ihren Wohnsitz in einer der betroffenen Provinzen
Folgende Dokumente müssen vorgelegt werden:
- Antragsformular
- gültiger (auch vorläufiger) türkischer Pass (notwendig, um aus der Türkei ausreisen zu können)
- Krankenversicherung (Deckungssumme 30.000 Euro für Kranken- und Rückführungskosten im Schengenraum, Versicherung für den gesamten Reisezeitraum einschließlich An- und Abreisetag, direkte Zahlung der Versicherung an Ärzte/Krankenhaus, kann bei vielen Anbietern online abgeschlossen werden)
- Biometrisches Foto
- Verpflichtungserklärung eines Verwandten 1. oder 2. Grades im Original (muss vor der innerdeutschen Ausländerbehörde am Wohnsitz des Verwandten abgegeben werden)
- Kopie des Personalausweises oder Passes und ggf. des Aufenthaltstitels der einladenden Person
- Wohnsitznachweis mit Historie (Historie muss den Wohnsitz im Erdbebengebiet zum Zeitpunkt der Katastrophe belegen; "Tarihceli yerlesim yeri bilgileri raporu")
- Verwandtschaftsnachweis („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“ mit amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) und Barcode)
- Kurze, schriftliche Schilderung der Notlage
- Bei Minderjährigen: Unterschriften/notariell beglaubigte Zustimmung beider Eltern bzw. Nachweis der Alleinsorge oder der vorübergehenden Personensorge
Das Visum wird gebührenfrei erteilt. Das bei Antragstellung im Antragsannahmezentrum übliche Service-Entgelt (ca. 33 EUR) muss jedoch weiterhin an den externen Dienstleister gezahlt werden, da dieser auf Basis einer Dienstleistungskonzession arbeitet. Die Annahmezentren und auch die Erhöhung des Terminangebots können nur über dieses Service-Entgelt finanziert werden.
Voraussetzung für die Beantragung ist die Vorlage vollständiger Unterlagen und eines türkischen Reisepasses. Persönliche Vorsprache der Antragstellenden zwecks Antragsstellung kann mit vollständigen Unterlagen ohne vorherige Terminbuchung zu den Öffnungszeiten in den Antragsannahmezentren des externen Dienstleisters iDATA (nicht an den Auslandsvertretungen) erfolgen. Die Antragstellenden sind aufgefordert, im Visumsverfahren ihren bisherigen Wohnsitz im Erdbebengebiet nachzuweisen und nachvollziehbar geltend zu machen, dass sie vom Erdbeben individuell besonders betroffen sind.
Informationen zu den Voraussetzungen und vorzulegenden Unterlagen für die Visumbeantragung für besonders vom Erdbeben betroffene Personen in der Türkei sind auf der Webseite unserer Auslandsvertretungen in der Türkei auch auf Türkisch veröffentlicht.
Um auch Personen schnell helfen zu können, die in der Katastrophe ihre Reisedokumente verloren haben, stimmt sich das Auswärtige Amt mit türkischen Behörden ab. Die Kooperation türkischer Behörden ist für die Ausreise des genannten Personenkreises unerlässlich. Aktuell gibt es hier keine Sonderregelung.
Anfragen zu konkreten Visumsanträgen werden direkt von unseren Auslandsvertretungen (auf Türkisch) sowie im Call Centre des externen Dienstleisters iDATA beantwortet.
Für syrische Antragstellende, die von den Erdbeben in der Türkei und Syrien betroffen sind, konnten wir Erleichterungen für Visaverfahren zum Zwecke des Daueraufenthalts erreichen:
Die Botschaft Damaskus ist weiterhin geschlossen. Syrische Antragstellende können sich an die umliegenden deutschen Auslandsvertretungen (u.a. Botschaft Beirut, Botschaft Amman oder das Generalkonsulat Istanbul) wenden. An den Visastellen in Istanbul und Beirut, die einen Großteil der Anträge von syrischen Staatsangehörigen bearbeiten, werden die Termine für den Familiennachzug zu subsidiär schutzberechtigten syrischen Staatsangehörigen aufgestockt. Auch beim Ehegattennachzug, Kindernachzug und Elternnachzug zum minderjährigen Kind werden nun mehr Termine vergeben. Antragstellende aus den von den Erdbeben betroffenen Regionen werden insbesondere bei der Vergabe dieser Termine bevorzugt.
Außerdem kann etwa beim Ehegattennachzug von durch die Erdbeben betroffenen syrischen Antragstellenden auf den gesetzlich erforderlichen Nachweis einfacher Kenntnisse der deutschen Sprache verzichtet werden, wenn die Vorlage im Einzelfall unmöglich oder unzumutbar ist. Unsere Visastellen werden hier pragmatisch vorgehen und die aktuellen Umstände besonders berücksichtigen.
Das Bundesinnenministerium hat die Bundesländer auf die Möglichkeit hingewiesen, eine Globalzustimmung auszusprechen und damit dem Beispiel Berlins zu folgen. Das würde dazu führen, dass eine Beteiligung der Ausländerbehörde in Deutschland in bestimmten Familiennachzugskonstellation nicht erforderlich ist und so das Verfahren deutlich beschleunigt werden kann.
Was bedeutet die Visumsverfahrensvereinfachung, die der Berliner Senat beschlossen hat?
Die vom Berliner Senat beschlossene „Globalzustimmung“ für Visumanträge türkischer und syrischer Staatsangehöriger hat nur für einen ganz konkreten Personenkreis direkte Auswirkungen. In den allermeisten Fällen hat die Entscheidung des Berliner Senats vom 10.02. keine Auswirkung.
Im Einzelfall kann sich die Bearbeitungsdauer für den Visumantrag verkürzen, wenn auf Sie alle folgenden Punkte zutreffen:
- Sie möchten zu Ihrem Ehepartner oder ihrem minderjährigen Kind nach Deutschland ziehen.
- Ihr Ehepartner/Ihr minderjähriges Kind lebt bereits länger in Berlin und ist dort angemeldet.
- Ihr Ehepartner/Ihr minderjähriges Kind ist deutsche/r Staatsangehörige/r oder hat eine Niederlassungserlaubnis bzw. eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU
- Sie hatten zum Zeitpunkt der Erdbebenkatastrophe Ihren Aufenthalt nachweislich (zum Beispiel durch eine bereits vorhandene Terminregistrierung) in einer der folgenden Regionen: Türkei - Kahramanmaras, Gaziantep, Hatay, Adana, Malatya, Diyarbakir, Sanliurfa, Adiyaman, Kilis, Osmaniye; Syrien – Idlib, Aleppo, Latakia, Hama, Tartus.
Nur wenn alle diese Kriterien erfüllt sind, muss das Landesamt für Einwanderung in Berlin im Visumverfahren nicht mehr beteiligt werden und Antragsteller müssen keinen Nachweis über einfache deutsche Sprachkenntnisse vorlegen.
Meine Familie hat bereits einen Antrag auf Familienzusammenführung bei der Botschaft Ankara gestellt/ sich für einen Termin zur Beantragung der Familienzusammenführung registriert und ist nun vom Erdbeben betroffen. Wie kann ich das Verfahren beschleunigen?
Beim Familiennachzug müssen unsere Visastellen die innerdeutschen Ausländerbehörden am Wohnort des Familienmitglieds, zu dem der Antragstellende ziehen möchte, beteiligen. Bisher hat nur der Berliner Senat eine Sonderregelung für vom Erdbeben betroffene Familien verabschiedet, nach der das Landesamt für Einwanderung bei einem Nachzug nach Berlin nicht mehr beteiligt werden muss.
Wenn Sie in einem anderen Bundesland als Berlin wohnen und Ihre Angehörigen im Rahmen der Familienzusammenführung zu Ihnen ziehen wollen, müssen unsere Auslandsvertretungen daher weiter die Ausländerbehörde an Ihrem Wohnort beteiligen und können deren Bearbeitungszeit nicht beeinflussen.
Nach derzeitigem Stand ist ein Versand von Reisepässen nach Abschluss der Antragsverfahrens in die von den Erdbeben betroffenen Gebiete nicht möglich. Ihre Angehörigen sollten daher der Auslandsvertretung eine Adresse mitteilen, an die die Pässe stattdessen zuverlässig geschickt werden sollen.
In Fällen, in denen Familien bisher noch keinen Antrag gestellt, aber schon einen Termin bei iData gebucht haben, versuchen die Auslandsvertretungen, den bereits auf der Warteliste stehenden Personen aus den betroffenen Gebieten der Reihe nach vorgezogene Termine anzubieten. Durch Sie oder Ihre Familie ist hierfür nichts zu veranlassen. Prüfen Sie lediglich regelmäßig Ihren Emaileingang. Wenn Ihr Termin vorgezogen wird, erhalten Sie proaktiv eine Terminbestätigung per Mail.
Ich möchte spenden. Wo kann ich das?
Verschiedene etablierte Hilfsorganisationen rufen zu Spenden auf. Z.B. ‚Aktion Deutschland hilft' , Ärzte der Welt e.V., , DRK e.V. , Franziskaner Helfen , Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. , Humedica , Save the Children e.V. , UNICEF , UNO-Flüchtlingshilfe e.V.
Ich habe Sachspenden gesammelt. An wen kann ich die Sachspenden übermitteln? Übernimmt die Bundesregierung die Transportkosten/die Logistik?
Die Bereitstellung von Hilfsgütern kann am besten durch Hilfsorganisationen, die bereits in der Erdbebenregion aktiv sind, koordiniert werden. Die Bundesregierung empfiehlt daher nachdrücklich von spontanen, nicht bedarfsgerechten Sachspenden abzusehen und in der aktuellen Situation Geldmittel an etablierte Hilfsorganisationen zu spenden. In der Regel ist es einfacher, benötigte Hilfsgüter vor Ort zu kaufen und dort zielgenau an Betroffene zu verteilen. Sachspenden müssen über weite Strecken zu Empfängern transportiert werden, was eine längere Zeit in Anspruch nimmt und oft mit höheren Kosten einhergeht als eine Beschaffung von Hilfsgütern vor Ort. Der Katastrophenschutzmechanismus der Europäischen Union (UCPM), die Vereinten Nationen, die Rotkreuz-/Rothalbmondbewegung, etablierte Hilfsorganisationen und die Behörden versuchen im direkten Kontakt mit Organisationen und betroffenen Menschen im Erdbebengebiet den Bedarf zu erheben, zu priorisieren und Unterstützung zu koordinieren.
In einigen Kommunen nehmen Kirchen, Hilfsorganisationen und Vereine Sachspenden entgegen. Wer spenden möchte, sollte sich also am besten in ihrer/ seiner Stadt oder Gemeinde informieren, wo Spendenaktionen stattfinden und - ganz wichtig - was genau gebraucht wird, da viele Hilfsgüter auch vor Ort noch beschafft werden können.
Gut gemeinte, aber kleinteilige Hilfsangebote erhöhen den Druck auf die Koordinierungs- und Logistikmechanismen. Leider stehen - auch auf Grund der Vielzahl der Anfragen bzw. Angebote – keine Kapazitäten zur Verfügung, um einzelne Transporte zu koordinieren bzw. zu übernehmen. Auch stehen dem Auswärtigen Amt keine Mittel zur Verfügung, um Zuschüsse zu Transportkosten anzubieten.
Ich möchte einen Hilfstransport organisieren. Was ist zu beachten? An wen kann ich mich wenden?
Zivilgesellschaftliche Organisationen, die Hilfe anbieten wollen, können sich an die türkische Botschaft in Berlin wenden (botschaft.berlin@mfa.gov.tr).
Mein Unternehmen möchte einen Hilfstransport/ eine große Sachspende organisieren. Was ist zu beachten?
Groß- und Unternehmensspenden können in der Regel über die etablierten Hilfsorganisationen in deren bestehende und gut eingespielten Mechanismen integriert werden, insbesondere im medizinischen Bereich.
Ich möchte selbst in das Erdbebengebiet fahren und vor Ort helfen. Was muss ich beachten?
Es besteht weiterhin jederzeit die Gefahr durch Nachbeben. Ohne spezielles Training sind Laien für Bergungsarbeiten nicht ausreichend qualifiziert. Im schlimmsten Fall könnten freiwillige Helferinnen und Helfer sich und andere in Gefahr bringen oder aktuelle Rettungs- und Bergungsmaßnahmen behindern.
Weiterhin gibt es schwere Schäden an der lokalen Infrastruktur, die auch die Anreise von ausländischen Rettungskräften aktuell erschweren. Private Anreisen erhöhen daher den Druck auf die Infrastruktur und behindern ggf. dringend benötigte Rettungsmaßnahmen.
Falls Sie sich dennoch dazu entschließen, beachten Sie bitte die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes für die Türkei (für Syrien gilt unabhängig von den Erdbeben eine Reisewarnung) . Wichtig ist dann auch, dass die Organisatoren solcher Transporte sich vorher mit Helfenden/Behörden/Organisationen vor Ort absprechen. Was genau wird gebraucht? Wann und wo sollte die Übergabe stattfinden? Nur wenn diese Fragen abgeklärt und koordiniert werden, ist eine zielgenaue Hilfe möglich.
Was tut Deutschland, um die Menschen in der Türkei und in Syrien zu unterstützen?
Aktuelle Informationen über die deutsche Hilfe in der vom Erdbeben betroffenen Region in der Türkei und in Syrien finden Sie in diesem Artikel.
Zwischen Chancen und Herausforderungen: Außenministerin Annalena Baerbock reist in den Irak
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Außenministerin Annalena Baerbock wird vom 7. bis zum 10. März zum ersten Mal in den Irak reisen. Seit vielen Jahren ist Deutschland engagiert, die Stabilisierungserfolge des Irak zu unterstützen. Aber der Einfluss des großen Nachbarstaats Iran, militärische Interventionen der Türkei in der Region Kurdistan-Irak und der voranschreitende Klimawandel zerren an der Stabilität des Landes. Wenn Irak aber - mit all seinen unterschiedlichen Ethnien, religiösen Gruppierungen und Minderheiten – zeigen kann, dass ein friedliches Zusammenleben möglich ist, dann wird er zum Vorbild für eine ganze Region.
Ich will gegenüber den irakischen Partnerinnen und Partnern unterstreichen, dass Deutschland nicht nur an eine starke, friedliche Zukunftsperspektive für Irak glaubt, sondern sich dafür auch weiter engagiert.
- Außenministerin Annalena Baerbock
 Seit rund drei Monaten hat Irak eine neue Regierung. In Bagdad wird Außenministerin Baerbock Gespräche mit dem irakischen Premier- und Außenminister über die Zusammenarbeit und deutsche Unterstützung für die Stabilitätsbemühungen Iraks führen. Das deutsche militärische Engagement im Rahmen der internationalen Anti-IS-Koalition und der NATO Mission Irak bleibt dabei von großer Bedeutung. Seit 2015 beteiligt sich die deutsche Bundeswehr mit 77 Partnern am internationalen Anti-IS-Einsatz, seit 2020 an der NATO-Mission Irak. Unter anderem werden irakische Streit- und Sicherheitskräfte befähigt, die Stabilität des Landes eigenständig zu sichern. Annalena Baerbock wird Vertreter der VN-Unterstützungsmission UNAMI, der Operation Inherent Resolve, sowie auch der NATO Mission Irak samt Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr treffen.
Seit rund drei Monaten hat Irak eine neue Regierung. In Bagdad wird Außenministerin Baerbock Gespräche mit dem irakischen Premier- und Außenminister über die Zusammenarbeit und deutsche Unterstützung für die Stabilitätsbemühungen Iraks führen. Das deutsche militärische Engagement im Rahmen der internationalen Anti-IS-Koalition und der NATO Mission Irak bleibt dabei von großer Bedeutung. Seit 2015 beteiligt sich die deutsche Bundeswehr mit 77 Partnern am internationalen Anti-IS-Einsatz, seit 2020 an der NATO-Mission Irak. Unter anderem werden irakische Streit- und Sicherheitskräfte befähigt, die Stabilität des Landes eigenständig zu sichern. Annalena Baerbock wird Vertreter der VN-Unterstützungsmission UNAMI, der Operation Inherent Resolve, sowie auch der NATO Mission Irak samt Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr treffen.
 Zur dauerhaften und nachhaltigen Sicherung der Stabilität gehört die Bewältigung der Folgen des Völkermords an den Jesidinnen und Jesiden durch den sogenannten IS. In Erbil wird Außenministerin Baerbock mit Vertretern der Regionalregierung Kurdistan-Irak auch darüber sprechen, Perspektiven für die Überlebenden zu schaffen. In der Region haben hunderttausende Binnenvertriebene Zuflucht gefunden, die der Terrorherrschaft des IS entkommen konnten. Die deutsche Bundesregierung unterstützt den irakischen Staat dabei, Jesidinnen und Jesiden eine Rückkehr in ihre Heimatorte zu ermöglichen. Unter anderem wurde dafür der von Deutschland initiierte Fonds für Irak (FFS) geschaffen sowie auch ein Kredit über 500 Millionen Euro der Bundesregierung. Mit dem Geld werden in Sinjar z.B. die Stromversorgung und Straßen repariert, Abwasserkanäle, Schulen und Kindergärten wiederaufgebaut. Bei der Planung und Umsetzung dieser Projekte werden auch irakische staatliche Akteure auf der Provinzebene mit einbezogen.
Zur dauerhaften und nachhaltigen Sicherung der Stabilität gehört die Bewältigung der Folgen des Völkermords an den Jesidinnen und Jesiden durch den sogenannten IS. In Erbil wird Außenministerin Baerbock mit Vertretern der Regionalregierung Kurdistan-Irak auch darüber sprechen, Perspektiven für die Überlebenden zu schaffen. In der Region haben hunderttausende Binnenvertriebene Zuflucht gefunden, die der Terrorherrschaft des IS entkommen konnten. Die deutsche Bundesregierung unterstützt den irakischen Staat dabei, Jesidinnen und Jesiden eine Rückkehr in ihre Heimatorte zu ermöglichen. Unter anderem wurde dafür der von Deutschland initiierte Fonds für Irak (FFS) geschaffen sowie auch ein Kredit über 500 Millionen Euro der Bundesregierung. Mit dem Geld werden in Sinjar z.B. die Stromversorgung und Straßen repariert, Abwasserkanäle, Schulen und Kindergärten wiederaufgebaut. Bei der Planung und Umsetzung dieser Projekte werden auch irakische staatliche Akteure auf der Provinzebene mit einbezogen.
Das Trauma dieses Völkermordes steckt nach wie vor tief in den Menschen- das wurde nicht zuletzt in der Pandemie deutlich, als es in den Lagern unter Frauen zu vielen Selbstmorden kam. Die Überlebenden nicht allein zu lassen ist uns Verpflichtung und Verantwortung.
- Außenministerin Annalena Baerbock
Die Großstadt Dohuk ist in den letzten Jahren Heimat für viele Vertriebene und Geflüchtete geworden, sowohl aus Irak wie auch aus Syrien. Hier wird Annalena Baerbock in einem Flüchtlingslager für Binnenvertriebene Gespräche mit Überlebenden führen.
 Die traditionelle Heimat vieler Jesidinnen und Jesiden ist hingegen der Distrikt Sinjar. In Kocho, einem jesidischen Dorf, begann am 3. August 2014 der Völkermord des sogenannten IS an der jesidischen Gemeinschaft. Viele der Überlebenden aus Kocho, darunter auch Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad, sind über das Landesaufnahmeprogramm Baden-Württemberg nach Deutschland gekommen. Annalena Baerbock wird das Dorf, das heute ein Gedenkort ist, und ein Traumazentrum besuchen. Im Dokumentationszentrum des Untersuchungsteams der Vereinten Nationen, UNITAD, werden die Taten zu Fallakten für internationale Gerichte aufbereitet, hier wird die Straflosigkeit der Täter bekämpft. Deutschland unterstützt die juristische Aufarbeitung der IS-Verbrechen. Rechenschaft ist eine Grundvoraussetzung für Gerechtigkeit und einen nachhaltigen Frieden in der Heimatregion der jesidischen Gemeinschaft.
Die traditionelle Heimat vieler Jesidinnen und Jesiden ist hingegen der Distrikt Sinjar. In Kocho, einem jesidischen Dorf, begann am 3. August 2014 der Völkermord des sogenannten IS an der jesidischen Gemeinschaft. Viele der Überlebenden aus Kocho, darunter auch Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad, sind über das Landesaufnahmeprogramm Baden-Württemberg nach Deutschland gekommen. Annalena Baerbock wird das Dorf, das heute ein Gedenkort ist, und ein Traumazentrum besuchen. Im Dokumentationszentrum des Untersuchungsteams der Vereinten Nationen, UNITAD, werden die Taten zu Fallakten für internationale Gerichte aufbereitet, hier wird die Straflosigkeit der Täter bekämpft. Deutschland unterstützt die juristische Aufarbeitung der IS-Verbrechen. Rechenschaft ist eine Grundvoraussetzung für Gerechtigkeit und einen nachhaltigen Frieden in der Heimatregion der jesidischen Gemeinschaft.
Der Irak gehört zu den fünf am stärksten vom Klimawandel betroffenen Ländern der Welt und ist als relevanter Emittent von Treibhausgas Verursacher und zunehmend Opfer zugleich. Sinnbild der Austrocknung und Versalzung ganzer Landstriche sind die Marschen in der Nähe von Basra, im Süden des Irak, die Außenministerin Baerbock besucht. Von vielen mit dem biblischen Garten Eden identifiziert, schrumpft das Jahrtausende alte Sumpfgebiet von Euphrat und Tigris immer weiter. Und so droht nicht nur das UNESCO-Weltkulturerbe der Marschen, sondern auch die Lebensgrundlage der dort ansässigen Menschen auszutrocknen.
Außenministerin Baerbock reist zum G20-Treffen nach New Delhi
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

 Erstmalig hat Indien in diesem Jahr den G20-Vorsitz übernommen. Daher treffen sich die Außenministerinnen und Außenminister der G20-Staaten vom 1.-2. März in der indischen Hauptstadt New Delhi. Bei dem Treffen geht es um die wichtigsten globalen Herausforderungen unserer Zeit wie die Eindämmung des Klimawandels oder die globale Hunger- und Schuldenkrise.
Erstmalig hat Indien in diesem Jahr den G20-Vorsitz übernommen. Daher treffen sich die Außenministerinnen und Außenminister der G20-Staaten vom 1.-2. März in der indischen Hauptstadt New Delhi. Bei dem Treffen geht es um die wichtigsten globalen Herausforderungen unserer Zeit wie die Eindämmung des Klimawandels oder die globale Hunger- und Schuldenkrise.
Im Mittelpunkt der Gespräche stehen dabei auch die globalen Auswirkungen von Russlands Angriffskriegs gegen die Ukraine, welcher die weltweite Nahrungsmittelknappheit und Energieunsicherheit eklatant verschärft hat. Bei dem Treffen der G20 Außenministerinnen und Außenminister geht es daher auch darum, eine klare Haltung zum russischen Angriffskrieg, wie zuletzt beim G20-Gipfel in Bali, herbeizuführen.
Vor ihrer Abreise nach Neu-Delhi sagte Außenministerin Baerbock:
Die G20 wurden geschaffen, um der Welt Hoffnung auf die Lösung unserer drängendsten Probleme zu geben. Deshalb reise ich nach Delhi, um Deutschlands Prioritäten einzubringen: Wir arbeiten an Lösungen für die Schuldenkrise, denn viel zu viele Länder drohen unter enormen Schuldenlasten zusammenzubrechen. Wir mobilisieren all unsere Kräfte im weltweiten Kampf gegen Hunger, z. B. in Ostafrika, wo sich Millionen jeden Tag fragen, was sie ihren Kindern heute zu essen geben. Und wir setzen uns für eine neue internationale Finanzarchitektur ein, weil der Klimawandel Naturkatastrophen immer schlimmer und teurer macht.
Die G20: Ein wichtiges Forum
Die G20 vereinen mehr als 80% des globalen Bruttoinlandsprodukts, etwa drei Viertel des Welthandels und ungefähr zwei Drittel der Weltbevölkerung. Neben den 19 größten Industrie- und Schwellenländer sitzt auch die EU mit am Tisch.
Aufgrund ihres Gewichts und ihrer strategischen Bedeutung spielen die G20 eine bedeutsame Rolle, wenn es darum geht, die Weichen für zukünftige geopolitische Entscheidungen und globale Wirtschaftsfragen zu stellen. Deswegen bieten die G20 ein wichtiges Forum, um multilaterale Lösungen für drängende Probleme wie die globale Ernährungs- oder die Klimakrise anzugehen, ohne jedoch wichtige außenpolitische Fragen außer Acht zu lassen.
Vor dem G20-Treffen betone Außenministerin Baerbock daher auch:
Diesen großen globalen Herausforderungen müssen wir unsere ganze Kraft widmen. Dazu gehört auch, dass wir dem zynischen Spiel Russlands entgegentreten, das versucht einen Keil in die Weltgemeinschaft zu treiben. Es sind Russlands Raketen auf die unschuldigen Menschen in der Ukraine, die auch die Nahrungs- und Energiesicherheit vieler hundert Millionen Menschen weltweit treffen.
Indiens G20-Präsidentschaft
Unter dem Motto „Eine Erde, eine Familie, eine Zukunft" legt Indien den Schwerpunkt seiner G20-Präsidentschaft auf nachhaltiges Wachstum und rückt Klima- und Umweltfragen in den Fokus. Gleichzeitig will Indien den Staaten des sogenannten globalen Südens und deren Anliegen eine stärkere Stimme bei den G20-Beratungen verleihen. Mit Übernahme des G20-Vorsitzes zeigt Indien seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen für die dringendsten Aufgaben unserer Zeit.
Bali nach der Corona-Pandemie: Wie die Schließung die Inselbewohner arm gemacht hat
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Seit einem Jahr ist der Sehnsuchtsort für Surfer und Backpacker wieder für Touristen geöffnet. Doch während Bali abgeriegelt war, wurden viele Inselbewohner arbeitslos. Besuch in einem Paradies, das sich verändert hat...
Ukraine, Afghanistan, Iran – Außenministerin Baerbock bei EU-Außenrat in Brüssel
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Der Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24.02.2022 jährt sich diese Woche zum ersten Mal. Einen Schwerpunkt der Beratungen wird daher die weitere Unterstützung der Ukraine bei ihrem Freiheitskampf bilden.
Parallel bereitet die EU das nächste, bereits zehnte, Sanktionspaket gegen Russland vor, welches zeitnah beschlossen werden soll. Damit erhöht die EU weiter den Druck auf Russland und die russische Führung, den illegalen Angriff gegen die Ukraine beenden.
Verheerende Lage für Frauen- und Mädchenrechte in Afghanistan
Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 hat sich die Lebenswirklichkeit für Frauen und Mädchen in Afghanistan immer weiter verschlechtert. Sie wurden Schritt für Schritt aus der Öffentlichkeit, den Schulen und Universitäten und dem Berufsleben verbannt und zunehmend an ihr Zuhause gefesselt. Die Außenministerinnen und Außenminister werden sich auf deutsche Initiative mit der verheerenden Menschenrechtslage in Afghanistan befassen und gemeinsame Schritte erörtern. Dabei wird auch die Frage der weiteren humanitären Hilfe für Afghanistan eine Rolle spielen.
5. Sanktionspaket gegen Iran
Dem iranischen Regime ist es trotz brutaler Einschüchterungsversuche nicht gelungen, den Traum der Menschen in Iran von Freiheit und Selbstbestimmung zu ersticken. Die 27 Außenministerinnen und Außenminister werden daher erneut über die Lage in Iran beraten und ein fünftes Sanktionspaket annehmen, dessen Vorbereitung die Bundesregierung im EU-Kreis vorangebracht hat. Mit den neuen Listungen im Rahmen des bestehenden EU-Menschenrechts-Sanktionsregimes zielt die EU insbesondere auf Teile des Justiz- und Sicherheitsbereich, der nach der Niederschlagung der großen Straßenproteste für weitere Menschrechtsverletzungen verantwortlich ist.
Weitere Themen: Klima, die Situation in den Erdbebengebieten und Moldau
Die Bekämpfung der Klimakrise bleibt trotz aller Krisen die zentrale Aufgabe des 21. Jahrhunderts. Deutschland und Dänemark haben vergangenen Herbst eine Freundesgruppe an EU-Staaten ins Leben gerufen, die sich für eine ambitionierte EU-Klimaaußenpolitik einsetzen. Auf ihre Initiative werden sich die Außenministerinnen und Außenminister über die notwendigen Anstrengungen austauschen und den Blick dabei auch bereits auf die Ende des Jahres in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinde 28. Weltklimakonferenz (COP) richten, bei der die EU als Verhandlungsführerin für die Mitgliedsstaaten auftritt.
Die humanitäre Situation in den Erdbebengebieten in der Türkei und Syrien ist auch zwei Wochen nach dem verheerenden Erdbeben schwierig. Die EU-Außenministerinnen und -Außenminister werden sich über den Stand der umfangreichen, von der EU koordinierten Hilfsleistungen beraten.
Bereits am Mittag ist der moldauische Außenminister Popescu auf Einladung von Josep Borrell zum informellen Arbeitsmittagessen zu Gast. Dabei wird es insbesondere um die weitere Unterstützung der Republik Moldau im EU-Beitrittsprozess gehen.
Der „Rat für Auswärtige Angelegenheiten" (RfAB) ist zuständig für das außenpolitische Handeln der EU, was die Bereiche der Außen‑, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, den Handel, die Entwicklungszusammenarbeit und die humanitäre Hilfe umfasst. Er hat vor allem die Aufgabe, gemeinsam mit der Europäischen Kommission und unter Einbindung des Hohen Vertreters der EU für Außen- und Sicherheitspolitik ein einheitliches und koordiniertes außenpolitisches Handeln der EU sicherzustellen. Der RfAB tagt in der Regel einmal im Monat.
Münchner Sicherheitskonferenz: Diplomatie der kurzen Wege
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Mit über 850 Teilnehmenden, ungefähr 40 Staats- und Regierungschefs, um die 50 Außenministerinnen und Außenminister und 25 Verteidigungsministerinnen und Verteidigungsminister sowie Vertreterinnen und Vertreter von Think-Tanks, NGOs und Unternehmen ist die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) eines der wichtigsten Treffen der sicherheitspolitischen Community weltweit. Jedes Jahr diskutieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Hotel Bayerischer Hof über zentrale Herausforderungen für die globale Sicherheit.
Die Konferenz fand erstmals 1963 statt. In den ersten Jahrzehnten nannte sich die MSC noch „Wehrkundetagung“. Damals war die Gruppe der Teilnehmer recht klein, nur rund ein paar Dutzend. Obwohl die Tagung schon damals als internationale Konferenz geplant war, ging es vor allem darum, den deutschen Teilnehmern eine Gelegenheit zu geben, ihre Kollegen aus den USA und aus anderen NATO-Staaten zu treffen. Im Laufe der Jahre weitete sich der Kreis immer weiter aus. Zwar finden sich in den Fluren weiterhin viele Generäle, jetzt aber auch CEOs, Menschenrechtlerinnen, Umweltschützer und andere Führungspersönlichkeiten aus der ganzen Welt.
Von Termin zu Termin: Übersicht über das Programm
 Neben einigen öffentlichkeitswirksamen Terminen wie Panels und Diskussionsrunden, ist die MSC vor allem ein Speeddating der Diplomatie. Kaum irgendwo anders bietet sich die Gelegenheit mit so vielen Amtskolleginnen und -kollegen in kurzer Abfolge ins Gespräch zu kommen. Im Zentrum der Gespräche werden der russische Angriffskrieg und seine dramatischen Auswirkungen weltweit stehen, aber es wird auch um die Lage im Iran und im Nahen und Mittleren Osten sowie um China, den Westbalkan und den internationalen Kampf gegen die Klimakrise gehen.
Neben einigen öffentlichkeitswirksamen Terminen wie Panels und Diskussionsrunden, ist die MSC vor allem ein Speeddating der Diplomatie. Kaum irgendwo anders bietet sich die Gelegenheit mit so vielen Amtskolleginnen und -kollegen in kurzer Abfolge ins Gespräch zu kommen. Im Zentrum der Gespräche werden der russische Angriffskrieg und seine dramatischen Auswirkungen weltweit stehen, aber es wird auch um die Lage im Iran und im Nahen und Mittleren Osten sowie um China, den Westbalkan und den internationalen Kampf gegen die Klimakrise gehen.
Zu den Terminen von Außenministerin Baerbock zählt auch eine Panel-Veranstaltung zusammen mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Dymtro Kuleba und US-Außenminister Antony Blinken zum Thema „Whole, Free, and at Peace: Visions for Ukraine“. Dabei wird es v. a. darum gehen, was die Ukraine für eine gute Zukunft braucht, gerade auch mit Blick auf eine Zeit nach dem Krieg. Auch ein Treffen der G7-Außenministerinnen und Außenminister findet am Rande der MSC statt, das erste physische Treffen auf Einladung Japans, das den Vorsitz im Jahr 2023 inne hat.
Die MSC steht schon immer gerade für die transatlantische Zusammenarbeit. Außenministerin Baerbock wird sich mit der großen US-Kongressdelegation austauschen. Die Teilnahme von parteiübergreifenden US-Kongressdelegationen ist langjährige Tradition. Hinzu kommen zahlreiche weitere Veranstaltungen wie bspw. eine Diskussionsrunde von „Frauen100“ und CFFP (Centre for Feminist Foreign Policy) zur feministischen Außenpolitik und ein Treffen einer großen Gruppe von Außenministerinnen auf Einladung der kanadischen Außenministerin Mélanie Joly.
Außenministerin Baerbock wird auch an einer Diskussionsrunde zum Thema „Klima, Schulden, Sicherheit“ teilnehmen und gemeinsam mit der Premierministerin von Barbados, Mia Mottley, der geschäftsführenden Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgiewa, und dem Präsidenten der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, diskutieren.
Leitmotiv der MSC 2023: „Re:vision“
„Re:vision“ ist das Motto der Münchner Sicherheitskonferenz 2023. Dahinter verbirgt sich für die Autorinnen und Autoren des gleichnamigen Berichts die Frage, auf welche Art und Weise autoritär geführte Staaten immer mehr die seit Jahrzehnten gewachsene internationale Ordnung infrage stellen und wie es gelingen kann, die Koalition der Staaten zu vergrößern, die bereit ist, liberale, regelbasierte Ordnung zu verteidigen. Diese Leitfrage wird in zahlreichen Diskussionsrunde immer wieder aufgegriffen.
Streiks an Flughäfen: Entschädigung, umbuchen und wie Sie trotzdem ans Ziel kommen
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Tausende Flüge sind bereits gestrichen: Der für Freitag angekündigte Warnstreik durchkreuzt viele Reisepläne. Wie Sie trotzdem an Ihr Ziel kommen, welche Leistungen Ihnen zustehen und wann eine Entschädigung fällig wird...
Luxushotel auf Bali: In diesem Flugzeug sollen bald Gäste übernachten
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Im April soll auf Bali in einer ausgemusterten Boeing eine Luxusvilla eröffnet werden – für knapp 7000 Euro die Nacht. Doch noch ist der Traum eine Großbaustelle. Und der Eigentümer über den Wolken...
Nachhaltig reisen: TUI gibt sich Reduktionsziele für Flüge, Hotels und Schiffe
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Die Emissionen bei den TUI-Airlines sollen bis 2030 um 24 Prozent sinken, die der Hotels um 46 Prozent – verglichen mit den Werten von 2019. Dazu kündigt TUI verschiedene konkrete Maßnahmen an...
Sony World Photography Awards 2023: Stadt, Land, Flossen
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Mit insgesamt sechs Flossen gleiten Schnorchlerin und Schildkröte sanft durchs Südchinesische Meer. Es ist nur eine von vielen Momentaufnahmen aus aller Welt, die eine Jury jetzt ausgezeichnet hat...
Allein reisen als Frau - Margot Flügel-Anhalt: "Mir ist schon alles passiert"
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Angefangen hat sie ganz klein: zu Fuß von Eisenach nach Hause. Inzwischen fährt Margot Flügel-Anhalt, 69, mit dem Lada zum Himalaja und mit dem Motorrad durch Iran. Was lernt sie allein unterwegs über sich selbst? ...
Hongkong verschenkt nach massivem Einbruch der Besucherzahlen 500.000 Flugtickets
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Reisende stehen in den Startlöchern für neue Abenteuer – und Urlaubsorte weltweit buhlen um sie. Hongkong will sie mit Gratisflügen im Wert von insgesamt umgerechnet etwa 230 Millionen Euro anlocken...
Eröffnung des regionalen Deutschlandzentrums für das französischsprachige Afrika
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt
 Mit der Eröffnung des regionalen Deutschlandzentrums in Dakar vertieft Deutschland seine Kommunikation mit den Menschen des französischsprachigen Afrikas. Künftig werden diese aus Dakar über Twitter und Facebook auf Französisch mit den neuesten Informationen über Deutschland und seine Außenpolitik versorgt.
Mit der Eröffnung des regionalen Deutschlandzentrums in Dakar vertieft Deutschland seine Kommunikation mit den Menschen des französischsprachigen Afrikas. Künftig werden diese aus Dakar über Twitter und Facebook auf Französisch mit den neuesten Informationen über Deutschland und seine Außenpolitik versorgt.
Außenpolitische Kommunikation über Regionale Deutschlandzentren…
Regionale Deutschlandzentren informieren für die deutsche Außenpolitik wichtige Weltregionen aktuell und faktenbasiert über Deutschland und seine Außenpolitik. Außerdem unterstützen sie deutsche Botschaften und Konsulate in der Region mit Kommunikationsmaterialien, die auf die dortige Sprache, Kultur und Debatten angepasst sind. So leisten sie auch einen Beitrag gegen Desinformation und verstärken den regionalen Dialog.
Die regionalen Deutschlandzentren teilen sich auf verschiedene Sprach- und Kulturräume auf. Knapp drei Millionen Menschen folgen den bisher vier, nun fünf, Regionalen Deutschlandzentren in den sozialen Medien.
Das neue Regionale Deutschlandzentrum für das französischsprachige Afrika kommuniziert von Dakar aus. Das Zentrum in Pretoria konzentriert sich auf das englischsprachige Afrika, Die Kommunikation für das spanischsprachige Lateinamerika wird in Mexiko koordiniert. In Kairo hat das Kommunikationszentrum für den arabischsprachigen Raum seinen Sitz und das Regionale Deutschlandzentrum Südostasien legt von Singapur aus einen Schwerpunkt auf die ASEAN-Staaten.
… und anhand thematischer Schwerpunkte
Im Fokus der Arbeit der regionalen Deutschlandzentren stehen Multiplikatoren und Multiplikatorinnen, Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Think-Tanks sowie Medien. Ihnen werden aktuelle Informationen über politische, wirtschaftliche Entwicklungen in Deutschland zur Verfügung gestellt. Zudem werden regelmäßig Themenschwerpunkte gesetzt, um eine vertiefte Kommunikation zu Themen zu ermöglichen, die für Deutschland bzw. die deutsche Außenpolitik eine besondere Rolle spielen - sei es Fragen des Klimawandels oder der Gleichberechtigung, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und dessen globalen Auswirkungen, oder auch das Eintreten für eine friedliche, multilaterale und wertebasierte Weltordnung.
Geheimdiplomatie? Nein, Strategische Kommunikation!
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Die deutsche Außenpolitik steht vor vielfältigen Herausforderungen – ob es die gestiegenen internationalen Erwartungen an Deutschland sind oder der Versuch unterschiedlicher Akteure, der Demokratie zu schaden, zum Beispiel durch die absichtliche Verbreitung falscher Informationen. In diesem Umfeld ist es wichtiger denn je, dass die Bundesregierung ihre Beweggründe, Ziele und Handlungen erklärt und so den außenpolitischen Kurs insgesamt verständlich darstellt.
Mittel- und langfristige Kommunikation
Das Auswärtige Amt setzt daher intensiv auf strategische Kommunikation und ergänzt seit Mitte 2016 die tagesaktuelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit um mittel- bis langfristige Kommunikation im In- und Ausland. Es geht darum, verlässliche Informationen zielgruppengerecht und nachhaltig zu erklären und zu vermitteln, um sowohl im digitalen Raum, aber auch in direktem Kontakt mit Menschen im In- und Ausland Werte und Interessen der deutschen Außenpolitik sichtbar und Positionen verständlich zu machen.
Auch der aktuelle Koalitionsvertrag bekräftigt den Handlungsbedarf: Die strategische Auslandskommunikation soll verstärkt werden, um ein zutreffendes und differenziertes Bild von Deutschland und seinen Menschen zu vermitteln. Eine zeitgemäße Kommunikation über Deutschland muss deshalb eine breite Palette von Themen abdecken. Es geht um die Vermittlung von Positionen deutscher Außenpolitik, unserer Werte und Interessen. Diese Arbeit wird in dem weltweiten Netz unserer Auslandsvertretungen gemacht. Zur Verstärkung von deren Arbeit hat das Auswärtige Amt regionale Deutschlandzentren eingerichtet, die von Dakar, Kairo, Mexiko, Pretoria und Singapur aus deutsche Außenpolitik auf Social Media in der regional genutzten Sprache kommunizieren.
Der Umgang mit Desinformation oder auch die Kommunikation zu Flucht und Migration bilden weitere Schwerpunkte unserer Arbeit. Die vom Auswärtigen Amt beauftragte Plattform deutschland.de zeigt und erklärt Deutschland und deutsche Außenpolitik auf Basis von Fakten und mit journalistischen Mitteln und in zehn Sprachen. Darüber hinaus kooperiert das Auswärtige Amt mit der Deutschen Welle, sowie unterschiedlichen Medienpartnern und zivilgesellschaftlichen Organisationen.
Besonders wichtig bei der Gestaltung von Politik ist der Dialog mit den eigenen Bürgerinnen und Bürgern, und dies betrifft insbesondere auch die deutsche Außenpolitik. In Veranstaltungsformaten wie „Diplomatie-macht-Schule“ oder „Townhall-Diskussionen“ diskutieren deshalb Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Auswärtigen Amts mit Bürgerinnen und Bürgern über aktuelle Themen und wichtige Ereignisse. Darüber hinaus entwickeln wir unsere Formate kontinuierlich weiter, um eine möglichst breite Öffentlichkeit zu erreichen, das Grundverständnis für Außenpolitik zu stärken und dabei auch Bewusstsein für Komplexität und unterschiedlichste Perspektiven bei außenpolitischen Themen zu schaffen. So nutzen wir ausführlichere digitale Formate wie beispielsweise unseren Podcasts vom Posten oder in Kooperation mit Influencer:innen erstellte Interview-Videos unter dem Format „Diplomatie-im-Dialog“, um auf vielfältige Weise die deutsche Außenpolitik zu vermitteln. Neue Zielgruppen erreichen wir auch durch innovative Formate im Bereich Gaming von LIVE-Chat-Interviews „Let’s Play“ auf Twitch oder Discord bis hin zur Co-Kommentierung von „CIV-Gipfel“-Events bei Rocketbeans TV.
Sie sind interessiert an Strategischer Kommunikation im Auswärtigen Amt?
- Folgen Sie Peter Ptassek, dem Beauftragten für strategische Kommunikation auf Twitter: @Ptassek
- Folgen Sie den Kanälen von deutschland.de, sowie den Social-Media-Kanälen der Regionalen Deutschlandzentren
- Erfahren Sie mehr über die Bürgerdialoge des Auswärtigen Amtes
- Nutzen Sie das digitale Angebot von „Außenpolitik Live“
- Hören Sie unseren „Podcast vom Posten“ oder schauen Sie sich auf dem Youtube-Kanal des Auswärtigen Amtes eine Folge „Diplomatie-im-Dialog“ an.
- Wenden Sie sich an uns, wenn Sie mal eine Diplomatin oder einen Diplomaten zu sich in eine Volkshochschule, Vereinsveranstaltung („Townhall-Diskussion“) oder in eine Schule („Diplomatie-macht-Schule“) einladen möchten.
- Wenn Sie mit einer Gruppe ab 20 Personen einen Vortrag im Auswärtigen Amt buchen möchten, wenden Sie sich bitte an unser Besucherzentrum oder besuchen Sie uns im Rahmen des Tages der offenen Tür der Bundesregierung (immer in der 2. August-Hälfte): diplo.de/aamt/zugastimaa
In der Region, mit der Region: Tschadsee-Konferenz in Niamey
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Die Region rund um den Tschadsee liegt zwischen dem Sahel und Zentralafrika. Sie ist gezeichnet von sich überlagernden Krisen: Terrorismus, Konflikte, schwache staatlichen Strukturen und den Folgen der Klimakrise.
Dies hat fatale Auswirkungen für die etwa 35 Millionen Menschen, die dort leben: Nahezu jeder zehnte Einwohner wurde vertrieben, 11 Millionen Menschen – in etwa die Einwohnerzahl von ganz Baden-Württemberg – sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Nahrungsmittelunsicherheit trifft die Region besonders stark und hat sich in den letzten Monaten insbesondere durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verschärft.
Vertreterinnen und Vertreter aus Afrika, Europa und von internationalen Partnern an einem Tisch
 Die Anrainerstaaten des Tschadsees - Niger, Nigeria, Kamerun und Tschad - trafen sich am 23. und 24. Januar in der nigrischen Hauptstadt Niamey, um gemeinsam mit Schlüsselakteuren aus humanitärer Hilfe, Stabilisierung und Entwicklungszusammenarbeit über Ansätze zu beraten, die der Region zu mehr Stabilität verhelfen können. Gemeinsam mit Niger waren Deutschland, Norwegen und die Vereinten Nationen Mitgastgeber der Konferenz.
Die Anrainerstaaten des Tschadsees - Niger, Nigeria, Kamerun und Tschad - trafen sich am 23. und 24. Januar in der nigrischen Hauptstadt Niamey, um gemeinsam mit Schlüsselakteuren aus humanitärer Hilfe, Stabilisierung und Entwicklungszusammenarbeit über Ansätze zu beraten, die der Region zu mehr Stabilität verhelfen können. Gemeinsam mit Niger waren Deutschland, Norwegen und die Vereinten Nationen Mitgastgeber der Konferenz.
Trotz zahlreicher Herausforderungen trägt die besondere Zusammenarbeit in der Tschadsee-Region Früchte: In den vergangenen Monaten haben viele Kämpfer der Terrororganisation Boko Haram ihre Waffen niedergelegt.
Die auf der zweiten Tschadseekonferenz im Jahr 2018 in Berlin entwickelte regionale Stabilisierungsarchitektur der Tschadseebeckenkommission (LCBC) und der Afrikanischen Union (AU) hat zur einer engen Zusammenarbeit zwischen den Staaten und lokalen Ebenen der Region geführt.
Zentrale Idee der regionalen Stabilisierungsarchitektur ist, dass die Tschadsee-Anrainerstaaten gemeinsam Ansätze für ihre Region entwickeln. Sie werden dabei von internationalen Partnern mit Projekten, die Entwicklungszusammenarbeit, Humanitäre Hilfe und Stabilisierung im so genannten Humanitarian-Development-Peace-Nexus verbinden, unterstützt.
Staatsministerin Keul leitete die deutsche Delegation, die für die Bundesregierung bei der Konferenz teilnahm. Sie sagte vor ihrer Abreise nach Niamey:
Krisen in Afrika brauchen Lösungen aus Afrika – deswegen ist es richtig, dass diese Tschadseekonferenz erstmals in der Region stattfindet. Deutschland bleibt auch in Zukunft ein verlässlicher Partner der Tschadsee-Region.
Staatsministerin Keul kündigte in ihrer Rede an, dass die Bundesregierung im Jahr 2023 weitere 100 Millionen Euro für die Menschen in der Tschadsee-Region bereitstellen werde. Mit den zusätzlichen Mitteln werden zum Beispiel zurückgekehrte Binnenvertriebene und die Re-Integration ehemaliger Boko-Haram-Kämpfer unterstützt. Auch die humanitäre Hilfe für vulnerable Bevölkerungsgruppen kann durch den deutschen Beitrag intensiviert werden.
So hilft Deutschland in der Tschadsee-Region
Die Bundesregierung ist seit Jahren in der Region engagiert - auch als Mitorganisatorin der Internationalen Tschadseekonferenz. Die Zweite Internationale Tschadseekonferenz hat 2018 in Berlin stattgefunden.
Deutschland unterstützt gezielt Binnenvertriebene, Flüchtlinge sowie Aufnahmegemeinden in schwer zugänglichen Gebieten. Die Hilfsorganisationen stellen Nahrungsmittelnothilfe und mobile Kliniken bereit, um traumatisierte Menschen auch psychologisch zu versorgen.
Die Projektaktivitäten nehmen dabei besonders die Bedürfnisse älterer Menschen, schwangerer und stillender Frauen, Kindern unter fünf Jahren und von Menschen mit Behinderungen in den Blick.
Neben humanitärer Hilfe geht es in der Tschadseeregion auch um Stabilisierung. Deutschland engagiert sich prioritär beim Wiederaufbau zerstörter Dörfer wie zum Beispiel in Baroua, damit zuvor von Boko Haram vertriebene Einwohnerinnen und Einwohner zurückkehren können. Auch die Wiedereingliederung ehemaliger Boko-Haram-Kämpfer unterstützt die Bundesregierung und fördert so die Versöhnungsarbeit in der Region.
Dies stand auch im Zentrum des Besuchs von Außenministerin Baerbock im Nordosten Nigerias im Dezember 2022.
3. Internationale Tschadsee-Konferenz in Niamey
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Die Region rund um den Tschadsee liegt zwischen dem Sahel und Zentralafrika. Sie ist gezeichnet von sich überlagernden Krisen: Terrorismus, Konflikte, schwache staatlichen Strukturen und den Folgen der Klimakrise. Dies hat fatale Auswirkungen für die etwa 35 Millionen Menschen, die dort leben: Nahezu jeder zehnte Einwohner wurde vertrieben, 11 Millionen Menschen – in etwa die Einwohnerzahl von ganz Baden-Württemberg – sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Nahrungsmittelunsicherheit trifft die Region besonders stark und hat sich in den letzten Monaten insbesondere durch den russischen Angriffskrieg verschärft.
Vertreterinnen und Vertreter aus Afrika, Europa und von internationalen Partnern an einem Tisch
 Die Anrainerstaaten des Tschadsees - Niger, Nigeria, Kamerun und Tschad - treffen sich am 23. und 24. Januar in der nigrischen Hauptstadt Niamey, um gemeinsam mit Schlüsselakteuren aus humanitärer Hilfe, Stabilisierung und Entwicklungszusammenarbeit über Ansätze zu beraten, die der Region zu mehr Stabilität verhelfen können. Gemeinsam mit Niger sind Deutschland, Norwegen und die Vereinten Nationen Mitgastgeber der Konferenz.
Die Anrainerstaaten des Tschadsees - Niger, Nigeria, Kamerun und Tschad - treffen sich am 23. und 24. Januar in der nigrischen Hauptstadt Niamey, um gemeinsam mit Schlüsselakteuren aus humanitärer Hilfe, Stabilisierung und Entwicklungszusammenarbeit über Ansätze zu beraten, die der Region zu mehr Stabilität verhelfen können. Gemeinsam mit Niger sind Deutschland, Norwegen und die Vereinten Nationen Mitgastgeber der Konferenz.
Denn trotz zahlreicher Herausforderungen trägt die besondere Zusammenarbeit in der Tschadsee-Region Früchte: In den vergangenen Monaten haben viele Kämpfer der Terrororganisation Boko Haram ihre Waffen niedergelegt. Die auf der zweiten Tschadseekonferenz im Jahr 2018 in Berlin entwickelte regionale Stabilisierungsarchitektur der Tschadseebeckenkommission (LCBC) und der Afrikanischen Union (AU) hat zur einer engen Zusammenarbeit zwischen den Staaten und lokalen Ebenen der Region geführt. Zentrale Idee ist, dass die Tschadsee-Anrainerstaaten Ansätze für die Region gemeinsam entwickeln. Sie werden dabei von internationalen Partnern mit Projekten, die Entwicklungszusammenarbeit, Humanitäre Hilfe und Stabilisierung im so genannten Humanitarian-Development-Peace-Nexus verbinden, unterstützt.
Staatsministerin Keul nimmt für die Bundesregierung an der Konferenz teil. Sie sagte vor ihrer Abreise nach Niamey:
Krisen in Afrika brauchen Lösungen aus Afrika – deswegen ist es richtig, dass diese Tschadseekonferenz erstmals in der Region stattfindet. Deutschland bleibt auch in Zukunft ein verlässlicher Partner der Tschadsee-Region.
Staatsministerin Keul kündigte an, dass die Bundesregierung weitere 100 Millionen Euro für die Menschen in der Tschadsee-Region bereitstellen werde. Mit den zusätzlichen Mitteln werden zum Beispiel zurückgekehrte Binnenvertriebene und die Re-Integration ehemaliger Boko-Haram-Kämpfer unterstützt. Auch die humanitäre Hilfe für vulnerable Bevölkerungsgruppen kann durch den deutschen Beitrag intensiviert werden.
So hilft Deutschland in der Tschadsee-Region
Die Bundesregierung ist seit Jahren in der Region engagiert - auch als Mitorganisatorin der Internationalen Tschadseekonferenz. Die Zweite Internationale Tschadseekonferenz hat 2018 in Berlin stattgefunden.
Deutschland unterstützt gezielt Binnenvertriebene, Flüchtlinge sowie Aufnahmegemeinden in schwer zugänglichen Gebieten. Die Hilfsorganisationen stellen Nahrungsmittelnothilfe und mobile Kliniken bereit, um traumatisierte Menschen auch psychologisch zu versorgen. Die Projektaktivitäten nehmen dabei besonders die Bedürfnisse älterer Menschen, schwangerer und stillender Frauen, Kindern unter fünf Jahren und von Menschen mit Behinderungen in den Blick.
Neben humanitärer Hilfe geht es in der Tschadseeregion auch um Stabilisierung. Deutschland engagiert sich prioritär beim Wiederaufbau zerstörter Dörfer wie zum Beispiel in Baroua, damit zuvor von Boko Haram vertriebene Einwohnerinnen und Einwohner zurückkehren können. Auch die Wiedereingliederung ehemaliger Boko-Haram-Kämpfer unterstützt die Bundesregierung und fördert so die Versöhnungsarbeit in der Region.
»Boot Düsseldorf«: Das sind die Jachten und Boote des Jahres 2023
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Bei der »Boot Düsseldorf« werden die wichtigsten europäischen Auszeichnungen für Segel- und Motorjachten verteilt. Auffallend: ein neuer Designtrend – und immer mehr E-Antriebe...
Außenministerin Baerbock reist in die Niederlande: Hand in Hand für die Stärkung des Völkerrechts
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Enge Zusammenarbeit weiter ausbauen: Politische Gespräche in Den Haag
Mit dem Nachbarn Niederlande ist Deutschland wirtschaftlich, politisch, militärisch und kulturell eng verbunden. Und auch die europapolitische Abstimmung beider Länder ist eng und vertrauensvoll, gerade auch mit Blick auf die Frage, wie Europa zukunftsfest gemacht werden soll. Ähnlich wie Deutschland entwickeln auch die Niederlande derzeit eine umfassende China-Strategie. Und auch mit Blick auf unsere Unterstützung für die Ukraine sprechen Deutschland und die Niederlande mit einer Stimme: Mit ihrem Amtskollegen Wopke Hoekstra lancierte Außenministerin Baerbock auf ihrer Reise unter anderem eine gemeinsame Initiative gegen die Verschleppung und illegalen Adoptionen von Kindern aus der Ukraine nach Russland.
Rede in der Haager Akademie für Völkerrecht
Mit dem Internationalen Gerichtshof (IGH), dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) sowie dem Internationalen Schiedsgerichtshof beherbergt Den Haag einige der bedeutendsten internationalen Gerichte. Viele sprechen daher auch von der „Welthauptstadt“ des internationalen Rechts und der internationalen Gerichtsbarkeit. Der starke Einsatz für die regelbasierte internationale Ordnung bildet einen Grundpfeiler deutscher Außenpolitik. Gerade in diesen Zeiten müssen das Völkerrecht und dessen Institutionen gestärkt und weiterentwickelt werden.
Russlands Krieg gegen die Ukraine ist auch ein Krieg gegen das Recht. Putin tritt die elementarsten Grundsätze des internationalen Rechts, die alle Völker verbinden, mit Füßen. - Außenministerin Baerbock
Die Außenministerin hielt eine Rede an der Haager Akademie für Völkerrecht. Die Rede widmete sich der Stärkung und Weiterentwicklung des Völkerstrafrechts sowie der Frage, wie das Völkerrecht den Herausforderungen durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gerecht werden kann.
Russlands Krieg gegen die Ukraine ist auch ein brutaler Angriff auf das Völkerrecht. Zeitenwende bedeutet: Wir müssen auch im Völkerrecht neue Antworten finden, damit es seine Geltung auch entfalten kann. - Außenministerin Baerbock
Mit Blick auf Russlands Angriffskrieg weißt das Völkerrecht eine Rechenschaftslücke in Bezug auf das Verbrechen der Aggression auf. Außenministerin Baerbock schlug in ihrer Rede ein zweigleisiges Vorgehen vor, um diese zu schließen:
Zum Einen: Wir wollen die Ukraine international unterstützen, in Den Haag ein Sondertribunal für Aggression einzurichten, das auf ukrainischem Recht fußt und um internationale Elemente ergänzt wird. Als Ergänzung zum Internationalen Strafgerichtshof kann es dort aktiv werden, wo dieser wegen der Lücke derzeit nicht tätig werden kann. Zum Anderen: Wir möchten daran arbeiten, das Römische Statut so anzupassen, dass Aggression künftig genau wie Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen verfolgt werden kann. Dann reicht es aus, wenn der Opferstaat unter die IStGH-Jurisdiktion fällt.
Gespräche beim Internationalen Strafgerichtshof
Außenministerin Baerbock traf in Den Haag den Präsidenten des Internationalen Strafgerichtshof Piotr Hofmański zum Gespräch. Beim anschließenden Austausch mit dem Chefankläger des IStGH Karim Khan ging es insbesondere auch darum, einen Überblick über den Stand der Ermittlungen des IStGH zu russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine zu erhalten.
Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag ist ein unabhängiger, ständiger Gerichtshof zur Ahndung von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen der Aggression. Er dient damit auch der Abschreckung von solchen Taten. Deutschland ist mit ca. 20 Millionen Euro im Jahr 2023 zweitgrößter Beitragszahler nach Japan. Deutschland hat frühzeitig zusammen mit 42 weiteren Staaten den IStGH mit den russischen Verbrechen in der Ukraine befasst und unterstützt diese. Gegenwärtig ist Bertram Schmitt als deutscher Richter am IStGH tätig. Die von der Bundesregierung unterstützte Kandidatin für seine Nachfolge ist die Richterin am Bundesgerichtshof, Ute Hohoff.
»52 Places to Go« von »New York Times«: Das sind die spannendsten Urlaubsziele für 2023
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Griechenland, Alaska, Indien oder Bhutan – wohin soll die Reise gehen? Die Auswahl ist groß, nachdem die Grenzen weitgehend wieder geöffnet sind. Die »New York Times« gibt Tipps für Menschen mit Fernweh...
Der Waffenstillstand in Äthiopien hält: Außenministerin Annalena Baerbock und ihre französische Kollegin Catherine Colonna reisen gemeinsam nach Addis Abeba
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Hoffnung auf Frieden nach zwei Jahren Krieg
Die letzten Tage und Wochen waren geprägt von positiven Entwicklungen im Hinblick auf eine dauerhaft friedliche Beilegung des Tigray-Konflikts. Vertreter der „Volksfront zur Befreiung Tigrays“ (TPLF) sowie der äthiopischen Zentralregierung einigten sich Anfang November auf einen dauerhaften Waffenstillstand. Seitdem gibt es viele spürbare Fortschritte bei der Beilegung des Konflikts: Tigrinische Milizen werden entwaffnet, die Grundversorgung für Menschen in Tigray wird wiederhergestellt und auch der Zugang für humanitäre Hilfsorganisationen nach Tigray wird verbessert. Bewohner und Bewohnerinnen großer Städte wie Mekelle und Shire haben wieder Zugang zu Elektrizität und Mobilfunk. Ende Dezember hat auch die nationale Fluglinie Ethiopian Airlines wieder Flüge in den nördlichen Landesteil aufgenommen, eine wichtige Voraussetzung dafür, die Wirtschaft im Norden anzukurbeln.
Dass all diese Schritte jetzt gegangen werden, ist nicht selbstverständlich. Der Krieg in Äthiopien zählte zu einem der tödlichsten in den vergangenen beiden Jahren. Die Gräben des Misstrauens in der Gesellschaft sind tief. Deswegen ist es jetzt wichtig, die positiven Entwicklungen hin zu Frieden in Äthiopien mit voller Kraft zu unterstützen. Die beiden Außenministerinnen werden genau dazu Gespräche führen, mit Premierminister Abiy Ahmed, Außenminister Demeke Mekonnen, Justizminister Gedion Timotheos und der Präsidentin des Landes Sahle-Work Zewde. Ein weiterer Fokus der Gespräche wird das Thema Menschenrechte sein. VN-Berichten zufolge wurden während des Konflikts schwerste Menschenrechtsverbrechen von allen Konfliktparteien begangen. Die äthiopische Regierung arbeitet derzeit daran, einen Übergangs-Justizmechanismus aufzubauen, um die Verbrechen aufzuklären und Straftäter zur Rechenschaft zu ziehen. Parallel dazu wurde auch eine internationale Expertenkommission durch den VN-Menschenrechtsrat mit der Untersuchung der Verbrechen mandatiert.
Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine destabilisiert auch das Horn von Afrika: Deutschland und Frankreich federn die Folgen für die Region ab
 Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat durch eine Zusammenwirkung von Lieferengpässen, höheren Energiepreisen und Exportbeschränkungen Preise für Nahrungsmittel nach oben getrieben. Derzeit sind laut Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) ungefähr 345 Millionen Menschen akut unterernährt, das sind 69 Millionen mehr als zu Beginn des russischen Angriffskriegs. Davon können laut WFP 47 Millionen den Folgen des Angriffskriegs zugeordnet werden. In Äthiopien ist die Lage laut WFP besonders kritisch. Am Horn von Afrika erschwert nämlich eine katastrophale Dürre die ausreichende Versorgung mit Nahrungsmitteln. Seit fünf Jahren hat es in vielen Teilen der Region nicht mehr geregnet.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat durch eine Zusammenwirkung von Lieferengpässen, höheren Energiepreisen und Exportbeschränkungen Preise für Nahrungsmittel nach oben getrieben. Derzeit sind laut Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) ungefähr 345 Millionen Menschen akut unterernährt, das sind 69 Millionen mehr als zu Beginn des russischen Angriffskriegs. Davon können laut WFP 47 Millionen den Folgen des Angriffskriegs zugeordnet werden. In Äthiopien ist die Lage laut WFP besonders kritisch. Am Horn von Afrika erschwert nämlich eine katastrophale Dürre die ausreichende Versorgung mit Nahrungsmitteln. Seit fünf Jahren hat es in vielen Teilen der Region nicht mehr geregnet.
Bei ihrem Besuch werden die Außenministerinnen eine Lagerhalle des Welternährungsprogramms besuchen, in der sich Weizensäcke aus der Ukraine bis zur Decke stapeln. Diese ukrainische Weizenspende an Äthiopien wird jetzt rasch an die Bedürftigen in Äthiopien verteilt. Sie ist Teil der Initiative „Grain from Ukraine“, die von der Ukraine zusammen mit internationalen Partnern auf den Weg gebracht wurde. Im Rahmen der Initiative stellt die Ukraine Getreide bereit, um die Not in besonders von Hunger betroffenen Ländern wie Äthiopien zu bekämpfen. Internationale Geberpartner tragen die Transport- und Verteilungskosten. Deutschland übernahm die Transportkosten für Getreidelieferungen nach Äthiopien, Frankreich unterstützt den Transport von 25.000 Tonnen Getreide ins Nachbarland Somalia. Mit der Lieferung von 25.000 Tonnen Getreide nach Äthiopien kann die Ernährung von 1,6 Millionen Menschen in Äthiopien für einen Monat sichergestellt werden.
Die Afrikanische Union: Für Europa ein bedeutender Partner beim Einsatz für Frieden und Sicherheit
 Die Afrikanische Union (AU) hat ihren Sitz in Addis Abeba. Den zweiten Tag des Besuchs in Äthiopien nutzen die Außenministerinnen Baerbock und Colonna für ein Treffen mit dem Vorsitzenden der Kommission der AU Moussa Faki. Gemeinsam wollen sie die Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und der Afrikanischen Union ausbauen.
Die Afrikanische Union (AU) hat ihren Sitz in Addis Abeba. Den zweiten Tag des Besuchs in Äthiopien nutzen die Außenministerinnen Baerbock und Colonna für ein Treffen mit dem Vorsitzenden der Kommission der AU Moussa Faki. Gemeinsam wollen sie die Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und der Afrikanischen Union ausbauen.
Obwohl erst gut 20 Jahre jung, nimmt die Afrikanische Union bereits eine wichtige Rolle dabei ein, auf dem afrikanischen Kontinent Mediations- und Friedensmissionen auf den Weg zu bringen. Die Afrikanische Union ist langfristig z.B. in Somalia (seit 2007 mit ca. 19.500 Truppen über AMISOM/ATMIS) und akut in einer Vielzahl von Krisen in Afrika engagiert. Auch den Waffenstillstand in Äthiopien hat die Afrikanische Union unter Leitung des ehemaligen nigerianischen Staatspräsidenten Obasanjo vermittelt.
Einen besonderen Schwerpunkt legt die AU auf die Stärkung der politischen Rolle von Frauen in Friedensprozessen, in Anlehnung an die Agenda „Women, Peace and Security“ des VN-Sicherheitsrats. Zu den AU-Initiativen zählen u.a. FemWise, ein Netzwerk afrikanischer weiblicher Persönlichkeiten zur Konfliktprävention und Mediation, und das African Women Leaders Network, das die Führungsrolle von Frauen bei der Umsetzung der afrikanischen Entwicklungsagenda (Agenda 2063) sicherstellen soll. Beide Initiativen werden von Deutschland unterstützt.
Humanitäre Hilfe und Katastrophenhilfe in Höhe von 12,5 Mrd. Euro für die Ukraine
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat unfassbares Leid über Millionen Menschen gebracht. Gezielt greift Russland zivile Infrastruktur wie die Strom- und Wärmeversorgung an und raubt den Menschen die Grundlage zum Überleben. Für die Bundesregierung hat konkrete Hilfe für die Versorgung der Ukrainerinnen und Ukrainer daher höchste Priorität. Deutschland unterstützt deswegen die Ukraine und ihre Nachbarländer mit humanitärer Hilfe und bei der Versorgung von Binnenvertriebenen und Flüchtlingen.
Seit Kriegsbeginn hat die Bundesregierung mehr als 12,5 Mrd. Euro für bilaterale Unterstützungsleistungen zur Verfügung gestellt, z.B. für ein umfangreiches Winterhilfsprogramm, zur Unterstützung der Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, oder zur Aufarbeitung von Kriegsverbrechen.
Eine regelmäßig aktualisierte Übersicht der bilateralen Unterstützungsleistungen finden Sie hier.
Militärische Unterstützungsleistungen für die Ukraine
Die Ukraine muss sich gegen den russischen Angriff verteidigen können. Deutschland unterstützt die Ukraine daher mit Ausrüstungs- und Waffenlieferungen, aus Beständen der Bundeswehr und durch Lieferungen der Industrie, die aus Mitteln der sog. Ertüchtigungshilfe der Bundesregierung finanziert werden. Dabei orientiert sich die Bundesregierung an dem Bedarf der Ukraine und prüft ständig, in welchen Bereichen, bspw. in der Flugabwehr, weitere Unterstützungsleistungen möglich sind.
Deutschland ist zudem größter Einzahler in den Refinanzierungsfonds der Europäischen Friedensfazilität (EPF), der mit bislang europaweit 3,1 Mrd. Euro Unterstützungsmaßnahmen von 2022 bis 2026 zur Lieferungen militärischer Ausrüstungsgegenstände durch EU-Mitgliedstaaten an die ukrainischen Streitkräfte ermöglicht.
Die aktuelle Übersicht der militärischen Unterstützungsleistungen finden Sie hier.
Präzedenzloses Sanktionspaket
Solange Russland die Ukraine brutal angreift, muss dies Konsequenzen haben. Deutschland und seine europäischen Partner haben mit einem massiven und präzedenzlosen Sanktionspaket reagiert: Abschneiden Russlands von Kapitalmärkten, umfassende Ein- und Ausfuhrverbote, insbesondere in den Bereichen Hochtechnologie, Industrie und Energie, eine Ölpreisobergrenze, weitreichende Importverbote, u.a. für Kohle, Erdöl, Eisen- und Stahlprodukte sowie Gold aus Russland, harte Maßnahmen gegen den russischen Luftfahrtsektor sowie gezielte Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Putin, Außenminister Lawrow und das Oligarchen-System, das sie stützt.
Mehr über die bestehenden Sanktionen erfahren Sie hier.
Dokumentation von Kriegsverbrechen
Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine kommt es zu schwerwiegenden Verletzungen des humanitären Völkerrechts und massiven Menschenrechtsverstößen, wie der Tötung und Folter von Zivilistinnen und Zivilisten in der Ukraine. Deutschland und seine Partner haben dies dem Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zur Untersuchung unterbreitet, welcher daraufhin umgehend Ermittlungen aufgenommen hat. Deutschland unterstützt diese Ermittlungen in der Ukraine finanziell sowie durch Entsendung von Experten. Auch die Ermittlungen ukrainischer Stellen unterstützen wir, etwa durch Beratung und Lieferung von Forensik-Ausrüstung. Die Ukraine kann sich auf deutsche Unterstützung bei der Dokumentation und Aufarbeitung von Kriegsverbrechen in der Ukraine verlassen – dies sind wir den Opfern schuldig.
Wiederaufbau
Gemeinsam mit der Ukraine müssen wir auch für die Zukunft vorsorgen. Deswegen planen wir gemeinsam mit der Ukraine sowie unseren Partnern in EU und G7 schon jetzt den Wiederaufbau der Ukraine. Das wird eine besondere internationale Kraftanstrengung erfordern, es ist aber auch eine große Chance, den Wiederaufbau zu verknüpfen mit der Modernisierung von Staat und Wirtschaft, einer ökologischen Transformation, und nicht zuletzt innerstaatlichen Reformen und dem EU-Beitrittsprozess.
Große Hilfsbereitschaft
Viele Menschen in Deutschland nehmen Anteil an der Situation in der Ukraine - auch in der Zivilgesellschaft ist die Hilfsbereitschaft enorm. Das große Spendenaufkommen führt zu einem großen Koordinierungsbedarf für die Hilfsorganisationen. Die Bundesregierung unterstützt deshalb den Appell, statt Sachspenden wenn immer möglich Geld an etablierte Hilfsorganisationen zu spenden. Spenden sind über die Aktion Deutschland Hilft oder das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe möglich. Mit dem Betreff „Nothilfe Ukraine“ kommen die Gelder den Menschen in der Ukraine zugute.
Informationen über den Bedarf von Geflüchteten vor Ort und zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen erteilen die Städte und Kommunen.
Humanitäre Hilfe und Katastrophenhilfe in Höhe von 12,5 Mrd. Euro
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat unfassbares Leid über Millionen Menschen gebracht. Gezielt greift Russland zivile Infrastruktur wie die Strom- und Wärmeversorgung an und raubt den Menschen die Grundlage zum Überleben. Für die Bundesregierung hat konkrete Hilfe für die Versorgung der Ukrainerinnen und Ukrainer daher höchste Priorität. Deutschland unterstützt deswegen die Ukraine und ihre Nachbarländer mit humanitärer Hilfe und bei der Versorgung von Binnenvertriebenen und Flüchtlingen.
Seit Kriegsbeginn hat die Bundesregierung mehr als 12,5 Mrd. Euro für bilaterale Unterstützungsleistungen zur Verfügung gestellt, z.B. für ein umfangreiches Winterhilfsprogramm, zur Unterstützung der Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, oder zur Aufarbeitung von Kriegsverbrechen.
Eine regelmäßig aktualisierte Übersicht der bilateralen Unterstützungsleistungen finden Sie hier.
Militärische Unterstützungsleistungen für die Ukraine
Die Ukraine muss sich gegen den russischen Angriff verteidigen können. Deutschland unterstützt die Ukraine daher mit Ausrüstungs- und Waffenlieferungen, aus Beständen der Bundeswehr und durch Lieferungen der Industrie, die aus Mitteln der sog. Ertüchtigungshilfe der Bundesregierung finanziert werden. Dabei orientiert sich die Bundesregierung an dem Bedarf der Ukraine und prüft ständig, in welchen Bereichen, bspw. in der Flugabwehr, weitere Unterstützungsleistungen möglich sind.
Deutschland ist zudem größter Einzahler in den Refinanzierungsfonds der Europäischen Friedensfazilität (EPF), der mit bislang europaweit 3,1 Mrd. Euro Unterstützungsmaßnahmen von 2022 bis 2026 zur Lieferungen militärischer Ausrüstungsgegenstände durch EU-Mitgliedstaaten an die ukrainischen Streitkräfte ermöglicht.
Die aktuelle Übersicht der militärischen Unterstützungsleistungen finden Sie hier.
Präzedenzloses Sanktionspaket
Solange Russland die Ukraine brutal angreift, muss dies Konsequenzen haben. Deutschland und seine europäischen Partner haben mit einem massiven und präzedenzlosen Sanktionspaket reagiert: Abschneiden Russlands von Kapitalmärkten, umfassende Ein- und Ausfuhrverbote, insbesondere in den Bereichen Hochtechnologie, Industrie und Energie, eine Ölpreisobergrenze, weitreichende Importverbote, u.a. für Kohle, Erdöl, Eisen- und Stahlprodukte sowie Gold aus Russland, harte Maßnahmen gegen den russischen Luftfahrtsektor sowie gezielte Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Putin, Außenminister Lawrow und das Oligarchen-System, das sie stützt.
Mehr über die bestehenden Sanktionen erfahren Sie hier.
Dokumentation von Kriegsverbrechen
Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine kommt es zu schwerwiegenden Verletzungen des humanitären Völkerrechts und massiven Menschenrechtsverstößen, wie der Tötung und Folter von Zivilistinnen und Zivilisten in der Ukraine. Deutschland und seine Partner haben dies dem Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zur Untersuchung unterbreitet, welcher daraufhin umgehend Ermittlungen aufgenommen hat. Deutschland unterstützt diese Ermittlungen in der Ukraine finanziell sowie durch Entsendung von Experten. Auch die Ermittlungen ukrainischer Stellen unterstützen wir, etwa durch Beratung und Lieferung von Forensik-Ausrüstung. Die Ukraine kann sich auf deutsche Unterstützung bei der Dokumentation und Aufarbeitung von Kriegsverbrechen in der Ukraine verlassen – dies sind wir den Opfern schuldig.
Wiederaufbau
Gemeinsam mit der Ukraine müssen wir auch für die Zukunft vorsorgen. Deswegen planen wir gemeinsam mit der Ukraine sowie unseren Partnern in EU und G7 schon jetzt den Wiederaufbau der Ukraine. Das wird eine besondere internationale Kraftanstrengung erfordern, es ist aber auch eine große Chance, den Wiederaufbau zu verknüpfen mit der Modernisierung von Staat und Wirtschaft, einer ökologischen Transformation, und nicht zuletzt innerstaatlichen Reformen und dem EU-Beitrittsprozess.
Große Hilfsbereitschaft
Viele Menschen in Deutschland nehmen Anteil an der Situation in der Ukraine - auch in der Zivilgesellschaft ist die Hilfsbereitschaft enorm. Das große Spendenaufkommen führt zu einem großen Koordinierungsbedarf für die Hilfsorganisationen. Die Bundesregierung unterstützt deshalb den Appell, statt Sachspenden wenn immer möglich Geld an etablierte Hilfsorganisationen zu spenden. Spenden sind über die Aktion Deutschland Hilft oder das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe möglich. Mit dem Betreff „Nothilfe Ukraine“ kommen die Gelder den Menschen in der Ukraine zugute.
Informationen über den Bedarf von Geflüchteten vor Ort und zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen erteilen die Städte und Kommunen.
Nothilfe in Syrien: Minimalkompromiss bei Crossborder-Resolution
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Bab al Hawa, gelegen zwischen der Türkei und Syrien, ist der letzte Grenzübergang, über den internationale humanitäre Hilfe und Unterstützung für die Menschen in Nordwestsyrien geleistet werden kann. Damit ist er ein Nadelöhr lebensnotwendiger Hilfe für die Menschen in der Region Idlib, die besonders unter der Gewalt des Assad-Regimes leiden.
Russland blockiert, Syrien verliert
Russland unterstützt seit Jahren das Regime in Damaskus im Syrien-Konflikt und geht dabei mit größter Brutalität auch gegen die Zivilbevölkerung vor. Ganz besonders betroffen sind die Menschen in Nordwestsyrien.
Obwohl das Leben und Überleben von Millionen von Menschen in Syrien von humanitärer Hilfe abhängen, hat Russland hatte in den vergangenen Jahren wieder und wieder sinnvolle Regelungen zur Versorgung der Menschen in der Region Idlib verhindert. Russland hat bei Verhandlungen im Sicherheitsrat zuerst durchgesetzt, dass die Zahl der Grenzübergänge reduziert wurde und dann die Verlängerung insgesamt in Frage gestellt. Damit betreibt Russland seit Jahren rücksichtslose Politik auf dem Rücken notleidender Syrerinnen und Syrer und leistet zudem kaum humanitäre Hilfe.
Vor der letzten Verlängerung der Resolution im Juli 2022 hatte Russland außerdem noch durch ein Veto im Sicherheitsrat eine Verkürzung der Resolutionslaufzeit auf ein halbes Jahr erzwungen, sodass das Mandat nun mitten im Winter ausgelaufen wäre. Deshalb ist die jetzt gefundene Verlängerungslösung für diesen Übergang nur ein Minimalkompromiss. Die Logistik und Planung für die Versorgung über die Türkei bleiben dadurch unnötig schwierig.
Deutsche Hilfe im Konfliktgebiet
 Die Versorgung von über zweieinhalb Millionen Menschen in Nordwestsyrien, die allermeisten Frauen und Kinder, kann somit zumindest bis Sommer fortgesetzt werden. Damit kann auch Deutschland weiterhin über die Vereinten Nationen humanitäre Hilfe in Nordwestsyrien liefern.
Die Versorgung von über zweieinhalb Millionen Menschen in Nordwestsyrien, die allermeisten Frauen und Kinder, kann somit zumindest bis Sommer fortgesetzt werden. Damit kann auch Deutschland weiterhin über die Vereinten Nationen humanitäre Hilfe in Nordwestsyrien liefern.
Die Unterstützung aus Deutschland ist besonders wichtig, da Deutschland der zweitgrößte Geberstaat für humanitäre Hilfe ist und im letzten Jahr noch einmal mehr Mittel zur Verfügung gestellt hatte. Insgesamt beträgt die Unterstützung im letzten Jahr über 1 Milliarde Euro und bereits über 13 Milliarden Euro seit Beginn des Konfliktes in Syrien.
Damit kann die größte Not in einem Land gelindert werden, in dem eine ständig steigende Zahl - in diesem Jahr bereits 15 Millionen – an Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Aus deutschen Mitteln werden unterschiedliche Projekte finanziert:
- Für das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen in Syrien war Deutschland im Jahr 2022 mit über 200 Millionen Euro der größte Geber. Landesweit finanziert Deutschland das Programm, ohne welches Millionen von Menschen in Syrien nicht mit lebensnotwendigen Lebensmittellieferungen versorgt werden könnten. Durch die deutsche Unterstützung konnten monatlich fast 6 Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln unterstützt werden, davon 1,35 Millionen in Nordwestsyrien. Zusätzlich erhielten rund 600.000 Kinder mit Vitaminen und Mikronährstoffen angereicherte Zusatzmahlzeiten.
- Daneben unterstützt Deutschland das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR mit Winterhilfe und finanziert damit u.a. Zelte. Seit kurzem können auch widerstandsfähigere Unterkünfte aus deutschen Mitteln errichtet werden, die den Flüchtlingen und Binnenvertriebenen mehr Schutz bieten.
- Deutschland fördert auch die Arbeit von vielen Nichtregierungsorganisationen in Syrien, z.B. der Deutschen Welthungerhilfe. Zusätzlich zur Verteilung von Brot unterstützt die Welthungerhilfe in Nordwestsyrien zusammen mit lokalen Partnern die Menschen auch bei der Bewältigung des Cholera-Ausbruchs, etwa durch die Bereitstellung von Hygienemitteln, wie z.B. Seife.
- Viele lokale Hilfsorganisationen in der Region Idlib werden vom „Syria Crossborder Humanitarian Fund“ unterstützt und können dadurch beispielweise Basisgesundheitsdienstleistungen anbieten. Deutschland war letztes Jahr mit 42,5 Millionen Euro größter Geber dieses Fonds, der vom Büro der Vereinten Nationen zur Koordinierung der humanitären Hilfe verwaltet wird – und nun nach der Verlängerung der Resolution für sechs Monate weiterarbeiten kann.
Deutsch-Italienischer Städtepartnerschaftspreis – Aufruf zur Bewerbung
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und sein italienischer Amtskollege Staatspräsident Sergio Mattarella überreichten am 12. Oktober 2021 in Berlin gemeinsam erstmals den "Preis der Präsidenten für die kommunale Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Italien". Mit dem Preis werden besonders innovative Partnerschaften und Projekte zwischen italienischen und deutschen Kommunen gewürdigt.
Heute laden beide Präsidenten sowie das Auswärtige Amt und das italienische Außenministerium Kommunen ein, sich erneut auf Grundlage dieser partnerschaftlichen Zusammenarbeit für eine zweite Auflage dieses Preises zu bewerben.
Denn die über 400 kommunalen Partnerschaften bilden das Herzstück der bilateralen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Italien und sind ein unverzichtbarer Bestandteil eines gelebten Europas der Zivilgesellschaften.
Bewerben können sich wieder deutsche und italienische Kommunen, die zum Zeitpunkt der Bewerbung durch eine Städtepartnerschaft oder eine deutsch-italienische Partnerschaft im Sinne einer bereits etablierten und möglichst mehrjährigen Zusammenarbeit verbunden sind. Ausgezeichnet werden Projekte, die gemeinsame Perspektiven durch gegenseitigen Austausch, insbesondere Jugendlicher; zivilgesellschaftliches Engagement; sowie Nachhaltigkeit und europäische Integration fördern. Insgesamt werden vier Preise vergeben, davon jeweils zwei an kleine und mittelgroße Kommunen (bis zu 40.000 Einwohner) und zwei an größere Kommunen (ab 40.000 Einwohner). Der Preis ist mit insgesamt 200.000 Euro dotiert und wird paritätisch von der italienischen und deutschen Regierung finanziert.
Die Ausschreibungsbedingungen sowie ein Bewerbungsbogen können unter dem untenstehenden Link abgerufen werden. Bewerbungsende ist am 14.04.2023. Die Preisträger werden durch eine paritätisch besetzte Jury ausgewählt und werden im Herbst 2023 in einer öffentlichen Preisverleihung prämiert.
Benedikt Böhm über Umweltschutz: »Im Himalaja-Lager sah es aus wie auf einer Müllhalde«
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Benedikt Böhm ist einer der besten deutschen Skibergsteiger. Hier erzählt er, wie er sich für den Erhalt der Natur engagiert und warum er bei Ausflügen manchmal seine Familie anschnauzt...
Was kostet Außenpolitik: Der Haushalt des Auswärtigen Amtes
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Der Krieg in der Ukraine und seine globalen Folgen, die dadurch nochmal zusätzlich verstärkte Ernährungskrise in vielen Regionen der Welt und die dramatischen Folgen des Klimawandels sind nur drei Beispiele für die vielen Herausforderungen, denen die deutsche Außenpolitik auch im Jahr 2023 begegnen muss. Hinzukommt eine Vielzahl regionaler Krisenherde. Ein wichtiger Fokus der Arbeit des Auswärtigen Amts liegt daher auch in diesem Jahr auf den Bereichen Humanitäre Hilfe, Krisenprävention und Stabilisierung.
Politische Schwerpunkte: Einsatz für Frieden und Stabilität
Das Kapitel “Sicherung von Frieden und Stabilität“ umfasst ein finanzielles Volumen in Höhe von über 4 Mrd. Euro und damit über die Hälfte der Gesamtausgaben des Auswärtigen Amts.
Der größte Anteil davon entfällt mit insgesamt 2,7 Mrd. Euro auf Maßnahmen der humanitären Hilfe. Unser starkes Engagement in diesem Bereich – weltweit der zweitgrößte Geber - gehört zum politischen Selbstverständnis der Bundesregierung und der außenpolitischen Verantwortung Deutschlands in der Welt. Damit reagiert Deutschland auch auf das wachsende Ausmaß und die zunehmende Komplexität von Krisen und Konflikten - auch in unmittelbarer Nachbarschaft Europas.
Einen weiteren Ausgabenschwerpunkt stellen die Leistungen an die Vereinten Nationen (UN) und die Stärkung des Multilateralismus dar. Durch Beitragszahlung an die UN (allein 618 Mio. Euro für Pflichtbeiträge) und weitere internationale Organisationen leistet Deutschland einen wichtigen Beitrag zur multilateralen Welt- und Wertegemeinschaft. Damit erkennen wir an, dass die größten internationalen Herausforderungen nur gemeinsam gelöst werden können.
Außenministerin Baerbock betonte in der Debatte des Bundestages über den Etat des Auswärtigen Amts für 2023:
Wir werden unseren Frieden, unsere Freiheit, unsere Sicherheit in Europa niemals alleine verteidigen können, niemals alleine mit Waffen, niemals alleine mit Diplomatie, sondern auch wir brauchen die internationale Gemeinschaft.

Prävention ist die beste Friedensförderung, denn sie reduziert Leid und spart Ressourcen. Deutsche Außenpolitik hat daher zum Ziel, sowohl die Eskalation von Konflikten als auch ihr Wiederaufflammen zu verhindern. Krisen entstehen oft deshalb, weil Menschen sich nicht gehört oder nicht vertreten fühlen und Konfliktparteien keinen Weg finden, miteinander ins Gespräch zu kommen. Deutschland fördert daher gesellschaftlichen Dialog, politische Teilhabe und die Rechtsstaatlichkeit. Das kann das Forensik-Team sein, welches die Verbrechen den IS aufklärt oder ein Projekt, welches die politische Teilhabe von Minderheiten fördert. Um Krisen zu verhindern und einen stabilen Frieden zu unterstützen, stehen insgesamt 565 Mio. Euro im Rahmen der Krisenprävention, Stabilisierung und Friedensförderung bereit.
Diese Schwerpunkte werden von einer Vielzahl weiterer Maßnahmen ergänzt. So setzt sich Deutschland mit 67 Mio. Euro weltweit für mehr Sicherheit und Stabilität durch Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung ein. Schwerpunkt ist, die bestehende Abrüstungs- und Rüstungskontrollarchitektur zu erhalten und wo erforderlich weiterzuentwickeln. Und auch die Entsendung ziviler Expertinnen und Experten über das Zentrum für Internationale Friedenseinsätze (ZIF) wird mit 35 Mio. Euro gefördert, um die multilaterale Krisenprävention, Konfliktbewältigung, Demokratie, Menschenrechte und humanitäre Hilfe zu unterstützen.
Auch die Förderung der Menschenrechte ist ein wichtiges Aufgabengebiet des Auswärtigen Amts. Für Projekte und Maßnahmen, die Themen wie der Abschaffung von Todesstrafe und Folter dienen oder dem Schutz von Verteidigerinnen und Verteidigern der Menschenrechte erhält das Auswärtige Amt 20 Mio. Euro.
Bildung Wissenschaft und Sprache weiter fördern
Wie kann man die Grundlage für internationalen Austausch und gegenseitiges Verständnis schaffen, auch wenn es politisch einmal schwierig wird? Und wie schafft man es, Menschen aus verschiedenen Ländern miteinander zu vernetzen, um nachhaltige Beziehungen zu ermöglichen?
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) beschäftigt sich mit diesen Fragen. Von der Restaurierung historischer Tempelanlagen in Asien über Städtepartnerschaften im Baltikum und das Deutschlandjahr in den USA bis zu den mehr als 140 Deutschen Auslandsschulen - Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) bildet neben den politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen verschiedenen Ländern die dritte Säule der deutschen Außenpolitik. Diese Bedeutung spiegelt sich auch im Haushalt 2023 wieder. So stehen für die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik des Auswärtigen Amts 1,072 Milliarden Euro zur Verfügung.
Im Zentrum stehen das Auslandsschulwesen, die Sprach- und Kulturarbeit des Goethe-Instituts, die Stipendienprogramme des Deutschen Akademischen Austauschdiensts und der Alexander von Humboldt Stiftung sowie ein umfassendes Netzwerk weltweiter Kultur- und Wissenschaftsbeziehungen. Zunehmend an Bedeutung gewinnt auch die strategische Kommunikation, um dem massiven Einsatz von Propaganda und Desinformation u.a. durch Russland zu begegnen.
Für die Arbeit des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI), einer dem Auswärtigen Amt nachgeordneten Behörde und zugleich eine der international renommiertesten deutschen Forschungseinrichtungen sind 2023 gut 45 Mio. Euro vorgesehen.
Talente aus aller Welt: Fachkräfteeinwanderung
Am 01. Januar 2021 hat das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten (kurz BfAA) seine Arbeit aufgenommen. Zu den Aufgaben des BfAA gehören u.a. Immobilienmanagement, Zentrale Dienstleistungen, Auslandsschulwesen, Fördermittelmanagement und Personalangelegenheiten. Ein weiterer Schwerpunkt, der 2023 weiter in den Fokus rückt, ist die Visumbearbeitung vom Inland aus, u.a. im Bereich der Fachkräfteeinwanderung. Für diese Aufgaben erhält das BfAA rund 54 Mio. Euro.
Personal- und Verwaltungsausgaben
Ob große globale Krise oder „kleine“ konsularische Nothilfe- die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Auswärtigen Amts sind weltweit im Einsatz. An 226 Auslandsvertretungen und in der Zentrale des Auswärtigen Amts arbeiten 12.000 von ihnen tagtäglich daran, die Ziele deutscher Außenpolitik umzusetzen. Und dennoch machen die Personal-, Sach- und Verwaltungsausgaben des Auswärtigen Amts weniger als ein Viertel des Gesamthaushalts des Auswärtigen Amts aus (1,7 Mrd. EUR).
Weitere Informationen zum beschlossenen Haushalt und der parlamentarischen Debatte dazu finden Sie auf der Webseite des Bundestags und Bundeshaushalt.de
Ethihad vor Emirates, Lufthansa leicht verbessert: Arabische Fluglinien sind laut Jacdec-Risikoanalyse die sichersten
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Wechsel an der Spitze: Etihad löst Emirates laut Risikoanalyse als sicherste Airline der Welt ab. Die Lufthansa verbessert sich im Ranking leicht. Und es gibt einen Absteiger – aus guten Gründen...
Berlin-Reise mit Kindern: Diese Museen, Ausstellungen und Shows eignen sich für Familien
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Vom Prenzlauer Berg direkt zum Mond, aus dem Hier und Jetzt zum T. rex Tristan Otto in die Oberkreidezeit: Berlin ist immer eine Reise wert. Die besten Tipps für Familien...
Dubai: Warum Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber ausgerechnet das Emirat empfiehlt
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Es gibt weniger kontroverse Urlaubsorte, über die man einen Reiseführer schreiben könnte. Der bekannte ARD-Moderator hat es trotzdem getan. Hier spricht er darüber, warum er fast jedes Jahr hinfliegt...
Geraubte Geschichte, selbstbestimmte Gegenwart: Außenministerin Annalena Baerbock reist nach Nigeria
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Sie zeigen vergangene Herrscher, tapfere Krieger, Raubkatzen und diplomatischen Besuch: die sogenannten Benin-Bronzen kehren nach über 100 Jahren in ihre Heimat Nigeria zurück. In Abuja wird Außenministerin Annalena Baerbock gemeinsam mit Claudia Roth, der Beauftragen für Kultur und Medien, die ersten 20 Benin-Bronzen aus fünf deutschen Sammlungen an Nigeria übergeben.
Wir gehen damit einen Schritt, der längst überfällig war. Das wird nicht alle Wunden der Vergangenheit heilen. Aber gemeinsam mit den Bundesländern, Städten und Museen zeigen wir, dass Deutschland es ernst meint mit der Aufarbeitung seiner dunklen Kolonialgeschichte.
- Außenministerin Annalena Baerbock
 Die Artefakte aus dem 15.-19. Jahrhundert zählen zu den wertvollsten Kunstschätzen Afrikas. Sie wurden 1897 von britischen Truppen bei der Plünderung des Edo-Königreichs im heutigen Nigeria erbeutet. In London kamen viele von ihnen unter den Hammer, auch deutsche Sammler schlugen zu. Heute befinden sich etwa 1.100 der über 5000 Benin-Bronzen im Besitz deutscher Museen. Bereits im Juli dieses Jahres haben die Regierungen Deutschlands und Nigerias eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, in der sie die Eigentumsübertragung aller in deutschen Sammlungen befindlichen betroffenen Artefakte an Nigeria vereinbart haben. Mit der Übergabe durch Außenministerin Baerbock kehren nun die ersten Bronzen zurück.
Die Artefakte aus dem 15.-19. Jahrhundert zählen zu den wertvollsten Kunstschätzen Afrikas. Sie wurden 1897 von britischen Truppen bei der Plünderung des Edo-Königreichs im heutigen Nigeria erbeutet. In London kamen viele von ihnen unter den Hammer, auch deutsche Sammler schlugen zu. Heute befinden sich etwa 1.100 der über 5000 Benin-Bronzen im Besitz deutscher Museen. Bereits im Juli dieses Jahres haben die Regierungen Deutschlands und Nigerias eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, in der sie die Eigentumsübertragung aller in deutschen Sammlungen befindlichen betroffenen Artefakte an Nigeria vereinbart haben. Mit der Übergabe durch Außenministerin Baerbock kehren nun die ersten Bronzen zurück.
Die erste staatliche Restitution kolonialer Beutekunst in diesem Umfang legt auch die Basis für den Ausbau der Beziehungen beider Länder. Dafür wird Außenministerin Baerbock in Abuja politische Gespräche über die bilaterale und internationale Zusammenarbeit führen.
Nigeria ist mit seinen über 210 Millionen Menschen die größte Demokratie Afrikas. Und eine Stimme, die international Gewicht hat – nicht nur als Sitzstaat der Regionalorganisation ECOWAS und tragende Säule der Afrikanischen Union, sondern auch als wichtiger Truppensteller in UN-Friedensmissionen. Wir wollen mit diesem wichtigen Partner noch enger zusammenarbeiten, insbesondere bei der größten globalen Herausforderung, der Eindämmung der Klimakrise.
- Außenministerin Annalena Baerbock
Deutsches Friedensengagement in der Tschadsee-Region
 "Bring back our girls" – die Schilder verzweifelter Eltern und Lehrkräfte nigerianischer Schülerinnen, die Opfer von Massenentführungen durch die Terrorgruppe Boko Haram wurden, haben sich tief ins visuelle Gedächtnis gebrannt. Die Tschadseeregion gilt als Zentrum der Aktivitäten terroristischer Gruppierungen.
"Bring back our girls" – die Schilder verzweifelter Eltern und Lehrkräfte nigerianischer Schülerinnen, die Opfer von Massenentführungen durch die Terrorgruppe Boko Haram wurden, haben sich tief ins visuelle Gedächtnis gebrannt. Die Tschadseeregion gilt als Zentrum der Aktivitäten terroristischer Gruppierungen.
Deutschland verzahnt seine humanitäre Hilfe, zivile Stabilisierungsmaßnahmen und Entwicklungszusammenarbeit, um einen Beitrag dazu zu leisten, der Region Stabilität und den Menschen Perspektive, Sicherheit und neue Lebensgrundlagen zu geben. Dafür steht auch das Dorf Ngarannam, das Außenministerin Baerbock besuchen wird. Es wurde 2015 bei einem Angriff von Boko Haram beinahe gänzlich zerstört und die Dorfgemeinde vertrieben. Deutschland hat es gemeinsam mit Partnern wieder aufgebaut. Dafür wurde die nigerianische Stararchitektin Tosin Osinowo engagiert, die den Wiederaufbau gemeinsam mit der Gemeinde plante. In Ngarannam spricht Außenministerin Baerbock mit Frauen, Schülerinnen und Gemeindemitgliedern über die Herausforderungen und die Rückkehr in ihr Heimatdorf.
Die Perspektiven von Frauen und der jungen Generation in den Blick zu nehmen, darum geht es auch bei Außenministerin Baerbocks Besuch der von Deutschland geförderten „Skills Academy“ in Nigerias Hauptstadt Abuja. Hier wird jungen Nigerianerinnen und Nigerianern eine duale Berufsausbildung im Bauwesen geboten.
Indonesien beruhigt Reisende bezüglich Strafen für unehelichen Sex
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Sonne auf Bali statt Schnee daheim? Nach zwei Pandemiejahren hofft Indonesien wieder auf Touristen. Ein Gesetz, das auch Haft für Sex außerhalb der Ehe vorsieht, soll dem offenbar nicht im Wege stehen...
Für die Würde, für die Freiheit, für die Menschenrechte: Deutsch-Französischer Preis für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit 2022
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt
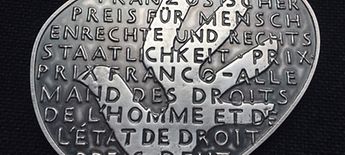
Außenministerin Baerbock sagte aus diesem Anlass:
Wir ehren heute Jina Mahsa Amini und die Menschen in Iran für ihr mutiges Engagement mit dem deutsch-französischen Menschenrechtspreis. Wir würdigen mit diesem Preis auch die Arbeit von 14 weiteren Aktivistinnen und Aktivisten, die sich weltweit für Menschenrechte und Rechtstaatlichkeit einsetzen – in Syrien, Belarus und Sudan. Gemeinsam mit unseren französischen Freundinnen und Freunden stehen wir fest an der Seite dieser mutigen Männer und Frauen.
Außenministerin Colonna sagte in ihrer Würdigung:
Frankreich und Deutschland sind entschlossen, die Frauen und Männer des Iran weiterhin in ihrem gerechten Kampf zu begleiten. Sie können auf Annalena Baerbocks und meine Unterstützung zählen. Und wir werden unser Engagement fortsetzen, um sicherzustellen, dass die Unterdrücker nicht unbehelligt bleiben.
Seit 2016 ehren Frankreich und Deutschland gemeinsam jährlich fünfzehn Persönlichkeiten oder Organisationen, die sich um die Menschenrechte verdient gemacht haben. Die Preisträger*innen leiten Nichtregierungsorganisationen, sie sind Anwält*innen, Journalist*innen oder verteidigen als Aktivist*innen die unveräußerlichen Rechte eines jeden Menschen. Sie treten für diejenigen ein, deren Stimmen ohne ihre wichtige Arbeit oftmals nicht gehört würden: Frauen, Überlebende sexueller Gewalt, LSBTIQ+-Personen, Inhaftierte, Kinder oder Wanderarbeiter*innen. Sie setzen sich ein für Gerechtigkeit, politische Teilhabe und unvoreingenommene Berichterstattung. Unter schwersten Bedingungen riskieren sie häufig ihre eigene Freiheit, oft sogar ihr Leben. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden gemeinsam von deutschen und französischen Auslandsvertretungen vorgeschlagen und ausgewählt. Die Preisträgerinnen und Preisträger 2022
Indonesien: Was das neue Gesetz für den Tourismus auf Bali bedeutet
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Sex zwischen nicht Verheirateten steht in dem südostasiatischen Land künftig unter Strafe. Menschenrechtler sind entsetzt, auch für Touristen könnte das Gesetz Folgen haben. In einem Reiseranking dürfte das Land schon bald floppen...
Verbot von außerehelichem Sex in Indonesien: Was das neue Gesetz für den Tourismus auf Bali bedeutet
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Sex zwischen nicht Verheirateten steht in dem südostasiatischen Land künftig unter Strafe. Menschenrechtler sind entsetzt, auch für Touristen könnte das Gesetz Folgen haben. In einem Reiseranking dürfte das Land schon bald floppen...
Zu Besuch bei einem Sechstel der Welt: Außenministerin Baerbock reist nach Indien
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

2023 wird Indien zum bevölkerungsreichsten Staat der Erde. Bereits jetzt gilt das Land als größte Demokratie der Welt und birgt eine unvergleichbare religiöse, kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt mit enormem Potential – für das Land selbst, für die gesamte indopazifische Region wie auch für die bilaterale Zusammenarbeit mit Deutschland.
Vor ihrer Abreise nach Neu-Delhi sagte Außenministerin Annalena Baerbock:
Dass Indien die Ausgestaltung der internationalen Ordnung im 21. Jahrhundert entscheidend beeinflussen wird – im Indo-Pazifik und darüber hinaus – ist ohne Zweifel. Und dass es Indien gelang, in den letzten 15 Jahren über 400 Millionen Menschen – fast so viele wie Menschen in der EU leben – aus absoluter Armut zu befreien, ist beeindruckend.
Damit zeigt es, dass gesellschaftliche Pluralität, Freiheit und Demokratie ein Motor für wirtschaftliche Entwicklung, Frieden und Stabilität sind. Daran gemeinsam mit der Stärkung der Menschenrechte weiter zu arbeiten, auch das ist unsere Aufgabe.
Globale Herausforderungen angehen, Multilateralismus stärken
Indien ist ein bedeutender Partner Deutschlands in Sachen Multilateralismus, Demokratie und für die Wahrung einer regelbasierten Ordnung auf Grundlage der Charta der Vereinten Nationen. Deutschland steht dabei fest an der Seite Indiens, das sich angesichts der aktuellen globalpolitischen Lage zahlreichen Herausforderungen ausgesetzt sieht. Dabei zeigt Indien mit Übernahme des G20-Vorsitzes zum 1. Dezember 2022 auch seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen für die dringendsten Aufgaben unserer Zeit.
Das Motto der indischen G20-Präsidentschaft lautet „Eine Erde, eine Familie, eine Zukunft“. In diesem Rahmen will Indien sich verstärkt für die Bereiche Klima und Umwelt einsetzen. Gleichzeitig will es sein Gewicht einbringen, um Staaten des sogenannten globalen Südens und deren Anliegen eine stärkere Stimme zu verleihen.
Gemeinsam für mehr Klimaschutz
Als zweitgrößter bilateraler Geber im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit unterstützt Deutschland Indiens Ambitionen beim Klima- und Umweltschutz bereits jetzt. Bis 2030 beabsichtigt Deutschland Indien bis zu 10 Milliarden Euro für Klimaschutz und Erneuerbare Energien im Rahmen der von Premierminister Modi und Bundeskanzler Scholz vereinbarten „Partnerschaft für Grüne und Nachhaltige Entwicklung“ („Green and Sustainable Development Partnership“) zur Verfügung zu stellen. Die Schwerpunkte der Zusammenarbeiter liegen auf grüner Mobilität, nachhaltiger Stadtentwicklung, Umweltschutz sowie der Energiewende. Vor allem letztere ist dringend notwendig, denn: Indien ist der weltweit viertgrößte CO2-Emittent.
Außenministerin Annalena Baerbock sagte:
Nicht nur in den G20, sondern auch zuhause für seine eigene Bevölkerung hat sich die indische Regierung ambitionierte Ziele gesetzt. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien will Indien die Energiewende stärker als bisher vorantreiben. Deutschland steht dabei an Indiens Seite. Denn die dramatischen Auswirkungen der Klimakrise treffen uns alle, zerstören Lebensgrundlagen in Europa wie in Indien.
Neben einem Gespräch mit ihrem indischen Amtskollegen, Außenminister Dr. Subrahmanyam Jaishankar, wird Außenministerin Baerbock bei ihrem Besuch in Indien auch den Gedenkort „Gandhi Smriti“ und die indische Wahlkommission besuchen, sowie Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft und NGOs, die sich für Frauenrechte einsetzen, führen. Die Lage von Minderheiten und Frauen in Indien steht, bei allen gesellschaftlichen Fortschritten der letzten Jahrzehnte, regelmäßig in der Kritik.
Darüber hinaus wird sie am trilateralen Indienforum des German Marshall Funds teilnehmen und dort auf einem Panel zum Thema Kooperation im Indopazifik sprechen. Außenministerin Baerbock wird ihren Besuch in Indien ferner dafür nutzen, die Zusammenarbeit im Bereich der Energiewende zu thematisieren. In diesem Zusammenhang wird sie auch Projekte für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit im ländlichen Umland von Neu-Delhi besichtigen.
2022 war ein schwieriges Jahr für die OSZE: Wie die Organisation mit der russischen Blockadepolitik umgeht und warum es sich lohnt, die Arbeit der OSZE zu unterstützen
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Russlands Kritik an der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) ist nicht neu. Das, was Russland an der Organisation stört, ist gerade das, was sie für viele andere Mitgliedsstaaten - darunter Deutschland - auszeichnet: sie ist ein bunter Zusammenschluss von 57 Staaten von Nordamerika über Europa bis nach Russland und Zentralasien, der dafür geschaffen wurde, Konflikte zu lösen und ein friedliches Zusammenleben für über eine Milliarden Menschen möglich zu machen. Ziel der OSZE ist es, die Sicherheit in Europa durch Zusammenarbeit zwischen den europäischen sowie den östlichen und westlichen Nachbarstaaten zu stärken. Dabei stützt sich die OSZE auf einen modernen Sicherheitsbegriff, der „drei Dimensionen“ umfasst: die politisch-militärische Dimension, die wirtschaftliche und ökologische Dimension, sowie die menschliche Dimension der Sicherheitspolitik. Immer wieder hat Russland die Arbeit der Organisation behindert, doch 2022 war es besonders schwierig.
Unterstützung für die Ukraine geht weiter - trotz Russlands Blockadepolitik
 Russland hat mit dem Krieg gegen die Ukraine Grundprinzipien des Völkerrechts und der OSZE verletzt, in der OSZE immer wieder Blockadepolitik betrieben (Beschlüsse in der OSZE werden einstimmig gefällt). Seit Herbst 2021 hat Russland zum Beispiel die Beendigung von drei OSZE-Missionen in der Ukraine erzwungen, darunter der Beobachtungsmission, die den Waffenstillstand im Donbass überwachen sollte. Drei lokale Mitarbeiter der OSZE sind in den von Russland besetzen Gebieten Luhansk und Donezk in Haft. Zwei davon wurden wegen Hochverrats in Verbindung mit ihrer Tätigkeit für OSZE zu mehr als 10 Jahren Haft verurteilt. Doch die OSZE hat Russlands Missbrauch der Konsenspolitik nicht einfach hingenommen, sie hält an der Unterstützung für die Menschen in der Ukraine fest.
Russland hat mit dem Krieg gegen die Ukraine Grundprinzipien des Völkerrechts und der OSZE verletzt, in der OSZE immer wieder Blockadepolitik betrieben (Beschlüsse in der OSZE werden einstimmig gefällt). Seit Herbst 2021 hat Russland zum Beispiel die Beendigung von drei OSZE-Missionen in der Ukraine erzwungen, darunter der Beobachtungsmission, die den Waffenstillstand im Donbass überwachen sollte. Drei lokale Mitarbeiter der OSZE sind in den von Russland besetzen Gebieten Luhansk und Donezk in Haft. Zwei davon wurden wegen Hochverrats in Verbindung mit ihrer Tätigkeit für OSZE zu mehr als 10 Jahren Haft verurteilt. Doch die OSZE hat Russlands Missbrauch der Konsenspolitik nicht einfach hingenommen, sie hält an der Unterstützung für die Menschen in der Ukraine fest.
Mit einem neuen Programm unterstützt die OSZE seit dem 1. November die Ukraine weiter bei ihren Reformen und beim Wiederaufbau des Landes. Damit führt die OSZE ihr vor mehr als 28 Jahren begonnenes Engagement zur Unterstützung der Ukraine fort und bleibt auch künftig in Kiew und der Ukraine präsent. OSZE Generalsekretärin Helga Schmid hat mit einer freiwilligen Staatengruppe, darunter Deutschland, und in enger Abstimmung mit den ukrainischen Partnern dieses neue Programm auf die Beine gestellt. Gegen die freiwillige Finanzierung außerhalb des regulären OSZE Budgets kann Russland kein Veto einlegen.
Deutschland setzt die Klimakrise auf die Agenda der OSZE
Vor einem Jahr hat die OSZE in Stockholm zum ersten Mal einen Kima Beschluss verabschiedet. Auf dieser Grundlage kann die OSZE jetzt klimapolitische Initiativen ins Leben rufen. Dieses Jahr beschäftigt sich die OSZE auf deutsche Initiative in Łódź mit dem Thema Klimawandel und Sicherheit in Bergregionen. Nächstes Jahr gehen wir als OSZE noch einen Schritt weiter und richten eine eigene OSZE Klimakonferenz in Wien aus. Deutschland ist davon überzeugt, dass die OSZE beim Kampf gegen den Klimawandel eine wichtige Rolle spielen kann. Die OSZE kann zum Beispiel grenzüberschreitende Projekte zu Frühwarnung, Austausch zu Extremwetter, Dürren und Ressourcenknappheit betreiben.
Treffen mit ODIHR: OSZE als wichtiger Player bei Wahlbeobachtungen
ODIHR (Office for democratic institutions and human rights) ist die zentrale Institution der OSZE im Bereich Menschenrechte. 1990 gegründet hilft sie allen OSZE Mitgliedstaaten bei der Umsetzung ihrer OSZE Verpflichtungen im Bereich Wahlen, Grundfreiheiten, Toleranz, oder Nichtdiskriminierung. Das passiert vor allem durch Beobachtermissionen, aber auch durch Beratungen bei Gesetzesentwürfen. Seit der Gründung von ODIHR gab es mehr als 400 solcher Wahlbeobachtungsmissionen. Dabei werden nicht nur die Geschehnisse am Wahltag und die Stimmauszählung unter die Lupe genommen, sondern auch der Wahlkampf, die Medien- und Meinungsfreiheit und die Wahlgesetzgebung. Die Ergebnisse werden der Öffentlichkeit in Berichten zur Verfügung gestellt. In Łódź trifft Außenministerin Baerbock zum ersten Mal den ODIHR Direktor Matteo Mecacci, um ihm Deutschlands Unterstützung zuzusichern.
Und wie geht es nun weiter mit der OSZE?
Deutschland wird die OSZE, die Generalsekretärin Helga Schmid und den Vorsitz, den 2023 Nordmazedonien übernimmt, weiter dabei unterstützen, dass die OSZE gut funktioniert.
Die OSZE steht für das Streben nach einen paneuropäischer Raum der Sicherheit, der Kooperation und der freien Selbstentfaltung für mehr als 1 Milliarde Menschen. Auch wenn dieses Ziel in diesem Jahr weit weg scheint, so dürfen wir gerade jetzt nicht zulassen, es aus den Augen zu verlieren und in unserer Unterstützung für die OSZE nachzulassen. Denn mit unzähligen Projekten zu Menschenrechten, zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität, gegen Drogen- und Menschenhandel, zur Förderungen der Geschlechtergerechtigkeit, der Rechtstaatlichkeit und der Meinungsfreiheit berührt diese einzigartige Organisation das Leben von Menschen in 57 Ländern. Dieses Erbe der Überwindung von Konfrontation und Konflikt werden wir entschlossen in die Zukunft tragen. - Außenministerin Annalena Baerbock
Was bedeutet menschliche Sicherheit?
Die menschliche Dimension umfasst Medienfreiheit, Minderheitenrechte, Toleranz, Nicht-Diskriminierung, Rechtsstaatlichkeit und die Bekämpfung von Antisemitismus. Diese Themen gelten als unverzichtbare Elemente des umfassenden Sicherheitsbegriffs der OSZE. Der Hohe Kommissar für nationale Minderheiten (HKNM) hat eine Frühwarnfunktion, um ethnischen Spannungen und Konflikten im OSZE-Raum rechtzeitig zu begegnen. Die Beauftragte für Medienfreiheit beobachtet die Entwicklung der Meinungs- und Medienfreiheit im OSZE-Raum und steht den Teilnehmerstaaten helfend zur Seite bei der Umsetzung entsprechender Verpflichtungen.
Das 5. Treffen der Nato-Außenministerinnen und Außenminister findet heute in Bukarest statt: Was steht auf der Agenda?
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Das 5. Treffen der NATO-Außenministerinnen und Außenminister für dieses Jahr findet in Rumänien statt. Von Bukarest sind es nur 250 Kilometer bis zur ukrainischen Grenze, wo Russland einen erbitterten Angriffskrieg gegen Ukrainerinnen und Ukrainer führt. 2022 geht nicht irgendein Jahr zu Ende, es ist das Ende eines Kriegsjahrs in Europa.
Russlands barbarischer Feldzug gegen den Freiheitswillen der Menschen in der Ukraine trifft uns ans Nachbarn, als Europäerinnen und Europäer aber auch als NATO. Nie zuvor war der Raum unserer Allianz so direkt gefährdet, nie zuvor wurde die Stärke unseres Bündnisses so herausgefordert – offen und verdeckt, mit Falschinformationen und Propaganda, mit Waffen und mit hybriden Attacken. Am Ende dieses Jahres sehen wir, und sehen die Menschen in den 30 Mitgliedstaaten, wie die NATO diese Prüfung besteht. Nie war unsere Allianz entschlossener, nie war der Schutz den sie verspricht greifbarer. - Außenministerin Annalena Baerbock
Solidarität und Unterstützung für die Ukraine- besonders im Winter
 In Bukarest werden die NATO Außenministerinnen und Außenminister darüber beraten, wie das Bündnis den Menschen in der Ukraine weiter beistehen kann. Der Fokus der NATO liegt auf praktischer Unterstützung im Verteidigungskampf gegen Russland, das beinhaltet Waffenlieferungen, aber auch humanitäre Hilfe, damit die Menschen durch den Winter kommen. Außenministerin Annalena Baerbock wird direkt mit ihrem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba darüber sprechen, was die Menschen in der Ukraine in diesem Moment am dringendsten benötigen. Deutschland wird in Bukarest weitere Mittel für den NATO-Treuhandfonds im Rahmen des Comprehensive Assistance Package (CAP) zusagen. Damit sollen weitere Generatoren, Treibstoff und Krankenwagen angeschafft und Projekte zur Minenräumung unterstützt werden.
In Bukarest werden die NATO Außenministerinnen und Außenminister darüber beraten, wie das Bündnis den Menschen in der Ukraine weiter beistehen kann. Der Fokus der NATO liegt auf praktischer Unterstützung im Verteidigungskampf gegen Russland, das beinhaltet Waffenlieferungen, aber auch humanitäre Hilfe, damit die Menschen durch den Winter kommen. Außenministerin Annalena Baerbock wird direkt mit ihrem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba darüber sprechen, was die Menschen in der Ukraine in diesem Moment am dringendsten benötigen. Deutschland wird in Bukarest weitere Mittel für den NATO-Treuhandfonds im Rahmen des Comprehensive Assistance Package (CAP) zusagen. Damit sollen weitere Generatoren, Treibstoff und Krankenwagen angeschafft und Projekte zur Minenräumung unterstützt werden.
Zusätzlich zu den NATO Beratungen in Bukarest hat die deutsche Außenministerin zu einem erweiterten Treffen der G7 eingeladen, bei dem es um die Notfallunterstützung der Ukraine bei der Wiederherstellung der gezielt durch Russland zerstörten Energieinfrastruktur gehen soll. Die Ministerinnen und Minister werden die dringendsten Bedürfnisse priorisieren und ihre Unterstützung miteinander abstimmen. Dabei wird es auch um die Stärkung der Fähigkeiten der Ukraine gehen, ihre Infrastruktur vor den russischen Angriffen zu schützen. Deutschland unterstützt die Ukrainerinnen und Ukrainer bereits mit mehr als 150 Millionen Euro im Kampf gegen die Kälte.
Bis Jahresende sollen etwa 300.000 Personen mit Decken, Matratzen und winterfester Kleidung, 75.000 Haushalte mit Heizungen und 50.000 weitere Haushalte mit Brennstoffen ausgestattet werden. Gemeinschaftsunterkünfte für 40.000 Menschen sollen winterfest gemacht und Wohnungen von 18.000 Haushalten gedämmt werden.
Bosnien, Georgien und Moldau zu Gast beim NATO-Treffen
Auch die Zukunft des Verteidigungsbündnisses wird Thema sein: Die Mitgliedsstaaten werden diskutieren, wie die NATO bei der Aufnahme von Schweden und Finnland vorankommt und wie das Verteidigungsbündnis die eigene Sicherheit vor Russland weiter verantwortungsvoll ausbauen kann. Darüber hinaus erwartet NATO eine Reihe von Gästen bei diesem Treffen. Seit dem 24. Februar sorgen sich weitere von unseren europäischen Nachbarn um ihre Sicherheit. An dem Treffen nehmen dieses Mal neben den Außenministern von Schweden und Finnland auch die Außenminister von Bosnien, Georgien und Moldau teil - drei Partner, die zunehmend unter russischen Druck geraten. Gemeinsam als NATO werden wir während des Treffens überlegen, wie wir diesen Ländern helfen können, ihre Unabhängigkeit zu schützen und ihre Fähigkeit zur Selbstverteidigung zu stärken.
Unterstützung für Moldau
Die Republik Moldau, das kleine Nachbarland der Ukraine, ist seit 1992 NATO-Partner. Die Unterstützung sieht unter anderem Beratung bei der Nationalen Sicherheitsstrategie, daraus abgeleiteten Verteidigungsplänen sowie langfristig Unterstützung bei der Streitkräftereform vor.
Moldau ist seit Monaten besonderen Herausforderungen ausgesetzt. Knapp 100.000 Ukrainerinnen und Ukrainern gab das Land ein vorübergehendes Zuhause. Die Republik Moldau ist zu 80 Prozent von russischem Gas abhängig und leidet nach drastischen Lieferkürzungen russischer Energieunternehmen zusätzlich unter einer schweren Energiekrise. Moldau ist zusätzlich direkt betroffen von jüngsten russischen Angriffen auf die ukrainische Energieinfrastruktur, da das Land mit dem ukrainischen Energienetz verbunden ist.
Im März dieses Jahres wurde in Berlin auf Initiative von Außenministerin Annalena Baerbock die sogenannte Unterstützungsplattform für Moldau gegründet. Wir lassen als europäische Familie die Mitglieder, die am stärksten und ganz direkt von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine getroffen und bedroht sind, nicht alleine.
Für eine minenfreie Welt – Deutschland übernimmt die Präsidentschaft für das Ottawa-Antipersonenminen-Übereinkommen
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Wie grausam Antipersonenminen töten, verstümmeln, verletzen und Lebensgrundlagen zerstören, müssen wir aktuell in der Ukraine und in Myanmar erleben. Die meisten Minenopfer sind Zivilisten, die Hälfte davon Kinder. Antipersonenminen wirken verheerend - selbst Jahre nach dem Ende von Kriegen und bewaffneten Konflikten. Der Einsatz dieser mörderischen und heimtückischen Waffen ist durch nichts zu rechtfertigen.
Was ist das Ottawa-Übereinkommen?
Das Übereinkommen zum Verbot von Antipersonenminen (unterzeichnet Ende 1997 in Ottawa) zeigt, dass wirksames Handeln auf internationaler Ebene möglich ist. Es ist eine der erfolgreichsten Konventionen der humanitären Rüstungskontrolle und hat das humanitäre Völkerrecht entscheidend weiterentwickelt. Im 25. Jubiläumsjahr des Übereinkommens übernimmt Deutschland nun dessen Präsidentschaft und wird während des gesamten Präsidentschaftsjahres bis zum Ende des Treffens der Vertragsstaaten im November 2023 inhaltliche Impulse setzen.
164 Staaten der Welt sind schon dabei, doch 32 Staaten fehlen noch. Die Bundesregierung wird sich mit Nachdruck dafür einsetzen, dass alle Staaten weltweit diesem wichtigen Vertrag beitreten, damit Antipersonenminen auf der Welt nie mehr eingesetzt werden. Im Rahmen der Präsidentschaft möchte die Bundesregierung außerdem dazu beitragen, den neuen Herausforderungen durch improvisierte Minen, die vor allem nicht-staatliche bewaffnete Gruppen einsetzen, besser zu begegnen. Zudem soll die Zusammenarbeit zwischen Minen-betroffenen und unterstützenden Staaten effektiver gestaltet werden.
Was macht Deutschland?
Deutschland nimmt schon lange im Kampf gegen Antipersonenminen international eine Vorreiterrolle ein und ist (nach EU und USA) weltweit einer der größten Förderer für humanitäres Minen- und Kampfmittelräumen sowie Opferfürsorge und Aufklärungsarbeit. 2022 werden Projekte in 13 Ländern und Regionen mit fast 60 Millionen Euro gefördert. Schwerpunktländer sind unter anderem Kolumbien, Südsudan und Sri Lanka, aber auch Afghanistan und Bosnien & Herzegowina.
 Bereits seit 2015 finanziert Deutschland auch Minenräumprojekte in der Ukraine. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat die Bundesregierung ihre Unterstützung dort ausgebaut und dieses Jahr bereits über 6,5 Millionen Euro für humanitäres Minen- und Kampfmittelräumen, Aufklärungsarbeit und Opferfürsorge bereitgestellt. Außerdem werden davon Minenräumer ausgebildet und ausgestattet. Unser Engagement werden wir fortsetzen – 2023 und darüber hinaus. Dazu haben wir uns als Unterzeichner der Konvention verpflichtet. Es ist ein wichtiges Element unserer humanitären Hilfe.
Bereits seit 2015 finanziert Deutschland auch Minenräumprojekte in der Ukraine. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat die Bundesregierung ihre Unterstützung dort ausgebaut und dieses Jahr bereits über 6,5 Millionen Euro für humanitäres Minen- und Kampfmittelräumen, Aufklärungsarbeit und Opferfürsorge bereitgestellt. Außerdem werden davon Minenräumer ausgebildet und ausgestattet. Unser Engagement werden wir fortsetzen – 2023 und darüber hinaus. Dazu haben wir uns als Unterzeichner der Konvention verpflichtet. Es ist ein wichtiges Element unserer humanitären Hilfe.
Das Ottawa-Übereinkommen beinhaltet die Hoffnung auf ein weltweites Ende des Leids durch Antipersonenminen. Die Bundesregierung wird sich im nächsten Jahr in besonderer Weise für die Erfüllung dieses Versprechens einsetzen.
Die Proteste in Iran halten an: Worum geht es heute bei der Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf?
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

 Deutschland hat gemeinsam mit 50 Partnern diese Sondersitzung zu den Menschenrechtsverletzungen im Zuge der landesweiten Proteste in Iran auf den Weg gebracht. Bei der heutigen Sitzung soll eine Resolution eingebracht werden, die Iran auffordert, die Repression und Gewalt gegen die eigene Bevölkerung einzustellen. In der angestrebten Resolution soll zudem eine unabhängige Untersuchungsmission beauftragt werden, die Menschenrechtsverletzungen in Iran im Zusammenhang mit den Protesten dokumentieren soll. Mit solch einem Aufklärungsmechanismus kann der Grundstein gelegt werden, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, indem Fakten über Menschenrechtsverletzungen nicht nur gesammelt, sondern auch für mögliche rechtliche Prozesse aufgearbeitet werden. Damit die Menschenrechtsverletzungen in Iran nicht im Dunkeln bleiben, damit diejenigen, die Menschen und Menschenrechte in Iran mit Füßen treten, nicht denken, dies habe keine Konsequenzen.
Deutschland hat gemeinsam mit 50 Partnern diese Sondersitzung zu den Menschenrechtsverletzungen im Zuge der landesweiten Proteste in Iran auf den Weg gebracht. Bei der heutigen Sitzung soll eine Resolution eingebracht werden, die Iran auffordert, die Repression und Gewalt gegen die eigene Bevölkerung einzustellen. In der angestrebten Resolution soll zudem eine unabhängige Untersuchungsmission beauftragt werden, die Menschenrechtsverletzungen in Iran im Zusammenhang mit den Protesten dokumentieren soll. Mit solch einem Aufklärungsmechanismus kann der Grundstein gelegt werden, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, indem Fakten über Menschenrechtsverletzungen nicht nur gesammelt, sondern auch für mögliche rechtliche Prozesse aufgearbeitet werden. Damit die Menschenrechtsverletzungen in Iran nicht im Dunkeln bleiben, damit diejenigen, die Menschen und Menschenrechte in Iran mit Füßen treten, nicht denken, dies habe keine Konsequenzen.
Worauf kommt es heute an?
 Die Resolution kann per einfacher Mehrheit (also mehr „Ja“ als „Nein“ Stimmen) der 47 Mitglieder des Rates angenommen werden. In den letzten Tagen und Wochen haben wir hart dafür gekämpft, dass diese Resolution angenommen wird, denn Mehrheiten im Menschenrechtsrat sind keine Selbstverständlichkeit. Gerade deshalb ist es so wichtig, dass Deutschland hier genau hinsieht, für die unteilbaren Rechte eines jeden Menschen in diesem Forum eintritt und eben bei Partnern weltweit für die Annahme dieser Resolution wirbt.
Die Resolution kann per einfacher Mehrheit (also mehr „Ja“ als „Nein“ Stimmen) der 47 Mitglieder des Rates angenommen werden. In den letzten Tagen und Wochen haben wir hart dafür gekämpft, dass diese Resolution angenommen wird, denn Mehrheiten im Menschenrechtsrat sind keine Selbstverständlichkeit. Gerade deshalb ist es so wichtig, dass Deutschland hier genau hinsieht, für die unteilbaren Rechte eines jeden Menschen in diesem Forum eintritt und eben bei Partnern weltweit für die Annahme dieser Resolution wirbt.
Und was wäre neu an so einem Aufklärungsmechanismus?
Es gibt bereits einen UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in Iran, Javaid Rehman. Dieser hat alle Hände voll zu tun, um eine Reihe von Menschenrechten in Iran zu überwachen und darüber zu berichten. Sein Mandat umfasst außerdem zum Beispiel nicht die forensische Analyse und die Aufbereitung von Beweismitteln für die Zulässigkeit bei rechtlichen Verfahren. Sollten die Mitglieder des Menschenrechtsrats heute die Resolution annehmen, wird dieser Aufklärungsmechanismus das Mandat des Sonderberichterstatters, da wo Lücken sind, ergänzen.
Wie kommt eine Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrats zustande?
Um eine Sondersitzung des MRR zu beantragen, sind die Stimmen von mindestens 16 Staaten (Mitglieder des Menschenrechtsrats und Staaten mit Beobachterstatus) nötig. Sondersitzungen des UN-Menschenrechtsrats sind selten. Dieses Jahr gab es nur eine weitere Sondersitzung des Rats im Mai nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Es ist insgesamt die 35. Sondersitzung des Menschenrechtsrats. Die Sondersitzung zu Iran hat Deutschland unter anderem gemeinsam mit Argentinien, der Tschechischen Republik, Finnland, Frankreich, Japan, Litauen, Luxemburg, Mexiko, Montenegro, Niederlande, Paraguay, Korea, Ukraine, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Island, Albanien, Andorra, Österreich, Australien, Belgien, Kanada, Kolumbien, Costa Rica, Kroatien, Zypern, Dänemark, Estland, Irland, Lettland, Liechtenstein, Malta, Monaco, Neuseeland, Norwegen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien und Schweden beantragt.
Zu Besuch beim engsten Freund: Außenministerin Annalena Baerbock reist nach Paris
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Außenministerin Annalena Baerbock reist am Sonntag (20.11.) nach Paris und wird dort am Montag (21.11.) ihre französische Amtskollegin Catherine Colonna treffen. Außerdem wird sie an der dritten Moldau Unterstützungskonferenz teilnehmen.
Mit keinem anderen Land haben wir eine so enge Bindung wie mit Frankreich. Mit keinem anderen Land stimmen wir uns so eng ab. Unsere Freundschaft mit Frankreich ist Kern unserer politischen Identität. - Außenministerin Baerbock
Die deutsch-französischen Beziehungen gehen aber weit über die politische Ebene hinaus: Vom gemeinsamen Fernsehsender ARTE, über den AbiBac Schulabschluss bis zu über 2.300 deutsch-französische Partnerschaften zwischen Städten, Bundesländern und Regionen sind es die Menschen, die die Freundschaft beider Länder mit Leben füllen. Die Außenministerinnen Annalena Baerbock und Catherine Colonna werden daher am Vormittag mit Schülerinnen und Schülern eines Pariser Gymnasiums über die Zukunft der deutsch-französischen Freundschaft und der Europäischen Union sprechen.
Trotz unserer gemeinsamen Geschichte, geprägt von Leid, Krieg und bitterer Konkurrenz, sind die Menschen auf beiden Seiten des Rheins heute in unserem gemeinsamen Europa so eng vernetzt und verwoben, dass es ohne einander eigentlich gar nicht mehr geht. Dass es trotz aller kulturellen Unterschiede diese menschliche Nähe und Herzlichkeit gibt, ist ein grandioser Erfolg und bleibt das Fundament unserer Zusammenarbeit. - Außenministerin Baerbock vor ihrer Abreise nach Paris.
Im Schulterschluss für die Europäische Friedensordnung
Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine steht die europäische Friedensordnung buchstäblich jeden Tag unter Beschuss. Millionen Menschen aus der Ukraine mussten Schutz außerhalb ihres Landes suchen. Dabei ist die Republik Moldau, das kleine Nachbarland der Ukraine, seit Monaten besonderen Herausforderungen ausgesetzt. Knapp 100.000 Ukrainerinnen und Ukrainer gab das Land ein vorübergehendes Zuhause.
Die Republik Moldau ist zu 80 Prozent von russischem Gas abhängig und leidet nach drastischen Lieferkürzungen russischer Energieunternehmen zusätzlich unter einer schweren Energiekrise. Im Zuge der ersten Moldau-Konferenz im März diesen Jahres in Berlin wurde auf Initiative von Außenministerin Annalena Baerbock die sogenannte Unterstützungsplattform für Moldau gegründet, eine weitere Konferenz in Bukarest folgte.
Am Montag richtet Frankreich nun die dritte Moldau Unterstützungskonferenz aus. Sie bietet den internationalen Partnern einen Rahmen, um das Land dort zu unterstützen, wo es am nötigsten ist, sowie über die konkrete Notlage hinauszublicken und die langfristigen Bedürfnisse der Republik Moldau, zum Beispiel im Hinblick auf ihre Sicherheit, anzugehen.
Japan wieder offen für Touristen: So fühlt sich das Leben in Tokio an
, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise
Mehr als zwei Jahre hatte sich die Inselnation abgeschottet, seit Kurzem dürfen ausländische Touristen fast unbeschränkt wieder einreisen. Noch kommen wenige. Wie sich die Hauptstadt jetzt anfühlt...
Viele Themen zu besprechen: Außenministerin Baerbock beim monatlichen Treffen der EU-Außenministerinnen und Außenminister in Brüssel
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Unterstützung der Ukraine und strategischer Blick nach vorne
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine bestimmt weiterhin die Gespräche der Außenministerinnen und Außenminister. Russland zerstört mit Blick auf den nahenden Winter weiter gezielt Wasserwerke, das Stromnetz und die Wärmeversorgung in der Ukraine. Daher wird es beim EU-Außenrat zusätzlich zu einer Diskussion zur aktuellen Lage insbesondere darum gehen, die vor zehn Tagen beim G7-Außenministertreffen in Münster beschlossene Hilfe beim Wiederaufbau der kritischen Wasser- und Energieinfrastruktur im EU-Kreis umzusetzen. Auch über zusätzliche Sanktionen und weitere militärische Unterstützung soll beraten werden.
Beim informellen „Gymnich“-Treffen der EU-Außenministerinnen und Außenminister in Prag am 31. August hatten Deutschland und Frankreich eine Debatte zum weiteren strategischen Umgang der EU mit Russland angestoßen. Sicherheit in Osteuropa wird es auf absehbare Zeit nicht mit Russland, sondern nur vor Russland geben. Aufbauend auf die Beratungen im August hat der Hohe Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik hierzu eine Orientierungsdebatte angesetzt.
Neue EU Strategie für die Große-Seen-Region
Im zweiten Tagesordnungspunkt befassen sich die EU-Außenministerinnen und Außenminister mit der fragilen Lage in Ostkongo. In den letzten Wochen ist die Gewalt zwischen Regierungstruppen und verschiedene Rebellengruppen im Osten der Demokratischen Republik Kongo weiter eskaliert. Beim Außenrat werden die Teilnehmer über die aktuelle Lage vor Ort beraten und über das Engagement der Europäischen Union zur Befriedung der Region diskutieren. Dabei soll auch die grundsätzliche EU-Strategie für die sog. Große-Seen-Region, die neben der Demokratischen Republik Kongo auch Ruanda, Burundi und Uganda umfasst, gehen.
Spannungen zwischen Serbien und Kosovo
Auf Bitten Deutschlands befasst sich der EU-Außenrat auch mit den aktuellen Spannungen zwischen Serbien und Kosovo. Der Sondergesandte der Bundesregierung, Manuel Sarrazin, ist zuletzt am 6. November zu Vermittlungsgesprächen in die Region gereist; die Erkenntnisse aus seiner Reise sowie aus den Gesprächen des EU-Sondergesandten Miroslav Lajčák werden im Fokus der Beratungen stehen. Daneben wird es auch um jüngst erzielte Fortschritte in der Region gehen: Die Außenminister der sechs Westbalkanstaaten haben sich bei einem Treffen am 21. Oktober 2022 im Auswärtigen Amt auf die Unterzeichnung von drei zentralen Mobilitätsabkommen zur Schaffung eines Gemeinsamen Regionalen Markts verständigt. Diese waren über einen längeren Zeitraum wegen Differenzen zwischen Serbien und Kosovo blockiert und konnten durch intensive Verhandlungen in Berlin ausgeräumt werden. Die Vereinbarungen wurden beim Westbalkan-Gipfel am 3. November 2022 im Bundeskanzleramt unterzeichnet. Die Aussprache dient auch bereits der Vorbereitung des jährlichen EU-Westbalkan Gipfels, der am 06. Dezember in Tirana stattfinden wird.
Iran, Libanon, EU-CELAC Beziehungen und aktuelle Entwicklungen bei der COP27
Die Außenministerinnen und Außenminister werden sich darüber hinaus mit weiteren aktuellen Themen befassen. Dazu zählt auf Vorschlag Deutschlands auch die weitere Reaktion der EU auf die Lage in Iran. Ein weiteres Sanktionspaket in Verbindung mit schweren Menschenrechtsverletzungen ist in Vorbereitung. Darüber hinaus stehen Beratungen über die Lage in Libanon und den Stand der EU-Beziehungen zur Gemeinschaft Lateinamerikanischer und Karibischer Staaten (CELAC) an. In dem Regionalverband sind 33 Staaten Zentral- und Südamerikas organisiert. Der aktuelle Stand bei den Klimaverhandlungen auf der COP-27-UN-Klimakonferenz, die seit dem 6. November 2022 im ägyptischen Sharm el-Sheikh stattfindet, wird ebenfalls ein Thema sein.
Informelles Frühstück mit der belarussischen Oppositionsführerin Tichanowskaja
Noch vor Beginn des Außenrates lädt der Hohe Vertreter zu einem informellen Frühstück mit der belarussischen Oppositionsführerin Tichanowskaja. Dabei wird es um die aktuelle Lage in Belarus und die Solidarität der Europäischen Union mit der Demokratiebewegung im Land gehen.
Der „Rat für Auswärtige Angelegenheiten" (RfAB) ist zuständig für das außenpolitische Handeln der EU, was die Bereiche der Außen‑, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, den Handel, die Entwicklungszusammenarbeit und die humanitäre Hilfe umfasst. Er hat vor allem die Aufgabe, gemeinsam mit der Europäischen Kommission und unter Einbindung des Hohen Vertreters der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, ein einheitliches und koordiniertes außenpolitisches Handeln der EU sicherzustellen. Der RfAB tagt in der Regel einmal im Monat.
Treffen der G7-Außenministerinnen und -Außenminister in Münster vom 03. bis 04. November 2022
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Auf der Agenda des Treffens stehen aktuelle geopolitische Herausforderungen, insbesondere der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und seinen globalen Folgen.
Darüber hinaus werden die G7-Außenministerinnen und –Außenminister auch über einen zeitgemäßen Umgang mit China, die Region Indo-Pazifik, die Lage der Menschen in Iran sowie mögliche Formen der Zusammenarbeit mit Zentralasien sprechen.
Die G7 gehen die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts dabei nicht alleine an, sondern mit demokratischen Partnern weltweit.
Als Gäste nehmen am zweiten Tag des Treffens daher auch die Afrikanische Union sowie die Außenministerin Ghanas und der Außenminister Kenias teil. Dabei wird es dann insbesondere um die Sicherheitslage im Sahel oder am Horn von Afrika gehen, um gemeinsame Lösungsansätze für die Klimakrise, und die Ernährungs- und Energiesicherheit.
Warum Münster als Tagungsort?
Der Westfälische Frieden ist eine der Geburtsstunden des modernen Völkerrechts, grundlegende Konzepte, wie die Gleichheit und Souveränität der Staaten, wurden hier das erste Mal in einem großen Friedensabkommen verhandelt. Dieses Erbe müssen wir bewahren. Deswegen habe ich diesen symbolischen Ort in dieser schwierigen Zeit ganz bewusst als Tagungsort gewählt.
- Außenministerin Baerbock im Interview mit den Westfälischen Nachrichten.
Falls Sie mehr darüber wissen wollen, was die G7 –Außenministerinnen und –Außenminister unter deutschem G7-Vorsitz bewegen wollen: Das ganze Interview mit Außenministerin Annalena Baerbock finden Sie unter diesem Link.
Download Fotos*
photothek.de/upload/MwbB8gxqCN
*Fotos des Host-Photographers (Agentur „Photothek“) werden hier in Druckqualität (300 dpi) bereitgestellt und können kostenfrei unter Angabe des copyright (photothek.de/Auswärtiges Amt) verwendet werden.
Download Videos*
my.hidrive.com/share/vyoo8cj4cy#$/
*Das Bildmaterial des Host-Broadcasters wird hier zur kostenfreien Verwendung bereitgestellt.
Presseprogramm
Hier finden Sie das vorläufige Presseprogramm.
Interview
Interview von Außenministerin Annalena Baerbock zu G7
Außenministerin Baerbock reist nach Kasachstan und Usbekistan
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

 Außenministerin Baerbock reist vom 30.10. bis 02.11. nach Kasachstan und Usbekistan. Stationen ihrer Reise sind die beide Hauptstädte Astana und Taschkent sowie die usbekische Stadt Samarkand.
Außenministerin Baerbock reist vom 30.10. bis 02.11. nach Kasachstan und Usbekistan. Stationen ihrer Reise sind die beide Hauptstädte Astana und Taschkent sowie die usbekische Stadt Samarkand.
Spätestens seit Beginn von Russlands Krieg gegen die Ukraine sehen sich die Staaten Zentralasiens zwischen allen Stühlen. Sie müssen fürchten, zur Verfügungsmasse Russlands einerseits und Chinas andererseits zu werden.
Zentralasien bietet enorme Chancen
 Usbekistan mit seinen mehr als 35 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern hatte 2021 ein Wirtschaftswachstum von 7,4 %. Kasachstan hat enorme Ausbaumöglichkeiten für die Wasserstoffwirtschaft und seit Jahrzehnten enge wirtschaftliche Verbindungen mit Deutschland. 85 % des deutschen Handels mit den Staaten Zentralasiens entfallen auf Kasachstan.
Usbekistan mit seinen mehr als 35 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern hatte 2021 ein Wirtschaftswachstum von 7,4 %. Kasachstan hat enorme Ausbaumöglichkeiten für die Wasserstoffwirtschaft und seit Jahrzehnten enge wirtschaftliche Verbindungen mit Deutschland. 85 % des deutschen Handels mit den Staaten Zentralasiens entfallen auf Kasachstan.
Deutschland und Europa machen ehrliche und faire Angebote, die gerade nicht neue Abhängigkeiten schaffen oder auf finanzielle Knebel setzen.
Außenministerin Baerbock unterstrich:
Mir ist wichtig, dass die Zukunft für sie nicht nur die Wahl zwischen der engen Zwangsjacke im Vorhof von Russland und der Abhängigkeit von China bereithält. Ich will in Kasachstan und Usbekistan deshalb vor allem zuhören, welche Hoffnungen und Erwartungen die Menschen in dieser Situation an Europa richten.
Klimakrise mit massiven Auswirkungen auf die Region
Beide Länder sind massiv vom Klimawandel bedroht. Besonders Usbekistan muss in Anbetracht eines Temperaturanstiegs um 2-3 Grad Celsius in den nächsten 50 Jahren massive Ernährungsunsicherheit fürchten. Außenministerin Baerbock besucht daher auch Projekte, die die Energiewende in Kasachstan und Usbekistan voranbringen sollen sowie ein Projekt zur nachhaltigen Bewässerung in Samarkand.
Zudem spricht sie in beiden Ländern mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft. Hierzu betone die Außenministerin:
Wirtschaftliche Entwicklung und Menschenrechte sind zwei Seiten derselben Medaille. Weil der beste Investitionsschutz für Unternehmen verlässliche Regeln sind und weil nachhaltiger Wohlstand und Sicherheit nur dort gelingt, wo die Rechte von Menschen gewahrt sind.
Trotz russischem Widerstand: OSZE setzt Unterstützung der Ukraine fort
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Mit einem neuen Programm unterstützt die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ab dem 1. November 2022 die Ukraine weiter bei ihren Reformen und beim Wiederaufbau des Landes. Damit führt die OSZE ihr vor mehr als 28 Jahren begonnenes Engagement zur Unterstützung der Ukraine fort und bleibt auch künftig in Kiew und der Ukraine präsent, während sich das Land gegen den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg zur Wehr setzt.
Mit deutscher Unterstützung: Zusammenschluss Gleichgesinnter gegen russische Blockadeversuche
Russland hatte unter Missbrauch des sog. OSZE Konsensprinzips - das heißt, dass bei allen Entscheidungen immer alle Mitgliedsstaaten zustimmen müssen - das Ende der bisherigen OSZE Missionen und Projektaktivitäten in der Ukraine erzwungen.
Daher hat OSZE Generalsekretärin Helga Schmid mit einer freiwilligen Staatengruppe, darunter Deutschland, und in enger Abstimmung mit den ukrainischen Partnern ein neues Programm auf die Beine gestellt, so dass die vielfältige OSZE Projektarbeit in der Ukraine weitergehen kann. Gegen die freiwillige Finanzierung außerhalb des regulären OSZE Budgets kann Russland kein Veto einlegen.
Kriegsfolgen, Rechtsstaat und Menschenrechte im Fokus
Was wird konkret gemacht? Fast 80 nationale und internationale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Programms unterstützen die Menschen sowie staatliche Stellen in der Ukraine bei der Bewältigung von ganz unmittelbaren Kriegsfolgen. Wo ist die humanitäre Not am größten? Wie kann vom Krieg traumatisierten Ukrainerinnen und Ukrainern psychologisch beigestanden werden und ihnen Zugang zu rechtlicher Beratung ermöglicht werden? Wie können weitere Kapazitäten bei der Entminung geschaffen werden, damit sich die Menschen wieder sicher in ihrer Heimat bewegen können? Das sind nur einige der vielen Maßnahmen, welche die OSZE jetzt weiterführen kann. In weiteren Projekten geht es darum, eine freie und unabhängige Medienberichterstattung zu fördern, Menschenhandel zu bekämpfen, Polizei, Staatsanwaltschaften und Richterinnen sowie Richter weiterzubilden. Viele der äußerst vielfältigen Projektaktivitäten sind trotz des andauernden Krieges möglich und angesichts der äußerst schwierigen Lage für die Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt auch wichtiger denn je.
Möglich wird das auch dank eines großen deutschen Beitrags: Das Auswärtige Amt fördert das neue OSZE-Programm für die Ukraine jetzt mit 2,5 Millionen Euro.
Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) umfasst 57 Teilnehmerstaaten von Nordamerika bis Zentralasien. Sie setzt sich für Frieden, Sicherheit und Dialog ein. Ihre Wurzeln hat sie in der Schlussakte von Helsinki, der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die half, den Kalten Krieg zu überwinden.
Durch stete Weiterentwicklung ist die OSZE auch heute ein zentraler Akteur für die umfassende Sicherheit der Region. Durch vertrauensbildende Maßnahmen und Dialog fördert sie Zusammenarbeit und hilft, Spannungen zwischen Staaten abzubauen.
Für ihre Beschlüsse gilt das Konsensprinzip – somit kann bereits ein Teilnehmerstaat Entscheidungen verhindern. Im Idealfall sorgt aber der erreichte Kompromiss dafür, dass sich alle in einem Beschluss wiederfinden.
Westbalkan Konferenz in Berlin: Damit die Region weiter zusammenwächst
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

In diesem Jahr stehen die Schlüsselthemen Grüne Agenda, Klima, Energie und Energiesicherheit sowie der Aufbau des Gemeinsamen Regionalen Marktes im Fokus. Zum Gemeinsamen Regionalen Markt haben die sechs Westbalkanstaaten in den letzten Wochen unter Moderation des Sondergesandten der Bundesregierung, Manuel Sarrazin, intensive Verhandlungen im Auswärtigen Amt geführt. Dabei geht es um den Abschluss von regionalen Mobilitätsvereinbarungen zur Reisefreiheit mit Personalausweisen und zur Anerkennung von akademischen Diplomen und Berufszeugnissen. All dies sind wichtige Schritte, die das Leben der Menschen in der Region konkret verbessern würden und die wirtschaftliche Entwicklung der Region begünstigen.
Zivilgesellschaft mit dabei
Weitere Teilnehmer sind auch der Regional Cooperation Council (RCC), des Regional Youth Cooperation Office (RYCO) und Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft. RYCO führt seit einem Jahr ein umfangreiches Schulaustauschprojekt durch (Superschools), an dem über 800 Schülerinnen und Schüler teilnahmen. Einige von ihnen werden im Rahmen des Außenministertreffens zur Versöhnungsarbeit der Jugend in der Region berichten.
Teil des Berlin Prozesses hin zum Gipfeltreffen im November
Im Weltsaal des Auswärtigen Amts werden neben den sechs Westbalkanstaaten auch die EU, die tschechische EU-Ratspräsidentschaft, Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Kroatien, Österreich, Polen und Slowenien teilnehmen. Neben dem Außenministertreffen findet in diesem Jahr in Berlin auch ein Treffen der Innenministerinnen und Innenminister am 20. Oktober sowie der Wirtschafts- und Energieministerinnen und Energieminister am 24. Oktober statt. Es gibt zudem ein Zivilgesellschafts- und ein Jugendforum. Den Abschluss bildet das Gipfeltreffen auf Einladung von Bundeskanzler Olaf Scholz am 3. November.
Prozess seit 2014
Der 2014 ins Leben gerufene Berliner Prozess hat sich zum Ziel gesetzt, die regionale Integration im und mit dem westlichen Balkan zu stärken und zu vertiefen. Eine bessere regionale Zusammenarbeit bleibt der Schlüssel zu Wirtschaftswachstum und zu Frieden in der Region. Der Berliner Prozess soll auch die Heranführung der gesamten Region an die EU beschleunigen. Dabei konzentriert er sich auf Felder wie Infrastrukturentwicklung, Wirtschaft, regionale Jugendaustausch, Versöhnung und Wissenschaft. Bisherige Erfolge des Berliner Prozesses sind u.a. die Schaffung des Regionalen Jugendwerks RYCO (Regional Youth Cooperation Office), das regionale Roaming-Abkommen und die Einrichtung sog. Green Lanes, die eine beschleunigte Abfertigung von wichtigen Gütern in Zeiten der Corona-Pandemie an den Grenzen erlaubten.
„Zusammen sind wir stärker als dieser Krieg“ – Außenministerin Baerbock beim Berliner Forum Außenpolitik
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Auch das Berliner Forum Außenpolitik stand in diesem Jahr unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Eingeladen waren neben Außenministerin Baerbock unter anderem ihr estnischer Amtskollege, Urmas Reinsalu.
 „Die Solidarität in Europa ist die Antwort Europas auf diesen Krieg“, betonte Außenministerin Baerbock bei ihrer Rede auf dem Forum: „Zusammen sind wir stärker als dieser Krieg“. Sie unterstrich, dass Deutschland jeden Zentimeter des gemeinsamen NATO-Bündnisgebiets verteidigen werde. „Wir sind für Euch da.“ – war ihre Botschaft in Richtung der Menschen in Mittel- und Osteuropa sowie im Baltikum. „Die Sicherheit des Baltikums, die Sicherheit Osteuropas ist Deutschlands Sicherheit“, hob die Außenministerin hervor.
„Die Solidarität in Europa ist die Antwort Europas auf diesen Krieg“, betonte Außenministerin Baerbock bei ihrer Rede auf dem Forum: „Zusammen sind wir stärker als dieser Krieg“. Sie unterstrich, dass Deutschland jeden Zentimeter des gemeinsamen NATO-Bündnisgebiets verteidigen werde. „Wir sind für Euch da.“ – war ihre Botschaft in Richtung der Menschen in Mittel- und Osteuropa sowie im Baltikum. „Die Sicherheit des Baltikums, die Sicherheit Osteuropas ist Deutschlands Sicherheit“, hob die Außenministerin hervor.
Deutschland werde die Ukraine weiterhin intensiv auch mit Waffen unterstützen, so Ministerin Baerbock: "Denn wir liefern eben nicht nur Rüstungsgüter in die Ukraine, um Menschenleben zu retten. Sondern mit diesen Lieferungen, so hoffe ich, geht auch ein Schub Vertrauen und Solidarität einher."
„Sicherheit“ umfassend denken – Resilienz unserer Gesellschaften
In ihrer Rede unterstrich die Ministerin zudem, wie wichtig es ist, einseitige wirtschaftliche Abhängigkeiten zu vermeiden. Dies sei eine Lehre aus den Fehlern der Russlandpolitik der vergangenen Jahre. In der nationalen Sicherheitsstrategie werde die Resilienz unserer Volkswirtschaften und Gesellschaften Niederschlag finden, kündigte die Außenministerin an.
Lesen Sie hier die Rede der Außenministerin:
„Diese toten Schülerinnen in der Ukraine. Das hätten auch wir sein können.“
Das hat eine 18-jährige estnische Schülerin gesagt, die ich im April in einem Gymnasium in Tallinn getroffen habe.
Diese Worte hatte ich im Kopf, als ich drei Wochen später, am 10. Mai in Butscha war. Ein Vorort von Kiew, ein Vorort ähnlich wie Potsdam von Berlin.
„Das hätten auch wir sein können.“ – Dieses Gefühl hat mich im Butscha bis ins Mark erschüttert.
Dieses Gefühl hat die Schülerin aus Tallinn von der ersten Sekunde dieses brutalen russischen Angriffskrieges auf die Ukraine gespürt. Um das zu verstehen, muss man sich vor Augen halten, dass sie anders aufgewachsen ist als 18-jährige in Berlin, Bochum oder Braunschweig.
Sie wurde 2004 geboren, in dem Jahr, in dem Estland und neun weitere mittel- und osteuropäische Länder der Europäischen Union beigetreten sind. Nach Jahrzehnten der Spaltung in Ost und West war das ein Glücksmoment unserer gemeinsamen europäischen Geschichte. Und für uns Deutsche schien es damals wie selbstverständlich, dass die Generation dieser neuen EU in Wohlstand, Freiheit und Frieden aufwachsen würde.
Aus Sicht vieler Menschen und auch vieler Jugendlichen aus Ost- und Mitteleuropa war 2004 vor allen Dingen ein Versprechen: Ihr seid sicher!
Denn zum einen ist die Aufarbeitung von Unterdrückung, Deportation und Diktatur in diesen Ländern bis heute präsent.
Der Ruf nach historischer Wahrheit hat im Baltikum schon vor 1989 die Menschen mobilisiert. Nach dem Ende des Kalten Krieges konnte über diese Themen endlich frei gesprochen und erinnert werden. Und die Narben der Verbrechen aus der Sowjetzeit sind im kollektiven Gedächtnis der Menschen bis heute nicht verheilt.
Zum anderen ist das Gefühl der Bedrohung durch Russland in Mittel- und Osteuropa nie weg gewesen, auch vor dem 24. Februar nicht. Dein Land, lieber Urmas, ist bereits 2007 zur Zielscheibe einer der größten Cyberattacken Europas geworden. Du weißt, was es heißt, wenn Trolle eine ganze Gesellschaft zu spalten versuchen.
Und auch wenn man nach Litauen schaut, dann versteht man diese unmittelbare Bedrohung. Auf den Suwalki-Korridor, die einzige Landverbindung der baltischen Staaten mit den übrigen NATO-Alliierten. 65 Kilometer Nadelöhr zwischen Belarus und Russland.
Als ich im April in Litauen war, habe ich beim Blick auf diese Karte noch einmal mehr verstanden, was dieser Satz heißt: „Das hätten auch wir sein können“. Der Horror der russischen Panzer war und ist dort zum Greifen nah.
Unsere östlichen Nachbarstaaten teilen deshalb ein tiefes Bedürfnis nach Sicherheit. Eine Sicherheit, die wir in Deutschland nach 1990 manchmal als allzu selbstverständlich erachtet und in die wir deswegen zu wenig investiert haben.
Die Friedensunion Europa, das Sicherheitsversprechen 2004, schien für viele von uns in Deutschland einfach so vom Himmel zu fallen. Unsere östlichen Nachbarstaaten wissen, was es heißt, wirklich in Frieden leben zu können. Dass man auch in diesen Frieden investieren muss.
Und deshalb habe ich sehr gut verstanden, dass die Schülerin noch eine zweite Frage hatte, auch wenn sie mich schmerzt. Sie hat gefragt: „Können wir uns auf Deutschland verlassen?“
Diese Frage höre ich immer wieder. Nicht nur von Schülerinnen und Schülern aus Osteuropa, sondern auch von meinen estnischen und polnischen Amtskollegen.
Und ich habe diese Frage auch gehört, als ich die 87-jährigen Wanda Traczyk-Stawska am 3. Oktober in Warschau getroffen habe, auf dem Friedhof der Toten des Warschauer Aufstandes von 1944.
Sie hat den Warschauer Aufstand überlebt. Aber sie hat auch selbst zur Waffe gegriffen, um sich vor den Gräueltaten der Nationalsozialisten zu schützen. Auch sie hat gefragt: „Können wir uns auf Deutschland verlassen? Können wir darauf vertrauen, dass die Bundesrepublik Deutschland unsere ukrainischen Freunde und Nachbarn schützt, die jetzt das erleben müssen, was ich 1944 erleben musste? Dass Deutschland, dass ihr, auch wenn der Winter hart wird, diese Menschen weiter schützt?“
Ich erwähne das hier, weil mich diese Fragen tief bewegen – als Außenministerin, aber auch als deutsche Staatsbürgerin, als Mutter, als Mensch und weil ich als Außenministerin eine Verantwortung trage.
Diese Fragen nicht nur einfach mit einem einfachen Ja zu beantworten, daran arbeite ich: Dass wir Vertrauen schaffen, dass 18-jährige der nächsten deutschen Außenministerin nicht mehr diese Frage stellen müssen.
Und daher sage ich hier in Berlin klar und deutlich, was ich in Tallinn, was ich in Warschau und was ich gestern beim Rat der Außenministerinnen und Außenminister in Luxemburg gesagt habe: Ja, wir sind für euch da. Die Sicherheit des Baltikums, die Sicherheit Osteuropas ist Deutschlands Sicherheit! Wir werden im Ernstfall jeden Zentimeter unseres Bündnisgebietes verteidigen.
Und ja, wir werden auch die Ukraine weiter intensiv mit Waffen unterstützen. Denn wir liefern nicht nur Rüstungsgüter in die Ukraine, um Menschenleben zu retten. Sondern mit diesen Lieferungen, so hoffe ich, geht auch ein Schub Vertrauen und Solidarität einher.
Und zugleich habe ich die Hoffnung, dass jüngere Generation aus unseren Ländern diese Erkenntnis und dieser Schulterschluss leichter fallen werden. Denn – ich glaube, das erleben ganz viele von Ihnen in den letzten Monaten – auch an deutschen Abendbrottischen sprechen Familien heute über die europäische Sicherheit.
Heute sagt die Viertklässlerin, dass sie froh ist, in der NATO zu sein. Ihre Oma sitzt daneben, schluckt vielleicht erst, weil sie sich daran erinnert, wie sie selbst 1980 gegen Aufrüstung auf die Straße gegangen ist.
Aber beide, die Viertklässlerin und ihre Großmutter, eint heute ein Gefühl, dass die Menschen in Ost- und Mitteleuropa schon lange kennen: Dass unsere Sicherheit zerbrechlich ist. Dass Frieden kostbar ist und dass wir zugleich dankbar sein können, in der NATO und vor allen Dingen in der Europäischen Union als Friedensunion zu leben.
Die Erschütterungen unserer Sicherheit werden die deutsche und die europäische Identität auf Jahrzehnte prägen – und wir werden sie prägen, mit aktiver Politik.
In diesem Zusammenhang sind die Ergebnisse der Umfrage der Körber-Stiftung zur deutschen Außenpolitik sehr interessant. Auch wenn sich viele Menschen – 52 Prozent in unserem Land – eine zurückhaltende Rolle Deutschlands wünschen, sagen 74 Prozent der Befragten, dass die Bundeswehr zum Schutz unserer Verbündeten eingesetzt werden sollte.
Heute, in dieser Situation, wissen die meisten Menschen in Europa, in Deutschland, worauf es ankommt. In dieser Situation kommt es auf unsere größte Stärke an: Auf unseren europäischen Zusammenhalt, auf unsere Solidarität mit denen, die unsere Unterstützung brauchen.
Denn Solidarität ist kein Selbstzweck. Sie ist die Grundlage für unsere gemeinsame Sicherheit. Diese europäische Solidarität ist unsere Lebensversicherung. Deswegen ist sie auch Grundlage unserer zukünftigen gemeinsamen Sicherheitspolitik. So haben wir es im strategischen Konzept der NATO und beim Gipfel in Madrid angelegt. Und so ist es angelegt in unserer Nationalen Sicherheitsstrategie, die wir federführend als Auswärtiges Amt gerade für die deutsche Bundesregierung schreiben.
Kern unserer zukünftigen Sicherheitspolitik ist die Sicherheit unseres Lebens, unserer Freiheit und die Sicherheit unserer Lebensgrundlagen.
Deshalb stellen wir unsere europäische und transatlantische Wehrhaftigkeit neu auf.
Ich würde gerne auf drei Punkte eingehen.
Erstens, dass wir die Ukraine weiter unterstützen - politisch, wirtschaftlich, humanitär und mit Waffen. Denn die Ukraine verteidigt in ihrem Überlebenskampf auch die europäische Freiheit.
Und ja, wenn man sich die Umfragen heute im Vergleich zum Februar oder März anschaut: Es werden da auch Fragen deutlicher. Und wir hören leichtfertige Sprüche: „Na ja, jetzt verhandelt doch endlich mal! Es kommt ja nicht auf jeden Teil der Ukraine an. Und brauchen wir nicht auch ein bisschen Kompromissbereitschaft, damit wir endlich wieder Frieden haben?“
Aber ich sage hier sehr klar und deutlich – auch wenn es wichtig ist, dass wir gerade in diesen Zeiten kontrovers diskutieren, das ist das Wesensmerkmal von starken Demokratien: Aus meiner Sicht ist diese naive Haltung schon 2014 gescheitert. Wir haben doch erlebt, dass die Annexion der Krim und das Vorgehen im Donbass nur ein Vorgriff auf das waren, was wir seit dem 24. Februar in der Ukraine sehen: Eine Vorbereitung der weiteren totalen Unterwerfung der Ukraine – das sagt der russische Präsident ja sehr deutlich.
Und schauen wir uns die Situation einmal an: Obwohl die halbe Welt in den letzten Monaten alles getan hat, um endlich Frieden wiederherzustellen; jeden Tag daran gearbeitet hat, dass dieser Horror des Krieges endlich aufhört; obwohl die halbe Welt den russischen Präsidenten bekniet, endlich seine Truppen zurückzuziehen, rekrutiert er dieser Tage eben keine Verhandlungsgruppe, sondern weitere Truppen, um einen weiteren Vormarsch auf die Ukraine vorzubereiten.
Wir sehen, dass diese Männer, die ja zum Großteil gegen ihren eigenen Willen in diesen Krieg geschickt werden, dass diese Männer, dass diese russischen Soldaten und Kämpfer keinen Frieden in die Ukraine bringen. Sie bringen, gerade im Osten der Ukraine, schlimmste Verbrechen: Vergewaltigte Frauen, verschleppte Kinder, Todesschüsse auf Bürgermeister, die Brot an ihre Bevölkerung verteilen, Todesschüsse auf Dirigenten, die nicht mit den Besatzern Musik machen wollen.
Deshalb werden wie die Ukrainerinnen und Ukrainer in ihrem Kampf für die Befreiung ihrer Mitmenschen weiter unterstützen, solange es nötig ist.
Und deswegen sage ich klar und deutlich: Ein Diktatfrieden ist kein Frieden für die Menschen in der Ostukraine.
Zweitens statten wir unsere Bundeswehr so aus, dass sie im Rahmen der NATO auch für die Sicherheit der Menschen in Tallinn, Riga, Vilnius oder Warschau da sein kann, wenn es nötig sein sollte. Dazu gehört, dass wir als Teil des europäischen Pfeilers der NATO auch die europäische Rüstungszusammenarbeit besser koordinieren.
Zurzeit haben wir in der NATO und in der EU so viele unterschiedliche Modelle von Transportfahrzeugen, dass wir nicht einmal in der Lage sind, ein gemeinsames Ersatzteillager dafür zu betreiben. Um es klar zu sagen: Wir sollten europäische Rüstungskooperation daher nicht als Wirtschaftsprojekt unterschiedlicher europäischer Nationalstaaten verstehen, sondern in erster Linie als gemeinsame Sicherheitsinstrumente. Und genau daran arbeiten wir.
Drittens stellen wir uns der Aggression Russlands dauerhaft entgegen.
Präsident Putin hat mit den Pseudo-Referenden in den besetzten Gebieten sehr klar gemacht, dass er keinen Weg zurück sucht. Deshalb geht es für Europa nicht um Sicherheit mit Putins Russland, sondern um Sicherheit vor Putins Russland.
Mit unserer Präsenz in Litauen können wir innerhalb von zehn Tagen mehrere tausend Soldatinnen und Soldaten unserer Brigade an die Nordostflanke der NATO verlegen. Wir stellen zudem Eurofighter zum Air Policing in Estland und Patriots für die Slowakei.
Wir haben gestern gemeinsam in Luxemburg beschlossen, dass wir 15.000 Soldatinnen und Soldaten aus der Ukraine ausbilden können und werden. Zum einen in Polen, zum anderen mit einem Headquarter-Teil hier in Deutschland. Wir machen deutlich: Wir stehen füreinander ein. Wir können uns aufeinander verlassen. Und zugleich ist klar, dass wir in einem hybriden Krieg sind, dass wir in einem Wettstreit zwischen den Systemen sind, zwischen Demokratien und autoritären Regimen. Deswegen wird ein Großteil unserer nationalen Sicherheitsstrategie und unserer Arbeit in der Europäischen Union und der NATO darin bestehen, dass wir gemeinsam resilienter werden, dass wir gemeinsam dafür sorgen, unsere Infrastruktur und unsere Netze besser zu schützen.
Die Explosionen an den Pipelines vor unseren Küsten zeigen, wie verwundbar wir dort sind. Deshalb haben wir in einer ersten Maßnahme als NATO beschlossen, gemeinsam mehr zum Schutz unserer Untersee-Infrastruktur zu tun.
Hunderttausende von Kilometern an Netzen – sei es Telekommunikation, sei es Strom, seien es Eisenbahnschienen – liegen vor uns. Und klar ist, man kann keine 100-prozentige Sicherheit und Schutz von Hunderttausenden von Kilometern versprechen.
34.000 Bahnkilometer allein in Deutschland können wir nicht dauerhaft rund um die Uhr an jeder Stelle überwachen. Aber wir können dafür sorgen, dass an den entscheidenden Punkten eine Überwachung stattfindet. Und wir können dafür sorgen, dass Meldeketten so funktionieren, dass bei Vorfällen oder Angriffen niemand zu Schaden kommt. So wie das zum Glück vor einigen Tagen sehr erfolgreich geklappt hat. Niemand ist zu Schaden gekommen und die Bahn hat nach wenigen Stunden ihren Betrieb wieder aufnehmen können.
Mit all diesen Maßnahmen machen wir Europa sicherer. Aber wir werden unsere Freiheit auf Dauer nur gewährleisten, wenn wir über die Grenzen unseres Kontinents hinausdenken. Wenn wir uns dem Wettbewerb zwischen denjenigen, die an das internationale Recht und die internationale Zusammenarbeit glauben, und autoritären Regimen, stellen – auch für Länder in anderen Teilen dieser Welt.
Das heißt, wir müssen zuerst aus den Fehlern unserer Russlandpolitik der letzten Jahrzehnte lernen. Ich sage es hier ganz deutlich: Einseitige wirtschaftliche Abhängigkeit macht uns politisch erpressbar.
Das ist mit Blick auf Russland jetzt vergossene Milch und wir könnten lange darüber reden, wer wann schon vorher gewarnt hat. Unsere osteuropäischen Freunde haben dies schon ganz lange getan. Und wir haben nicht darauf gehört. Wir müssen jetzt dafür sorgen, einen solchen Fehler nicht noch einmal zu machen. Und das heißt, wir werden das auch bei unserer Politik gegenüber China stärker berücksichtigen müssen. Deswegen ist ein Teil der Nationalen Sicherheitsstrategie, auch erstmalig eine deutsche China-Strategie zu formulieren, die natürlich eingebettet ist in die europäische China-Strategie.
Und wir werden deutlich machen, dass wir sehen, dass überall dort, wo wir auf der Welt nicht handeln, wo wir als europäische Wertepartner anderen Wertepartnern auf der Welt nicht beistehen, dass dieses Vakuum andere füllen – egal ob auf dem Westbalkan oder in Ostafrika.
Das gilt nicht nur für Sicherheit im Sinne von verteidigungspolitischen Fragen. Die allermeisten Länder auf dieser Welt sagen klar und deutlich: Die größte Sicherheitsgefahr ist die Klimakrise. Und deswegen ist auch die Frage, wie wir andere Länder bei der Bewältigung dieser Klimakrise unterstützen, eine hoch geopolitische Frage und die Sicherheitsfrage für die nächsten Jahrzehnte.
Unsere Botschaft an unsere Partner weltweit ist daher die, die sie auch an unsere osteuropäischen Freunde und Nachbarn ist: Wir sind für euch da. Wir machen euch starke und faire Angebote, weil wir gemeinsam Lösungen finden wollen und die Interessen aller Beteiligten abbilden wollen und nicht neue, brutale Abhängigkeiten schaffen werden.
Daher sind so technische Begriffe wie Global Gateway aus meiner Sicht zentral für unsere zukünftige Zusammenarbeit. Ich hoffe und freue mich, dass das auch im Laufe dieses Tages intensiv diskutiert wird.
Denn Solidarität und Zusammenarbeit sind kein Selbstzweck. Mit dem Kampf gegen die Klimakrise, mit unserem gemeinsamen energischen Eintreten gegen die Ernährungskrise, unserem Einsatz für das Völkerrecht stützen wir unsere Partner. Aber wir schützen vor allen Dingen unsere ureigenen Sicherheitsinteressen.
Meine Damen und Herren, der frühere tschechische Präsident Vaclav Havel hat einmal gesagt, er lebe dort, wo das Wort Solidarität imstande war, einen ganzen Machtblock zu erschüttern.
Es war die Solidarität der Menschen, die damals in Freiheit und Sicherheit leben wollten, statt unter sowjetischer Diktatur. Es war auch die Solidarität der Menschen in Prag und in Warschau, und es war der Mut der Freiheitsbewegungen im Baltikum, die die deutsche Wiedervereinigung ermöglicht haben.
Solidarität ist die Antwort Europas auf den brutalen russischen Angriffskrieg. Zusammen sind wir stärker als dieser Krieg. Herzlichen Dank!
Klimawandel und Energiewende: deutsch-belgische Zusammenarbeit
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Heute laden Außenministerin Baerbock und ihre belgische Amtskollegin Hadja Lahbib im Auswärtigen Amt in Berlin zur „6. Deutsch-Belgischen Konferenz“ ein. Das Treffen steht im Zeichen aktueller Herausforderungen, insbesondere des Klimawandels und der Energiewende. Ziel der Konferenz ist, dass deutsche und belgische Partner gemeinsame Lösungs- und Handlungsansätze entwickeln.
Die deutsch-belgische Konferenz bringt seit 2009 Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft beider Länder auf höchstem Niveau zusammen, um den Austausch zu aktuellen Themen zu fördern und sichtbar zu machen.
Fit für die Zukunft - Schwerpunkte der Konferenz
Heute werden dazu in vier Panels ausgewiesene Fachleute mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Konferenz erörtern,
- wie wir von den Folgen des Klimawandels bereits heute stark betroffene Länder besser unterstützen können – nicht zuletzt im Interesse der globalen Stabilität und Sicherheit;
- wie wir bei der Energiewende neue Abhängigkeiten bei der Versorgung mit Rohstoffen vermeiden können;
- wie wir angesichts der aktuellen Energiekrise die Versorgung mit Gas gemeinsam besser sicherstellen und gleichzeitig den Umstieg auf nichtfossile Energiequellen beschleunigen– national und europäisch;
- wie Belgien und Deutschland zusammenarbeiten können, um in Zukunft grünen Wasserstoff statt Gas für Industrie, Verkehr und Verbraucher in Europa in ausreichender Menge verfügbar zu machen.
Deutschland und Belgien sind bei Energiefragen wichtige Partner. So versorgen Pipelines aus Zeebrügge Deutschland mit Gas und perspektivisch mit Wasserstoff. Darüber hinaus arbeiten beide Länder bei der Nutzung von Offshore-Windkraft eng zusammen.
Neben Fragen der Energieversorgung spielt die internationale Klimapolitik bei der Konferenz eine wichtige Rolle. Dabei geht es unter anderem um die Zusammenhänge zwischen der globalen Klimakrise und internationale Sicherheitspolitik. Die Ergebnisse der Konferenz werden im Anschluss in einer gemeinsamen Erklärung dargestellt, die weitere Impulse für die enge deutsch-belgische Zusammenarbeit aufzeigen wird.
Berlin Peace Dialogue : Europa im Schatten des Krieges
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine greift nicht nur die Menschen in der Ukraine ganz unmittelbar an, er stellt auch eine Bedrohung für die internationale Friedensordnung dar.
Der eklatante Bruch Russlands mit den Grundsätzen der VN-Charta und der OSZE stellt die Frage nach der Friedens- und Sicherheitsordnung neu –nicht nur in Europa, sondern überall auf der Welt. Denn: der durch Völkerrecht geschützte Frieden ist überall auf der Welt nicht mehr dauerhaft garantiert, wenn sich die stärksten Mächte innerhalb dieser Ordnung nicht verlässlich an die vereinbarten kollektiven Regeln und Verträge binden.
Vor dem Hintergrund dieser Zeitenwende kommen am 29. September Expertinnen und Experten aus Politik, Wissenschaft, Think Tanks und aus der Zivilgesellschaft im Auswärtigen Amt zusammen, über die Möglichkeiten und Grenzen ziviler Krisenprävention und Konfliktbearbeitung in Europa und der Welt zu diskutieren und neue Lösungsansätze zu finden.
Was sind die Grenzen unserer heutigen Instrumente ziviler Krisenprävention und Konfliktbearbeitung? Wie effektiv sind sie noch? Was müssen wir neu entwickeln? Der Berlin Peace Dialogue 2022 richtet das Augenmerk auf die Herausforderungen für die deutsche und europäische zivile Krisenprävention, Konfliktbewältigung und Friedensförderung sowie auf Früherkennung und rechtzeitiges krisenpräventives Handeln.
Beirat der Bundesregierung Zivile Krisenprävention und Friedensförderung
Der Beirat bündelt zivilgesellschaftliche und wissenschaftliche Expertise zur Krisenprävention und Friedensförderung und berät die Arbeit der Bundesregierung. Die Mitglieder des Beirats kommen aus den Bereichen der internationalen Zusammenarbeit, Wissenschaft, Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen. Durch seine Arbeit fördert der Beirat aktiv den steten Austausch der Bundesregierung mit der Zivilgesellschaft.Mehr Informationen gibt es auf der Webseite des Beirats.
Neben Analysen der aktuellen sicherheitspolitischen Lage in Europa nehmen die Gäste auch kurz- und längerfristige Perspektiven und die Auswirkungen auf kritische Entwicklungen im globalen Maßstab in den Blick. Wie lassen sich Eskalationsrisiken von Konflikten zuverlässiger erkennen oder die Kooperationsbereitschaft von Konfliktparteien fördern? Wie kann es gelingen, gerade in den Bereichen wie Klima, Entwicklung, Rechtsstaatlichkeit oder Gesundheit, die Kooperation zu stärken und den Frieden zu fördern? Diese und andere Aspekte stehen in vielen Paneldiskussionen und Workshops über den gesamten Tag auf der Agenda.
Die Konferenz findet in englischer Sprache statt. Simultanübersetzung ins Deutsche wird angeboten. Der Livestream der Veranstaltung ist ab 09:15 Uhr hier verfügbar.
G7-Afrika-Konferenz in Berlin: Demokratien gemeinsam widerstandsfähiger machen
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Staaten Afrikas und G7 begegnen gemeinsam Herausforderungen für Demokratien
Zuhören, Ideen austauschen, lernen - so dass wir unsere Demokratien verbessern und stärken können. Das ist das Ziel der Konferenz, zu der heute in Berlin über 200 Vertreterinnen und Vertreter aus 8 afrikanischen Ländern, aus Ländern der G7 und von den Vereinten Nationen zusammenkommen.
 Wie können Demokratien am besten faktenbasierte Informationen bereitstellen? Wie können wir unsere Gesetze anpassen, um gegen kriminelle Inhalte im Internet vorzugehen? Die Konferenz wird hierzu und zu vielen weiteren Aspekten einen Überblick über bestehende Initiativen und Möglichkeiten für Partnerschaften im Bereich der Demokratieförderung geben. Neben Außenministerin Baerbock werden im Eröffnungssegment der Konferenz auch die Außenministerin von Ghana, Shirley Ayorkor Botchwey, sowie die nigerianische Menschenrechtsaktivistin und Mitbegründerin von Transparency International, Oby Ezekwesili sprechen. Ghana ist ein prominentes Beispiel dafür, wie mit Demokratie und guter Regierungsführung eine Entwicklung hin zu einem Land mit mittlerem Einkommen und zu einem regionalen Stabilitätszentrum möglich ist.
Wie können Demokratien am besten faktenbasierte Informationen bereitstellen? Wie können wir unsere Gesetze anpassen, um gegen kriminelle Inhalte im Internet vorzugehen? Die Konferenz wird hierzu und zu vielen weiteren Aspekten einen Überblick über bestehende Initiativen und Möglichkeiten für Partnerschaften im Bereich der Demokratieförderung geben. Neben Außenministerin Baerbock werden im Eröffnungssegment der Konferenz auch die Außenministerin von Ghana, Shirley Ayorkor Botchwey, sowie die nigerianische Menschenrechtsaktivistin und Mitbegründerin von Transparency International, Oby Ezekwesili sprechen. Ghana ist ein prominentes Beispiel dafür, wie mit Demokratie und guter Regierungsführung eine Entwicklung hin zu einem Land mit mittlerem Einkommen und zu einem regionalen Stabilitätszentrum möglich ist.
Hintergrund: Demokratische Systeme weltweit unter Druck
Sowohl in den Staaten Afrikas als auch in den Ländern der G7 sind die demokratischen Systeme zuletzt immer mehr unter Druck geraten. In der Europäischen Union wird beispielsweise mit Sorge gesehen, dass einige Regierungen die Rechtsstaatlichkeit, die Unabhängigkeit der Justiz und die Rechte von Minderheiten untergraben. In Afrika wiederum kommt es vor, dass Präsidenten die Verfassungen beugen, um ihre Amtszeit zu verlängern. In Demokratien weltweit verbreiten autokratische Kräfte aus dem Ausland falsche Erzählungen und Desinformationen.
Zugleich ist laut Umfragen die Demokratie weiterhin weltweit beliebt. So gaben rund 70 Prozent der Menschen in afrikanischen Staaten in einer repräsentativen Afrobarometer-Umfrage an, die Demokratie jeder anderen Regierungsform vorzuziehen. In den G7-Staaten sind die Zahlen ähnlich.
Umso wichtiger ist es, dass Demokratien gemeinsam ihre Kräfte bündeln, über Länder und Kontinente hinweg, um den beschriebenen Herausforderungen zu begegnen und die Demokratie für die Menschen zu bewahren. Genau darum hat Deutschland auch die Erhöhung der demokratischen Resilienz zu einem Schwerpunktthema seiner G7-Präsidentschaft im Jahr 2022 gemacht.
Zivilgesellschaft bei Konferenz breit vertreten
In der Demokratie geht es darum, dass die Regierungen ihren Bürgern dienen und verantwortlich zeigen - und dass alle an der Gesellschaft teilhaben: Junge Menschen, Minderheiten, Frauen und Mädchen im Besonderen. Bei der Konferenz sind entsprechend auch viele Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft dabei. Afrikanische und europäische zivilgesellschaftliche Gruppen leisten beispielsweise wertvolle Arbeit, indem sie dokumentieren, wie Russland Troll-Fabriken und Propaganda-Fernsehnetzwerke einrichtet und wie es Journalisten kauft, um Artikel auf Nachrichten-Websites zu beeinflussen. Die Konferenz soll auch dazu dienen, Anknüpfungspunkte für eine verstärkte Zusammenarbeit zu identifizieren.
Demokratie in Afrika: Koloniale Vergangenheit nicht vergessen
In vielen demokratischen Gesellschaften in afrikanischen Staaten mit einer sehr jungen Bevölkerung muss sich die Demokratie unter besonders schwierigen sozioökonomischen und politischen Bedingungen behaupten. Das Erbe des Kolonialismus hat afrikanischen Staaten eine schwere Last aufgebürdet, die oft bis heute fortwirkt. Das macht es der Demokratie schwer, Fuß zu fassen. So haben die Kolonialmächte oftmals Gemeinschaften mit der Taktik des „Herrschens und Teilens" gespalten und zogen die Landesgrenzen nach Belieben. Und auch nach der formalen Unabhängigkeit unterstützten externe Mächte oft nicht-demokratische Machthaber in Afrika.
Erarbeitung der Nationalen Sicherheitsstrategie: Abschluss der Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung in Erfurt mit Außenministerin Baerbock
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Ergebnisse des Bürgerinnen- und Bürgerdialogs festhalten
Zwanzig Bürgerinnen- und Bürger aus ganz Deutschland sprechen heute (26.09.) in Erfurt mit Außenministerin Baerbock über die Ergebnisse des Dialogprozesses zur künftigen nationalen Sicherheitsstrategie. Aktuell hat Thüringen den Bundesratsvorsitz inne. Darum findet das Abschlusstreffen in der Landeshauptstadt statt.
 Außenministerin Baerbock geht es um Feedback zur Frage, wie die von den Bürgerinnen- und Bürgern in den letzten Monaten erarbeiteten Ideen, Inhalte und Vorstellungen nun in die Erstellung der Nationalen Sicherheitsstrategie konkret einfließen werden. Hierzu wird Außenministerin Baerbock im Fishbowl-Format mit der Gruppe diskutieren. Jede und jeder kommt zu Wort, es wird debattiert und gemeinsam überlegt. Die Teilnehmenden greifen dazu auf die Ergebnisse des bisherigen Dialogprozesses zurück, in dessen Rahmen sie konkrete Zielvorstellungen für die Nationale Sicherheitsstrategie entwickelt hatten. Hierzu zählen unter anderem: Wie kann Deutschland am besten für seine Sicherheit im Kreis seiner Partner in der EU, in der NATO und in den Vereinten Nationen sorgen? Wie kann sich Deutschland besser auf Krisen vorbereiten – sei es bei Bedrohungen von außen oder bei Naturkatastrophen? Wie schützen wir unsere kritische Infrastruktur, und wie stellen wir uns besser auf gegen Cyberangriffe?
Außenministerin Baerbock geht es um Feedback zur Frage, wie die von den Bürgerinnen- und Bürgern in den letzten Monaten erarbeiteten Ideen, Inhalte und Vorstellungen nun in die Erstellung der Nationalen Sicherheitsstrategie konkret einfließen werden. Hierzu wird Außenministerin Baerbock im Fishbowl-Format mit der Gruppe diskutieren. Jede und jeder kommt zu Wort, es wird debattiert und gemeinsam überlegt. Die Teilnehmenden greifen dazu auf die Ergebnisse des bisherigen Dialogprozesses zurück, in dessen Rahmen sie konkrete Zielvorstellungen für die Nationale Sicherheitsstrategie entwickelt hatten. Hierzu zählen unter anderem: Wie kann Deutschland am besten für seine Sicherheit im Kreis seiner Partner in der EU, in der NATO und in den Vereinten Nationen sorgen? Wie kann sich Deutschland besser auf Krisen vorbereiten – sei es bei Bedrohungen von außen oder bei Naturkatastrophen? Wie schützen wir unsere kritische Infrastruktur, und wie stellen wir uns besser auf gegen Cyberangriffe?
Intensiver Dialogprozess im Frühjahr und Sommer 2022
 Deutschland gibt sich erstmals eine Nationale Sicherheitsstrategie. Sie wird nicht hinter verschlossenen Türen erstellt, sondern in einem gemeinsamen und inklusiven Prozess mit der Öffentlichkeit sowie Expertinnen und Experten. Dazu wurde ein umfassender Dialogprozess aufgelegt. In einer breiten, methodisch repräsentativen Bürgerbeteiligung suchte das Auswärtige Amt den Austausch. Von Görlitz bis München fanden an sieben Orten in ganz Deutschland Dialogveranstaltungen statt. Parallel dazu hat Außenministerin Baerbock auf einer Deutschlandreise weitere Eindrücke gesammelt und Gespräche zu verschiedenen Aspekten von Sicherheit für Deutschland und Europa geführt. Aus den insgesamt 350 Teilnehmenden lud das Auswärtige Amt 50 zu einem Methoden-Workshop „Open Situation Room“ im August nach Berlin ein. Dort erarbeiteten sie zusammen mit Fachpersonen konkrete Lösungsansätze zur Operationalisierung der zuvor in den Dialogen erarbeiteten Ziele. Zwanzig der Teilnehmenden sind nun heute in Erfurt dabei.
Deutschland gibt sich erstmals eine Nationale Sicherheitsstrategie. Sie wird nicht hinter verschlossenen Türen erstellt, sondern in einem gemeinsamen und inklusiven Prozess mit der Öffentlichkeit sowie Expertinnen und Experten. Dazu wurde ein umfassender Dialogprozess aufgelegt. In einer breiten, methodisch repräsentativen Bürgerbeteiligung suchte das Auswärtige Amt den Austausch. Von Görlitz bis München fanden an sieben Orten in ganz Deutschland Dialogveranstaltungen statt. Parallel dazu hat Außenministerin Baerbock auf einer Deutschlandreise weitere Eindrücke gesammelt und Gespräche zu verschiedenen Aspekten von Sicherheit für Deutschland und Europa geführt. Aus den insgesamt 350 Teilnehmenden lud das Auswärtige Amt 50 zu einem Methoden-Workshop „Open Situation Room“ im August nach Berlin ein. Dort erarbeiteten sie zusammen mit Fachpersonen konkrete Lösungsansätze zur Operationalisierung der zuvor in den Dialogen erarbeiteten Ziele. Zwanzig der Teilnehmenden sind nun heute in Erfurt dabei.
Nationale Sicherheitsstrategie bis Anfang 2023
Das Auswärtige Amt erarbeitet derzeit den ersten Entwurf der Nationalen Sicherheitsstrategie. Die vielen wertvollen Gedanken und Ideen, die die Bürgerinnen und Bürger beigesteuert haben, spielen dabei eine wichtige Rolle. Der Anspruch der Bundesregierung ist es, am Ende eine Sicherheitsstrategie zu präsentieren, die den Erwartungen aus dem Dialogprozess gerecht wird und Antworten auf Fragen liefert, mit denen sich die Bürgerinnen und Bürger mit Blick auf unsere nationale Sicherheit beschäftigen. Die Bundesregierung schaut sich dazu jede einzelne Anregung genau an. Der Prozess wird bis Anfang 2023 abgeschlossen.
Erste nationale deutsche #Sicherheitsstrategie – Bürgerinnen- & #Bürgerdialoge legen das Fundament (Youtube)
Klima, Frieden und Sicherheit – warum alles zusammenhängt
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Ob bei der Flutkatastrophe in Pakistan, der Dürre am Horn von Afrika oder den Bränden in Europa, überall auf der Welt sehen wir: Die Klimakrise bedroht Menschenleben. Dies zeigt, der menschengemachte Klimawandel ist nicht nur ein Umweltphänomen, sondern eine Bedrohung für Frieden und Sicherheit.
Klimakrise: Katalysator für Konflikte und Spannungen
Der steigende Meeresspiegel, Rekordtemperaturen, häufiger auftretende Wetterextreme und das wachsende Risiko von Umweltkatastrophen entziehen Menschen zunehmend die Existenzgrundlage. Wenn die Folgen der Klimakrise mit sozialen, politischen oder wirtschaftlichen Herausforderungen zusammentreffen – wie aktuell der Covid-19 Pandemie, dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine oder steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen – können sie Katalysator sein für Konflikte und Spannungen.
Dies kann man aktuell im Pazifik beobachten, wo der Meeresspiegelanstieg, Küstenerosion und der schwindende Fischbestand zu geopolitischen Spannungen führen. Oder in der Sahel-Region, wo zunehmende Wüstenbildung und Dürren nomadische Viehhirten dazu drängen, in von sesshaften Bauern besiedelte Regionen auszuweichen und Konflikte verschärfen.
Energieversorgung, Klima, Frieden und Sicherheit
 Klimainduzierte Konflikte wirken sich weltweit auf Lebensgrundlagen, humanitäre Bedarfe und Flucht- und Migrationsbewegungen aus. In vielen Ländern stellen Klimawandelfolgen den politischen und geopolitischen Status Quo in Frage. Spätestens seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energie- und Lebensmittelkrise ist für jede und jeden spürbar: Die Themen Energieversorgung, Frieden, Sicherheit und Klima sind eng mit einander verknüpft.
Klimainduzierte Konflikte wirken sich weltweit auf Lebensgrundlagen, humanitäre Bedarfe und Flucht- und Migrationsbewegungen aus. In vielen Ländern stellen Klimawandelfolgen den politischen und geopolitischen Status Quo in Frage. Spätestens seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energie- und Lebensmittelkrise ist für jede und jeden spürbar: Die Themen Energieversorgung, Frieden, Sicherheit und Klima sind eng mit einander verknüpft.
Bei Ihrer Reise nach Palau sagte Außenministerin Baerbock:
Dieser Krieg scheint Tausende Kilometer weit von hier entfernt stattzufinden, doch seine schrecklichen Auswirkungen sind rund um den Globus zu spüren, von Afrika bis Asien, durch steigende Lebensmittel- und Energiepreise und Millionen Menschen, die an Hunger leiden oder gar sterben.
Die Auswirkungen dieses skrupellosen Krieges treffen diejenigen am schwersten, die bereits unter den Folgen der Klimakrise zu leiden haben, aufgrund von Überschwemmungen, Dürren, zerstörerischen Stürmen.
Das macht gnadenlos deutlich, dass der Klimanotstand keine isolierte Krise ist. Er ist die größte sicherheitspolitische Herausforderung unserer Zeit.
Multilaterales Engagement für Klima und Sicherheit
 Deutschland nutzte seinen nichtständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 2019/20, um das internationale Bewusstsein für die sicherheitspolitischen Folgen des Klimawandels zu schärfen und das Thema auf die Agenda des Sicherheitsrats zu setzen.
Deutschland nutzte seinen nichtständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 2019/20, um das internationale Bewusstsein für die sicherheitspolitischen Folgen des Klimawandels zu schärfen und das Thema auf die Agenda des Sicherheitsrats zu setzen.
Bereits 2018 gründete Deutschland gemeinsam mit dem Inselstaat Nauru die „Group of Friends on Climate and Security“ der Vereinten Nationen. Darüber hinaus unterstützt Deutschland eine Vielzahl von Klimainitiativen im Bereich der Friedensförderung und trägt auf unterschiedliche Weise zur Verankerung von Klima und Sicherheit in den Vereinten Nationen bei.
Auch im Zusammenhang der UN-Klimakonferenzen COP spielt das Thema eine zunehmend größere Rolle. Bei der bevorstehenden COP27 in Ägypten beabsichtigt Deutschland ein Side-Event zu Klima und Sicherheit auszurichten. Bereits bei der COP26 in Glasgow war das Thema mit einem Event im deutschen Pavillon vertreten.
Klima und Sicherheit war auch ein Schwerpunkt des Treffens der G7 Außenministerinnen und Außenminister unter deutschem Vorsitz im Mai 2022. Im Oktober wird Deutschland die Berlin Climate and Security Conference (BCSC) in Berlin ausrichten und die „Climate, Environment, Peace and Security“-Initiative ins Leben rufen.
Berlin Climate and Security Conference
Die Berlin Climate and Security Conference (BCSC) findet vom 11-12. Oktober 2022 im Auswärtigen Amt unter dem Motto „Climate, Conflict, Clash of Crises – Weathering the Risks” statt. Die Konferenz wird den Startpunkt der „Climate, Environment, Peace and Security“-Initiative bilden und neben der hochrangigen Eröffnungszeremonie auf Ministerinnen und Ministerebene zahlreiche Workshops und Paneldiskussionen auf Arbeits- und Expertenebene ermöglichen. Teilnahme am Präsenzprogramm ist nur auf Einladung möglich. Im Anschluss findet ein einwöchiges digitales Konferenzprogramm statt, welches zahlreiche kostenlose Möglichkeiten der Teilnahme und Interaktion für die interessierte (Fach-)Öffentlichkeit bietet. Mehr Informationen sind auf der Webseite der Konferenz zu finden.
Ukrainischer Weizen für das Horn von Afrika - Deutschland unterstützt ukrainische Hilfsaktion
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Große Geste eines geschundenen Landes: Der ukrainische Präsident Selensky hat in seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in der Nacht zum Donnerstag angekündigt, weitere 50 Tausend Tonnen Getreide zu spenden, um den Hunger in der Welt zu lindern. Konkret soll die Lieferung Menschen in Äthiopien und Somalia zu Gute kommen. Deutschland und Frankreich haben angekündigt, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen beim Transport und der Verteilung des Getreides aus der Ukraine zu unterstützen.
Hilfe zur rechten Zeit
Der Hunger nimmt weltweit zu. Aktuell haben rund 800 Millionen Menschen nicht ausreichend zu Essen. Besonders dramatisch ist die Lage am Horn von Afrika: Dort hat es in den letzten vier Jahren in vielen Regionen kaum geregnet. Mehrere hunderttausend Menschen sind von einer Hungersnot betroffen. Millionen Tiere sind bereits verendet.
Mit dem Getreide aus der Ukraine können 1,6 Millionen unterernährte Menschen - das entspricht der Bevölkerung einer Großstadt wie München - in Äthiopien eine Monatsration Getreide erhalten. Die Lebensmittelhilfe trägt dazu bei, dass der Grundbedarf von Familien gesichert wird und sie das wenige eigene Geld mehr für lokale Lebensmittel wie Gemüse, Obst, Fisch oder Fleisch ausgeben können.
Außenministerin Baerbock sagte dazu am 22.09. in New York:
In diesen Stunden ist es ein so wichtiges Zeichen, dass die Ukraine deutlich macht: Wir verteidigen nicht nur unser Land und unsere Bevölkerung, sondern wir kümmern uns auch um die Auswirkungen dieses Kriegs weltweit. Indem sie fünfzigtausend Tonnen Weizen für Äthiopien und Somalia spendet, zeigt die Ukraine, dass sie auch für das internationale Recht einsteht. Deutschland und Frankreich werden den Transport dieser Getreidespende finanzieren. Wir denken in diesen Zeiten nicht nur an die Menschen in Russland, wir sind nicht nur an der Seite der Menschen in der Ukraine, sondern wir sind an der Seite all derjenigen, die die Konsequenzen dieses brutalen Angriffskriegs austragen müssen.
Deutschland unterstützt die Menschen am Horn von Afrika konkret: 2022 hat das Auswärtige Amt bereits 126 Millionen Euro für humanitäre Hilfe in Äthiopien und in Nachbarstaaten Somalia und Kenia bereitgestellt.
Deutschland ist ein verlässlicher Partner im Kampf gegen den Hunger in der Welt
Das Auswärtige Amt setzt ein Drittel seines Gesamtbudgets ein, um humanitäre Hilfe zu leisten. Der größte Teil davon geht in die Ernährungshilfe: Im vergangenen Jahr hat das Auswärtige Amt das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) mit über 700 Millionen Euro unterstützt und so Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln versorgt. Weitere Hilfsgelder werden zur Gesundheits- oder Wasserversorgung notleidender Menschen sowie im Katastrophenschutz bereitgestellt.
77. Generalversammlung der Vereinten Nationen: Die Welt trifft sich zum Gipfel
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Zur jährlichen 77. UN-Vollversammlung in New York treffen sich diese Woche Regierungschefinnen und -chefs sowie Außenministerinnen und -minister aus fast allen Ländern der Welt. Komplexe, miteinander verflochtene Krisen, darunter die Folgen der COVID-19-Pandemie, des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, der Klimakrise sowie die wachsende Besorgnis über den Zustand der Weltwirtschaft fordern die internationale Gemeinschaft heraus.
Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock werden Deutschland bei zahlreichen Veranstaltungen in New York vertreten.
Keine „normale“ Generalversammlung
„A watershed moment: transformative solutions to interlocking challenges“, lautet das Motto der 77. Generalversammlung, die mehr denn je als das zentrale Forum gebraucht wird, um aufeinander zuzugehen, miteinander im Dialog zu sein und sich gegenseitig zuzuhören.
Außenministerin Baerbock sagte vor ihrer Abreise nach New York:
Wie viele andere hätte ich mir nichts sehnlicher gewünscht, als dass dieser Gipfel der Weltgemeinschaft unter anderen, friedlicheren Vorzeichen stattfindet. Denn dieser Tage braucht es die Vereinten Nationen mehr als jemals zuvor. Und zwar für das, was sie im Kern auszeichnet: einander mit Respekt und Verständnis zuhören, geeint im Glauben an die Grundwerte der UN-Charta, wie Verzicht auf Gewalt, Gleichheit aller Staaten und internationale Zusammenarbeit. Und es braucht die Vereinten Nationen dafür, dass wir gemeinsame Lösungen für globale Probleme finden. Dass kein Land in Angst leben muss, dass ein stärkerer Nachbar es angreift.
Die Brutalität des russischen Angriffskriegs und seine Bedrohung für die Friedensordnung Europas verstellen unseren Blick nicht davor, dass seine dramatischen Auswirkungen in vielen Weltregionen wie durch ein Brennglas wirken. Deshalb werde ich die zahlreichen Veranstaltungen und Gespräche der kommenden Woche dafür nutzen, die Themen und Anliegen unserer Partner in Afrika, Asien, Lateinamerika und der arabischen Welt in den Mittelpunkt zu stellen. Mit jenen zu sprechen und konkrete Lösungen anzugehen, die von Klimawandel und Ernährungskrise am meisten betroffen sind. Denn wir tragen nicht nur für Europa Verantwortung, sondern gemeinsam für die ganze Welt.
(Die gesamte Pressemitteilung finden Sie hier)
Multidimensionale Krise durch Putins Krieg in der Ukraine
Putin bringt mit seinem Krieg nicht nur unermessliches Leid über die Menschen in der Ukraine. Durch den Preisschock am Getreidemarkt hat sich die Ernährungssituation vieler Millionen Menschen verschlechtert, die besonders unter der Lebensmittelkrise leiden. Hinzu kommen Unsicherheiten bei der Energieversorgung, Verschuldung und eine prekäre Weltwirtschaftslage. Als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist Russland auf besondere Weise der Charta der Vereinten Nationen und dem Frieden in der Welt verpflichtet. Dieser Verantwortung wird Russland nicht gerecht, sondern tritt das Fundament der Vereinten Nationen mit Füßen.
 Außenministerin Baerbock wird in New York deutlich machen: Wir stehen fest an der Seite der Ukraine und an der Seite der Menschen, die weltweit unter Putins Krieg leiden. Zudem setzt sich Deutschland für die Strafverfolgung von Kriegs- und Völkerrechtsverbrechen in der Ukraine ein. Außenministerin Baerbock lädt dazu in New York als Co-Gastgeberin zu einem hochrangigen Treffen ein. Die Außenministerin wird zudem an einem Treffen zur Lage der ukrainischen Atomkraftwerke und zu nuklearer Sicherheit teilnehmen.
Außenministerin Baerbock wird in New York deutlich machen: Wir stehen fest an der Seite der Ukraine und an der Seite der Menschen, die weltweit unter Putins Krieg leiden. Zudem setzt sich Deutschland für die Strafverfolgung von Kriegs- und Völkerrechtsverbrechen in der Ukraine ein. Außenministerin Baerbock lädt dazu in New York als Co-Gastgeberin zu einem hochrangigen Treffen ein. Die Außenministerin wird zudem an einem Treffen zur Lage der ukrainischen Atomkraftwerke und zu nuklearer Sicherheit teilnehmen.
Klima und Sicherheit im Fokus
Die Klimakrise legt sich wie ein Brandbeschleuniger über alle anderen Krisen der Welt. Schwere Überschwemmungen und Stürme, steigende Meeresspiegel, aber auch Trockenheit und Dürren zwingen Menschen in ohnehin bereits vulnerablen Staaten dazu, ihre Heimat zu verlassen. Es entstehen bewaffnete Konflikte um Land und Nahrungsmittel.
In New York wird Außenministerin Baerbock deshalb auch darüber beraten, wie besonders stark betroffene Staaten im Sinne der Klimagerechtigkeit gestärkt werden können. Gleichzeitig wird sie gemeinsam mit Politikerinnen und Politikern und der Zivilgesellschaft wirksame Ansätze zur Bewältigung humanitärer, sicherheitsrelevanter und geopolitischer Folgen der Klimakrise diskutieren. Dabei werden vor allem Vertreterinnen und Vertreter von besonders bedrohten Staaten wie dem Pazifikstaat Palau das Wort ergreifen.
Starkes Engagement für feministische Außenpolitik
 Die großen Herausforderungen unserer Zeit können nicht ohne eine feministische Außenpolitik angegangen werden. Denn: „Frauenrechte sind Gradmesser für den freiheitlich demokratischen Zustand unserer Gesellschaften. Genau deswegen sind sie eben nicht ein Frauenthema, sondern sie sind ein Menschenrechts-, ein Demokratie-, ein Rechtsstaats-Thema“ wie Außenministerin Baerbock unlängst erklärte.
Die großen Herausforderungen unserer Zeit können nicht ohne eine feministische Außenpolitik angegangen werden. Denn: „Frauenrechte sind Gradmesser für den freiheitlich demokratischen Zustand unserer Gesellschaften. Genau deswegen sind sie eben nicht ein Frauenthema, sondern sie sind ein Menschenrechts-, ein Demokratie-, ein Rechtsstaats-Thema“ wie Außenministerin Baerbock unlängst erklärte.
Im Rahmen einer Veranstaltung zur „Feminist Foreign Policy“ wird sich Außenministerin Baerbock deshalb bei der UN-Generalversammlung auch der Frage der globalen Geschlechtergerechtigkeit und der gleichberechtigen Teilhabe an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft annehmen und mit Amtskolleginnen und -kollegen Perspektiven aus verschiedenen Weltregionen in den Fokus nehmen.
Regionale Herausforderungen fest im Blick
Darüber hinaus stehen viele weitere Themen auf der Agenda. Regionalkonflikte wie am Horn von Afrika, im Sahel oder im Nahen Osten dauern weiter an und dürfen im Schatten von Russlands Krieg nicht aus den Augen zu verloren werden.
Im sogenannten „Kleeblatt-Format“ wird Außenministerin Baerbock ein Treffen mit Frankreich, Ägypten und Jordanien zum Nahost-Friedensprozess ausrichten. Gemeinsam mit Frankreich wird sie außerdem Fragen der internationalen Cybersicherheit auf die Agenda setzen.
Schließlich wird die Außenministerin mit Amtskolleginnen und -kollegen aus verschiedenen Ländern zusammentreffen. Sie wird zudem als Vorsitz im G7-Format einladen und sich mit Brasilien, Indien und Japan in der Gruppe der Vier zur Reform des UN-Sicherheitsrats austauschen.
Deutschland erklärt in Genf Verzicht auf Tests mit Anti-Satelliten-Raketen
, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Politisch bindende Selbstverpflichtung
Im April diesen Jahres haben die USA die diplomatische Initiative ergriffen und eine politisch bindende Selbstverpflichtung abgegeben, künftig keine destruktiven Tests bodengebundener Anti-Satellitenraketen durchzuführen. Kanada und Neuseeland haben sich in der Zwischenzeit ebenfalls angeschlossen.
Deutschland hat nie solche Tests durchgeführt und hat sich heute dieser politisch verbindlichen Selbstverpflichtung angeschlossen. Ein deutscher Vertreter erklärte im Rahmen der Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen zu verantwortlichem Verhalten im Weltraum in Genf:
Deutschland verpflichtet sich, keine destruktiven Tests bodengebundener Anti-Satelliten-Raketen durchzuführen.
Weltraumschrott ist Gefahr für zivile Raumfahrt
Satelliten sind äußerst verwundbar und zunehmend mehr Bedrohungen ausgesetzt. Die Waffen erhöhen nicht nur das Risiko von Missverständnissen und Eskalation, zum Beispiel weil Tests leicht für einen echten Angriff gehalten werden können, sie führen auch zur Entstehung von Weltraumschrott. Die entstehenden Trümmerteile, die je nach Höhe bis zu Jahrzehnten und Jahrhunderten im erdnahen Orbit verbleiben, bevor sie schließlich in der Atmosphäre verglühen, beeinträchtigen die friedliche Nutzung des Weltraums dauerhaft und schwerwiegend. Selbst kleine Splitter können so zur tödlichen Gefahr für Astronautinnen und Astronauten werden.
Der letzte sogenannte destruktive Test einer bodengebundenen Anti-Satelliten-Rakete wurde Ende 2021 von Russland durchgeführt: beim Abschuss eines eigenen Satelliten entstanden mehr als 1.500 Trümmerteile, von denen viele mehrere Jahre im Orbit bleiben werden.
Satellitentechnik - Grundlage für moderne Wirtschaft
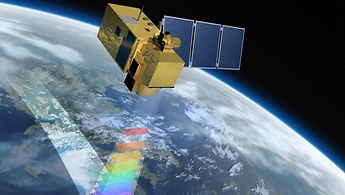 Der freie und ungehinderte Zugang zum Weltraum spielt für unser tägliches Leben, unsere Wirtschaft und unsere Sicherheit eine zentrale Rolle. Satellitenkommunikation ermöglicht weltweite Konnektivität, Satellitennavigation ist unverzichtbar für die Luft- und Seefahrt und Erdbeobachtungssatelliten sind wichtige Helfer im Kampf gegen die Klimakrise, denn sie ermöglichen es, Veränderungen unseres Planeten lückenlos zu beobachten und frühzeitig zu erkennen, wo unumkehrbare Schäden entstehen können.
Der freie und ungehinderte Zugang zum Weltraum spielt für unser tägliches Leben, unsere Wirtschaft und unsere Sicherheit eine zentrale Rolle. Satellitenkommunikation ermöglicht weltweite Konnektivität, Satellitennavigation ist unverzichtbar für die Luft- und Seefahrt und Erdbeobachtungssatelliten sind wichtige Helfer im Kampf gegen die Klimakrise, denn sie ermöglichen es, Veränderungen unseres Planeten lückenlos zu beobachten und frühzeitig zu erkennen, wo unumkehrbare Schäden entstehen können.
Deutschland setzt sich für eine Stärkung der regelbasierten Ordnung im Weltraum ein
Bereits seit längerem setzt sich Deutschland im Rahmen der Vereinten Nationen dafür ein, Bedrohungen durch verantwortliches Staaten-Verhalten im Weltraum zu reduzieren. Mit deutscher Unterstützung wurde dazu im letzten Jahr eine Arbeitsgruppe zu Bedrohungen und Risiken im Weltall, wie zum Beispiel Annäherungsoperationen von Satelliten an andere Satelliten, ins Leben gerufen. Deutschland bemüht sich zusammen mit Partnern um die Schaffung von klaren Prinzipien und Regeln, die Transparenz erhöhen, Kommunikationskanäle herstellen und Eskalationsrisiken in der Nutzung des Weltraums minimieren.